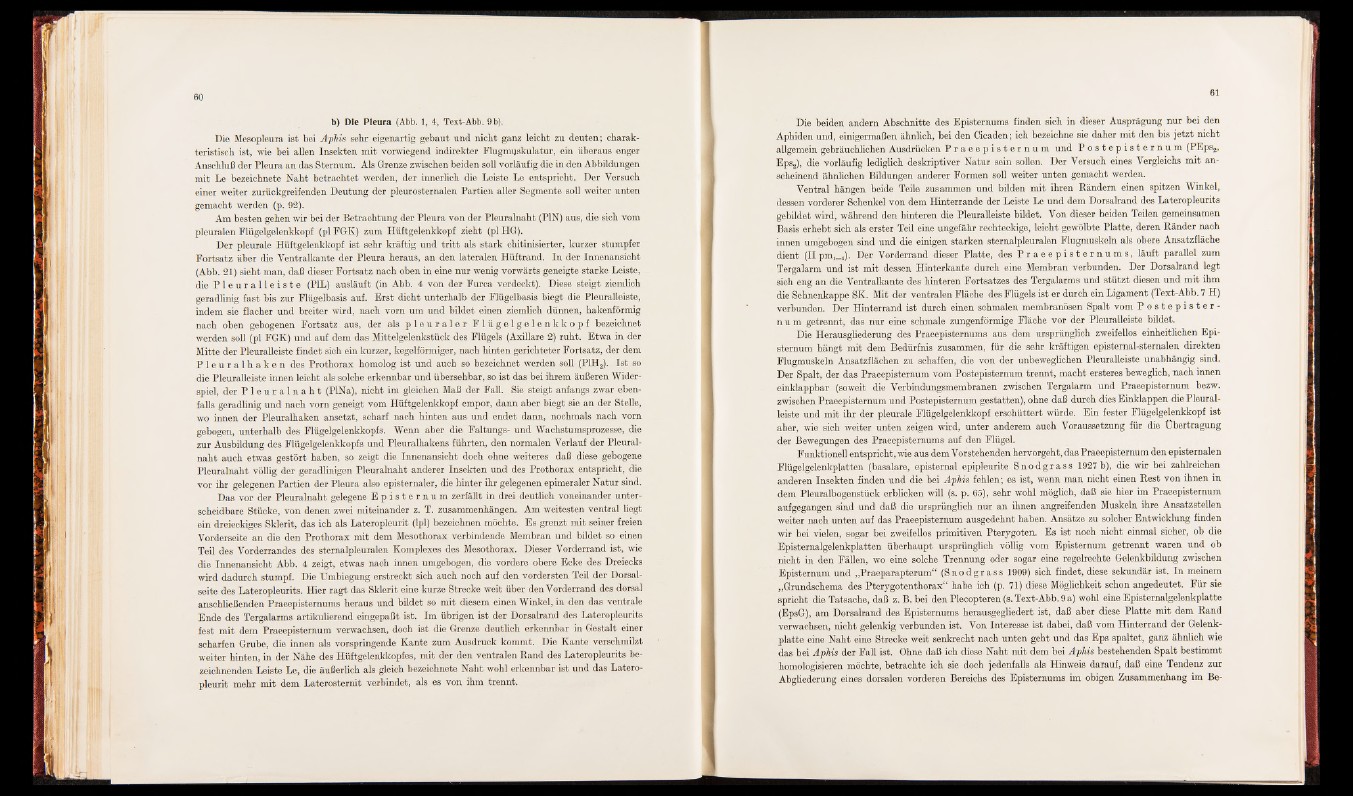
b) Die Pleura (Abb. 1, 4, Text-Abb. 9 b).
Die Mesopleura ist bei Aphis sehr eigenartig gebaut und nicht ganz leicht zu deuten; charakteristisch
ist, wie bei allen Insekten mit vorwiegend indirekter Flugmuskulatur, ein überaus enger
Anschluß der Pleura an das Sternum. Als Grenze zwischen beiden soll vorläufig die in den Abbildungen
mit Le bezeichnete Naht betrachtet werden, der innerlich die Leiste Le entspricht. Der Versuch
einer weiter zurückgreifenden Deutung der pleurosternalen Partien aller Segmente soll weiter unten
gemacht werden (p. 92).
Am besten gehen wir bei der Betrachtung der Pleura von der Pleuralnaht (PIN) aus, die sich vom
pleuralen Flügelgelenkkopf (pl FGK) zum Hüftgelenkkopf zieht (pl HG).
Der pleurale Hüftgelenkkopf ist sehr kräftig und tr itt als stark chitinisierter, kurzer stumpfer
Fortsatz über die Ventralkante der Pleura heraus, an den lateralen Hüftrand. In der Innenansicht
(Abb. 21) sieht man, daß dieser Fortsatz nach oben in eine nur wenig vorwärts geneigte starke Leiste,
die P l e u r a l l e i s t e (P1L) ausläuft (in Abb. 4 von der Furca verdeckt). Diese steigt ziemlich
geradlinig fast bis zur Flügelbasis auf. Erst dicht unterhalb der Flügelbasis biegt die Pleuralleiste,
indem sie flacher und breiter wird, nach vorn um und bildet einen ziemlich dünnen, hakenförmig
nach oben gebogenen Fortsatz aus, der als p l e u r a l e r F l ü g e l g e l e n k k o p f bezeichnet
werden soll (pl FGK) und auf dem das Mittelgelenkstück des Flügels (Axillare 2) ruht. Etwa in der
Mitte der Pleuralleiste findet sich ein kurzer, kegelförmiger, nach hinten gerichteter Fortsatz, der dem
P l e u r a l h a k e n des Prothorax homolog ist und auch so bezeichnet werden soll (P1H2). Ist so
die Pleuralleiste innen leicht als solche erkennbar und übersehbar, so ist das bei ihrem äußeren Widerspiel,
der P l e u r a l n a h t (PINa), nicht im gleichen Maß der Fall. Sie steigt anfangs zwar ebenfalls
geradlinig und nach vorn geneigt vom Hüftgelenkkopf empor, dann aber biegt sie an der Stelle,
wo innen der Pleuralhaken ansetzt, scharf nach hinten aus und endet dann, nochmals nach vorn
gebogen, unterhalb des Flügelgelenkkopfs. Wenn aber die Faltungs- und Wachstumsprozesse, die
zur Ausbildung des Flügelgelenkkopfs und Pleuralhakens führten, den normalen Verlauf der Pleuralnaht
auch etwas gestört haben, so zeigt die Innenansicht doch ohne weiteres daß diese gebogene
Pleuralnaht völlig der geradlinigen Pleuralnaht anderer Insekten und des Prothorax entspricht, die
vor ihr gelegenen Partien der Pleura also episternaler, die hinter ihr gelegenen epimeraler Natur sind.
Das vor der Pleuralnaht gelegene E p i s t e r n u m zerfällt in drei deutlich voneinander unterscheidbare
Stücke, von denen zwei miteinander z. T. Zusammenhängen. Am weitesten ventral liegt
ein dreieckiges Sklerit, das ich als Lateropleurit (lpl) bezeichnen möchte. Es grenzt mit seiner freien
Vorderseite an die den Prothorax mit dem Mesothorax verbindende Membran und bildet so einen
Teil des Vorderrandes des sternalpleuralen Komplexes des Mesothorax. Dieser Vorderrand ist, wie
die Innenansicht Abb. 4 zeigt, etwas nach innen umgebogen, die vordere obere Ecke des Dreiecks
wird dadurch stumpf. Die Umbiegung erstreckt sich auch noch auf den vordersten Teil der Dorsalseite
des Lateropleurits. Hier ragt das Sklerit eine kurze Strecke weit über den Vorderrand des dorsal
anschließenden Praeepistemums heraus und büdet so mit diesem einen Winkel, in den das ventrale
Ende des Tergalarms artikulierend eingepaßt ist. Im übrigen ist der Dorsalrand des Lateropleurits
fest mit dem Praeepisternum verwachsen, doch ist die Grenze deutlich erkennbar in Gestalt einer
scharfen Grube, die innen als vorspringende Kante zum Ausdruck kommt. Die Kante verschmilzt
weiter hinten, in der Nähe des Hüftgelenkkopfes, mit der den ventralen Rand des Lateropleurits bezeichnenden
Leiste Le, die äußerlich als gleich bezeichnete Naht wohl erkennbar ist und das Lateropleurit
Trip.hr mit dem Laterosternit verbindet, als es von ihm trennt.
Die beiden ändern Abschnitte des Episternums finden sich in dieser Ausprägung nur bei den
Aphiden und, einigermaßen ähnlich, bei den Cicaden; ich bezeichne sie daher mit den bis jetzt nicht
allgemein gebräuchlichen Ausdrücken P r a e e p i s t e r n u m und P o s t e p i s t e r n u m (PEps2,
Eps2), die vorläufig lediglich deskriptiver Natur sein sollen. Der Versuch eines Vergleichs mit anscheinend
ähnlichen Bildungen anderer Formen soll weiter unten gemacht werden.
Ventral hängen beide Teile zusammen und bilden mit ihren Rändern einen spitzen Winkel,
dessen vorderer Schenkel von dem Hinterrande der Leiste Le und dem Dorsalrand des Lateropleurits
gebildet wird, während den hinteren die Pleuralleiste bildet. Von dieser beiden Teilen gemeinsamen
Basis erhebt sich als erster Teü eine ungefähr rechteckige, leicht gewölbte Platte, deren Ränder nach
innen um'gebogen sind und die einigen starken sternalpleuralen Flugmuskeln als obere Ansatzfläche
dient (II pm ^ ) . Der Vorderrand dieser Platte, des P r a e e p i s t e m u m s , läuft parallel zum
Tergalarm und ist mit dessen Hinterkante durch eine Membran verbunden. Der Dorsalrand legt
sich eng an die Ventralkante des hinteren Fortsatzes des Tergalarms und stützt diesen und mit ihm
die Sehnenkappe SK. Mit der ventralen Fläche des Flügels ist er durch ein Ligament (Text-Abb. 7 H)
verbunden. Der Hinterrand ist durch einen schmalen membranösen Spalt vom P o s t e p i s t e r n
u m getrennt, das nur eine schmale zungenförmige Fläche vor der Pleuralleiste bildet.
Die Herausgliederung des Praeepistemums aus dem ursprünglich zweifellos einheitlichen Episternum
hängt mit dem Bedürfnis zusammen, für die sehr kräftigen episternal-sternalen direkten
Flugmuskeln Ansatzflächen zu schaffen, die von der unbeweglichen Pleuralleiste unabhängig sind.
Der Spalt, der das Praeepisternum vom Postepisternum trennt, macht ersteres beweglich, nach innen
einklappbar (soweit die Verbindungsmembranen zwischen Tergalarm und Praeepisternum bezw.
zwischen Praeepisternum und Postepisternum gestatten), ohne daß durch dies Einklappen die Pleuralleiste
und mit ihr der pleurale Flügelgelenkkopf erschüttert würde. Ein fester Flügelgelenkkopf ist
aber, wie sich weiter unten zeigen wird, unter anderem auch Voraussetzung für die Übertragung
der Bewegungen des Praeepistemums auf den Flügel.
Funktionell entspricht, wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, das Praeepisternum den episternalen
Flügelgelenkplatten (basalare, episternal epipleurite S n o d g r a s s 1927 b), die wir bei zahlreichen
anderen Insekten finden und die bei Aphis fehlen; es ist, wenn man nicht einen Rest von ihnen in
dem Pleuralbogenstück erblicken will (s. p. 65), sehr wohl möglich, daß sie hier im Praeepisternum
aufgegangen sind und daß die ursprünglich nur an ihnen angreifenden Muskeln ihre Ansatzstellen
weiter nach unten auf das Praeepisternum ausgedehnt haben. Ansätze zu solcher Entwicklung finden
wir bei vielen, sogar bei zweifellos primitiven Pterygoten. Es ist noch nicht einmal sicher, ob die
Episternalgelenkplatten überhaupt ursprünglich völlig vom Episternum getrennt waren und ob
nicht in den Fällen, wo eine solche Trennung oder sogar eine regelrechte Gelenkbüdung zwischen
Episternum und „Praeparapterum“ ( Snod gr a s s 1909) sich findet, diese sekundär ist. In meinem
„Grundschema des Pterygotenthorax“ habe ich (p. 71) diese Möglichkeit schon angedeutet. Für sie
spricht die Tatsache, daß z. B. bei den Plecopteren (s. Text-Abb. 9 a) wohl eine Episternalgelenkplatte
(EpsG), am Dorsalrand des Episternums herausgegliedert ist, daß aber diese Platte mit dem Rand
verwachsen, nicht gelenkig verbunden ist. Von Interesse ist dabei, daß vom Hinterrand der Gelenkplatte
eine Naht eine Strecke weit senkrecht nach unten geht und das Eps spaltet, ganz ähnlich wie
das bei Aphis der Fall ist. Ohne daß ich diese Naht mit dem bei Aphis bestehenden Spalt bestimmt
homolögisieren möchte, betrachte ich sie doch jedenfalls als Hinweis darauf, daß eine Tendenz zur
Abgliederung eines dorsalen vorderen Bereichs des Episternums im obigen Zusammenhang im Be