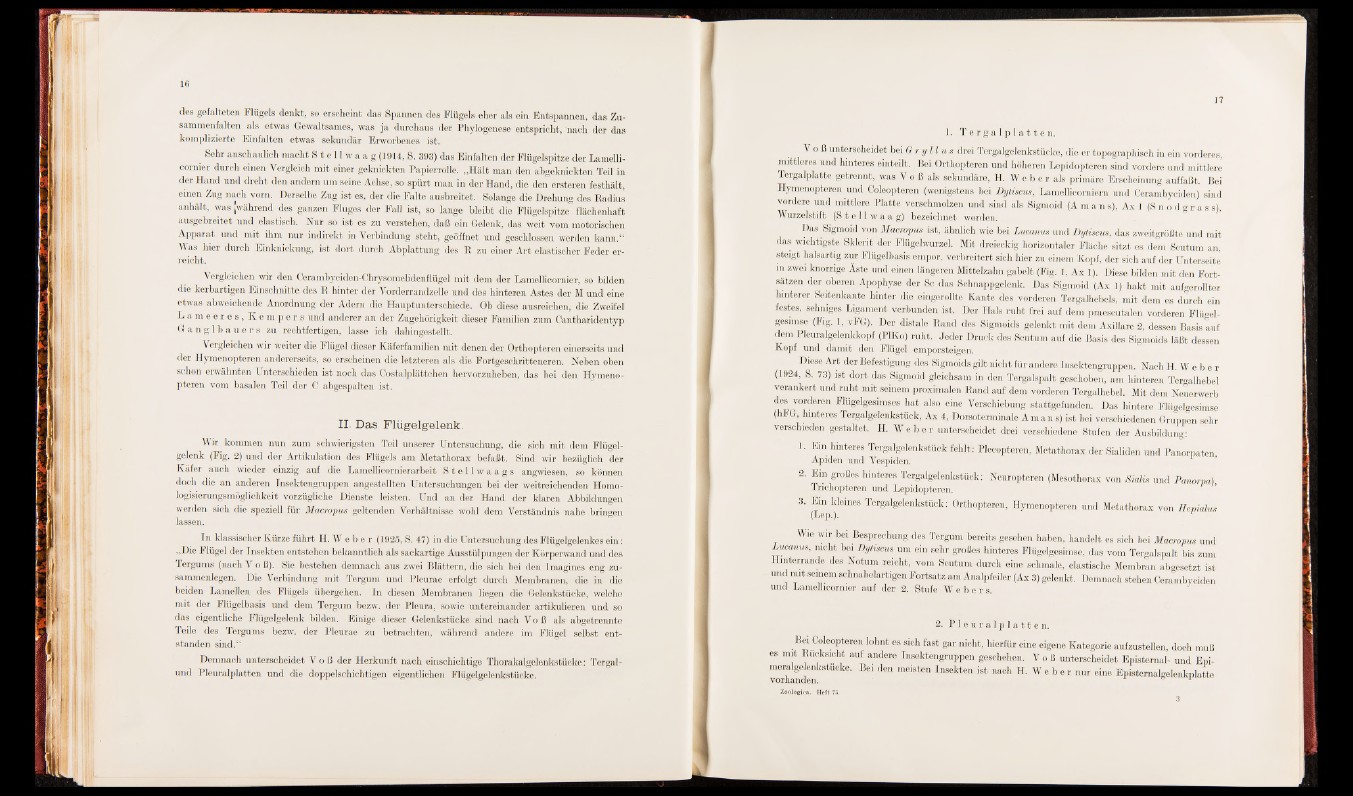
des gefalteten Flügels denkt, so erscheint das Spannen des Flügels eher als ein Entspannen, das Zusammenfalten
als etwas Gewaltsames, was ja durchaus der Phylogenese entspricht, nach der das
komplizierte Einfalten etwas sekundär Erworbenes ist.
_ Sehr anschaulich macht S t e 11 w a a g (1914, S. 393) das Einfalten der Flügelspitze der Lamelli-
cornier durch einen Vergleich mit einer geknickten Papierrolle. „Hält man den abgeknickten Teil in
der Hand und dreht den ändern um seine Achse, so spürt man in der Hand, die den ersteren festhält,
einen Zug nach vorn. Derselbe Zug ist es, der die Falte ausbreitet. Solange die Drehung des Kadius
anhält, was jwährend des ganzen Fluges der Fall ist, so lange bleibt die Flügelspitze flächenhaft
ausgebreitet und elastisch. Nur so ist es zu verstehen, daß ein Gelenk, das weit vom motorischen
Apparat und mit ihm nur indirekt in Verbindung steht, geöffnet und geschlossen werden kann.“
Was hier durch Einknickung, ist dort durch Abplattung des R zu einer Art elä'stischer Feder er-
reicht.
Vergleichen wir den Cerambyciden-Chrysomelidenflügel mit dem der Lamellicornier, so bilden
die kerbartigen Einschnitte des E hinter der Vorderrandzelle und des hinteren Astes der M und eine
etwas abweichende Anordnung der Adern die Hauptunterschiede. Ob diese ausreichen, die Zweifel
L a m e e r e s , K e m p e r s und anderer an der Zugehörigkeit dieser Familien zum Cantharidentyp
G a n g l b a u e r s zu rechtfertigen, lasse ich dahingestellt.
Vergleichen wir weiter die Flügel dieser Käferfamilien mit denen der Orthopteren einerseits und
der Hymenopteren andererseits, so erscheinen die letzteren als die Fortgeschritteneren. Neben oben
schon erwähnten Unterschieden ist noch das Costalplättchen hervorzuheben, das bei den Hymenopteren
vom basalen Teil der C abgespalten ist.
II . D a s F lü g e lg e le n k .
Wir kommen nun zum schwierigsten Teil unserer Untersuchung, die sich mit dem Flügelgelenk
(Fig. 2) und der Artikulation des Flügels am Metathorax befaßt. Sind wir bezüglich der
Käfer auch wieder einzig auf die Lamellicornierarbeit S t e l l w a a g s angwiesen, so können
doch die an anderen Insektengruppen angestellten Untersuchungen bei der weitreichenden Homologisierungsmöglichkeit
vorzügliche Dienste leisten. Und an der Hand der klaren Abbildungen
werden sich die speziell für Macropus geltenden Verhältnisse wohl dem Verständnis nahe bringen
lassen.
In klassischer Kürze führt H. W e b e r (1925, S. 47) in die Untersuchung des Flügelgelenkes ein:
„Die Flügel der Insekten entstehen bekanntlich als sackartige Ausstülpungen der Körper wand und des
Tergums (nach V o ß). Sie bestehen demnach aus zwei Blättern, die sich bei den Imagines eng Z u sammenlegen.
Die Verbindung mit Tergum und Pleurae erfolgt durch Membranen, die in die
beiden Lamellen des Flügels übergehen. In diesen Membranen liegen die Gelenkstücke, welche
mit der Flügelbasis und dem Tergum bezw. der Pleura, sowie untereinander artikulieren und so
das eigentliche Flügelgelenk bilden. Einige dieser Gelenkstücke sind nach V o ß als abgetrennte
Teile des Tergums bezw. der Pleurae zu betrachten, während andere im Flügel selbst entstanden
sind.“
Demnach unterscheidet V o ß der Herkunft nach einschichtige Thorakalgelenkstücke: Tergal-
und Pleuralplatten und die doppelschichtigen eigentlichen Flügelgelenkstücke.
1. T e r g a l p l a t t e n .
V o ß unterscheidet bei G r y l l u s drei Tergalgelenkstücke, die er topographisch in ein vorderes,
mittleres und hinteres einteilt. Bei Orthopteren und höheren Lepidopteren sind vordere und mittlere
Tergalplatte getrennt, was V o ß als sekundäre, H. W e b e r als primäre Erscheinung auffaßt. Bei
Hymenopteren und Coleopteren (wenigstens bei Dytiseus, Lamellicorniem und Cerambyeiden) sind
vordere und mittlere Platte verschmolzen und sind als Sigmoid (Amans ) , Ax X ( S n o d g r a s s )
Wurzelstift ( S t e l l w a a g ) bezeichnet worden.
Das Sigmoid von Macropus ist, ähnlich wie bei Lucams und Dytiseus, das zweitgrößte und mit
das wichtigste Sklent der Flügelwurzel. Mit dreieckig horizontaler Fläche sitzt es dem Scutum an,
steigt halsartig zur Flügelbasis empor, verbreitert sich hier zu einem Kopf, der sich auf der Unterseite
in zwei knorrige Aste und einen längeren Mittelzahn gabelt (Fig. 1, Ax 1). Diese bilden mit den Fortsätzen
der oberen Apophyse der Sc das Schnappgelenk. Das Sigmoid (Ax 1) hakt mit aufgerollter
hinterer Seitenkante hinter die eingerollte Kante des vorderen Tergalhebels, mit dem es durch ein
festes, sehniges Ligament verbunden ist. Der Hals ruht frei auf dem praescutalen vorderen Flügelgesimse
(Fig. 1, vFG);., Der distale Rand des Sigmoids gelenkt mit dem Axillare 2, dessen Basis auf
dem Ptouralgelenkkopf (PIKo) ruht. Jeder Druck des Scutum auf die Basis des Sigmoids läßt dessen
Kopf und damit den Flügel emporsteigen.
Diese Art der Befestigung des Sigmoids gilt nicht für andere Insektengruppen. Nach H .We b e r
(1924, S. 73) ist dort das Sigmoid gleichsam in den Tergalspalt geschoben, am hinteren Tergalhebel
verankert und ruht mit seinem proximalen Rand auf dem vorderen Tergalhebel. Mit dem Neuerwerb
des vorderen Flügelgesimses hat also eine Verschiebung stattgefunden. Das hintere Flügelgesimse
(hFG, hinteres Tergalgelenkstüek, Ax 4, Dorsoterminale Amans ) ist bei verschiedenen Gruppen sehr
verschieden gestaltet. H. W e b e r unterscheidet drei verschiedene Stufen der Ausbildung:
1. Ein hinteres Tergalgelenkstüek fehlt: Plecopteren, Metathorax der Sialiden und Panorpaten
Apiden und Vespiden.
2. Ein großes hinteres Tergalgelenkstüek: Neuropteren (Mesothorax von Sialis und Panorpa)
Tnchopteren und Lepidopteren.
3. Ein kleines Tergalgelenkstüek: Orthopteren, Hymenopteren und Metathorax von Hepialm
v;1,! ,
Wie wir bei Besprechung des Tergum bereits gesehen haben, handelt es sich bei Macropus und
Lucanus, nicht bei Dytucus um ein sehr großes hinteres Flügelgesimse, das vom Tergalspalt bis zum
Hinterrande des Notum reicht, vom Scutum durch eine schmale, elastische Membran abgesetzt ist
und mit seinem schnabelartigen Fortsatz am Analpfeiler (Ax 3) gelenkt. Demnach stehen Cerambyeiden
und Lamellicornier auf der 2. Stufe We b e r s .
2. P l e u r a l p l a t t e n .
• Bü .C°leoPteren B | es sicl1 fast g“ “ Olt, hierfür eine eigene Kategorie aufzustellen, doch muß
es mit Rücksicht auf andere Insektengruppen geschehen. V o ß unterscheidet Episternal- und Epi-
meralgelenkstucke. Bei den meisten Insekten ist nach H. W e b e r nur eine Episternalgelenkplatte
vorhanden. ° 1
Zoologica. Heft 7f