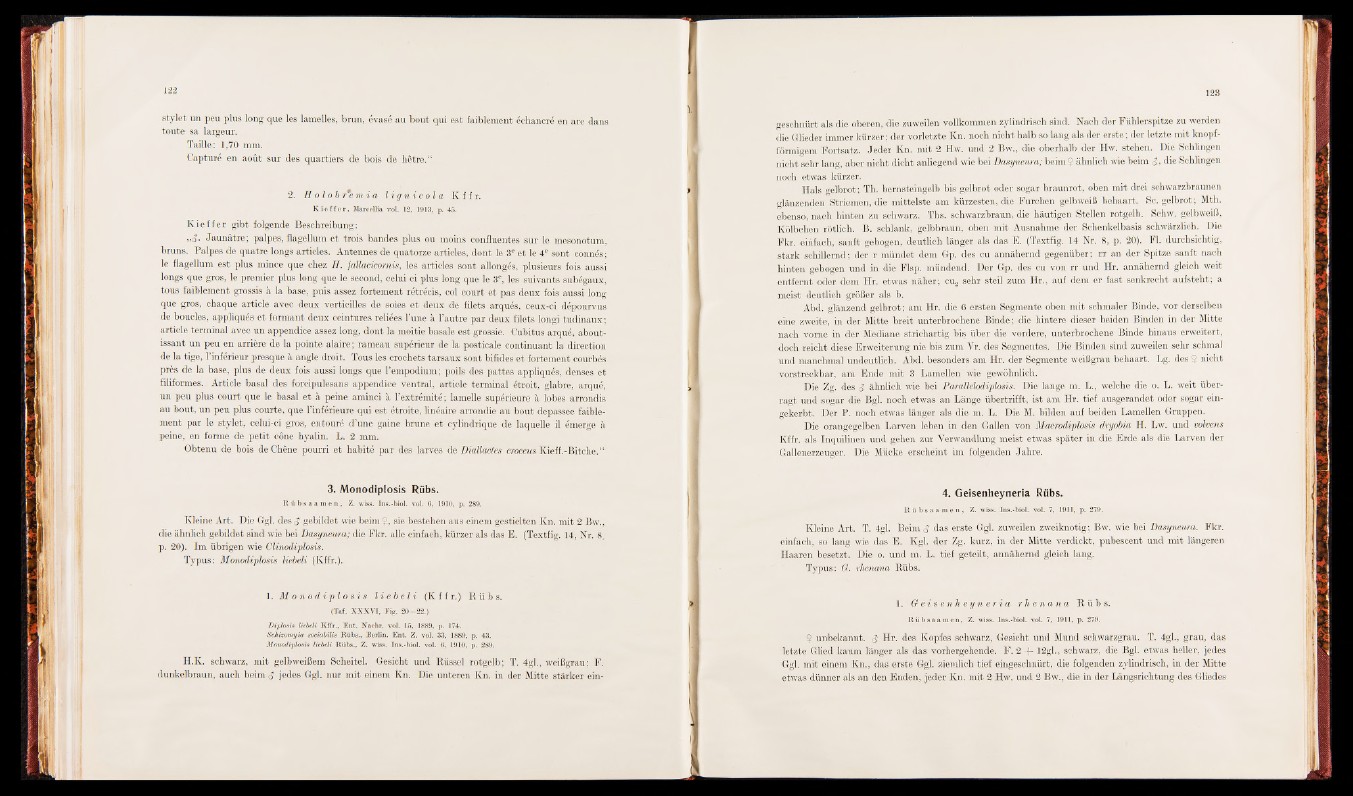
stylet un peu plus long que les lamelles, brun, évasé au bout qui est faiblement écbancré en arc dans
toute sa largeur.
Taille: 1,70 mm.
Capturé en août sur des quartiers de bois de hêtre.“
2. H o l o b r e m i a l i g n i c o l a Kf f r .
Ki e f f e r , Marcellia vol. 12, 1913, p. 45.
Ki ef f e r gibt folgende Beschreibung:
,,d- Jaunâtre; palpes, flagellum et trois bandes plus ou moins confluentes sur le mesonotum,
bruns. Palpes de quatre longs articles. Antennes de quatorze articles, dont le 3e et le 4e sont connés;
le flagellum est plus mince que chez H. fallacicornis, les articles sont allongés, plusieurs fois aussi
longs que gros, le premier plus long que le second, celui ci plus long que le 3e, les suivants subégaux,
tous faiblement grossis à la base, puis assez fortement rétrécis, col court et pas deux fois aussi long-
que gros, chaque article avec deux verticilles de soies et deux de filets arqués, ceux-ci dépourvus
de boucles, appliqués et formant deux ceintures reliées l’une à l’autre par deux filets longi tudinaux;
article terminal avec un appendice assez long, dont la moitié basale est grossie. Cubitus arqué, aboutissant
un peu en arrière de la pointe alaire; rameau supérieur de la posticale continuant la direction
de la tige, l’inférieur presque à angle droit. Tous les crochets tarsaux sont bifides et fortement .courbés
près de la base, plus de deux fois aussi longs que l’empodium; poils des pattes appliqués, denses et
filiformes. Article basai des forcipulesans appendice ventral, article terminal étroit, glabre, arqué,
un peu plus court que le basai et à peine aminci à l’extrémité; lamelle supérieure à lobes arrondis
au bout, un peu plus courte, que l’inférieure qui est étroite, linéaire arrondie au bout depassee faiblement
par le stylet, celui-ci gros, entouré d’une gaine brune et cylindrique de laquelle il émerge à
peine, en forme de petit cône hyalin. L. 2 mm.
Obtenu de bois de Chêne pourri et habité par des larves de Diallactes croceus Kieff.-Bitche.“
3. Monodiplosis Rübs.
R ü b s a a m e n , Z. wiss. Ins.-biol. vol. 6, 1910, p. 289.
Kleine Art. Die Ggl. des d gebildet wie beim ?, sie bestehen aus einem gestielten Kn. mit 2 Bw.,
die ähnlich gebildet sind wie bei Dasyneura; die Fkr. alle einfach, kürzer als das E. (Textfig. 14, Nr. 8,
p. 20). Im übrigen wie Clinodiplosis.
Typus: Monodiplosis liebeli (Kffr.).
1. M o n o d i p l os i s l i e b e l i (Kf f r . ) Rü b s .
(Taf. XXXVI, Fig. 20-22.)
Diplosis liebeli Kffr., Ent. Nachr. vol. 15, 1889, p. 174.
Schizomyia sociabilis Rübs., Berlin. Ent. Z. vol. 33, 1889, p. 43.
Monodiplosis liebeli Rübs., Z. wiss. Ins.-biol. vol. 6, 1910, p. 289.
H.K. schwarz, mit gelbweißem Scheitel. Gesicht und Rüssel rotgelb; T. 4gl., weißgrau; F.
dunkelbraun, auch beim <2 jedes Ggl. nur mit einem Kn. Die unteren Kn. in der Mitte stärker eingeschnürt
als die oberen, die zuweilen vollkommen zylindrisch sind. Nach der Fühlerspitze zu werden
die Glieder immer kürzer; der vorletzte Kn. noch nicht halb so lang als der erste; der letzte mit knopfförmigem
Fortsatz. Jeder Kn. mit 2 Hw. und 2 Bw., die oberhalb der Hw. stehen. Die Schlingen
nicht sehr lang, aber nicht dicht anliegend wie bei Dasyneura; beim $ ähnlich wie beim d, die Schlingen
noch etwas kürzer.
Hals gelbrot; Th. bernsteingelb bis gelbrot oder sogar braunrot, oben mit drei schwarzbraunen
glänzenden Striemen, die mittelste am kürzesten, die Furchen gelbweiß behaart. Sc. gelbrot; Mth.
ebenso, nach hinten zu schwarz. Ths. schwarzbraun, die häutigen Stellen rotgelb. Schw. gelbweiß,
Kölbchen rötlich. B. schlank, gelbbraun, oben mit Ausnahme der Schenkelbasis schwärzlich. Die
Fkr. einfach, sanft gebogen, deutlich länger als das E. (Textfig. 14 Nr. 8, p. 20). Fl. durchsichtig,
stark schillernd; der r mündet dem Gp. des cu annähernd gegenüber; rr an der Spitze sanft nach
hinten gebogen und in die Flsp. mündend. Der Gp. des cu von rr und Hr. annähernd gleich weit
entfernt oder dem Hr. etwas näher; cu2 sehr steil zum Hr., auf dem er fast senkrecht aufsteht; a
meist deutlich größer als b.
Abd. glänzend gelbrot; am Hr. die 6 ersten Segmente oben mit schmaler Binde, vor derselben
eine zweite, in der Mitte breit unterbrochene Binde; die hintere dieser beiden Binden in der Mitte
nach vorne in der Mediane strichartig bis über die vordere, unterbrochene Binde hinaus erweitert,
doch reicht diese Erweiterung nie bis zum Vr. des Segmentes. Die Binden sind zuweilen sehr schmal
und manchmal undeutlich. Abd. besonders am Hr. der Segmente weißgrau behaart. Lg. des $ nicht
vorstreckbar, am Ende mit 3 Lamellen wie gewöhnlich.
Die Zg. des d ähnlich wie bei Parallelodiplosis. Die lange m. L., welche die o. L. weit überragt
und sogar die Bgl. noch etwas an Länge übertrifft, ist am Hr. tief ausgerandet oder sogar eingekerbt.
Der P. noch etwas länger als die m. L. Die M. bilden auf beiden Lamellen Gruppen.
Die orangegelben Larven leben in den Gallen von Macrodiplosis dryobia H. Lw. und volvens
Kffr, als Inquilinen und gehen zur Verwandlung meist etwas später in die Erde als die Larven der
Gallenerzeuger. Die Mücke erscheint im folgenden Jahre.
4. Geisenheyneria Rübs.
R ü b s a a m e n , Z. wiss. Ins.-biol. vol. 7, 1911, p. 279.
Kleine Art. T. 4gl. Beim d das erste Ggl. zuweilen zweiknotig; Bw. wie bei Dasyneura. Fkr.
einfach, so lang wie das E. Kgl. der Zg. kurz, in der Mitte verdickt, pubescent und mit längeren
Haaren besetzt. Die o. und m. L. tief geteilt, annähernd gleich lang.
Typus: G. rhenana Rübs.
1. G e i s e n h e y n e r i a r h e n a n a Rü b s .
Rü b s a ame n , Z. wiss. Ins.-biol. vol. 7, 1911, p. 279.
$ unbekannt, d Hr. des Kopfes schwarz, Gesicht und Mund schwarzgrau. T. 4gl., grau, das
letzte Glied kaum länger als das vorhergehende. F. 2 %12gl., schwarz, die Bgl. etwas heller, jedes
Ggl. mit einem Kn., das erste Ggl. ziemlich tief eingeschnürt, die folgenden zylindrisch, in der Mitte
etwas dünner als an den Enden, jeder Kn. mit 2 Hw. und 2 Bw., die in der Längsrichtung des Gliedes