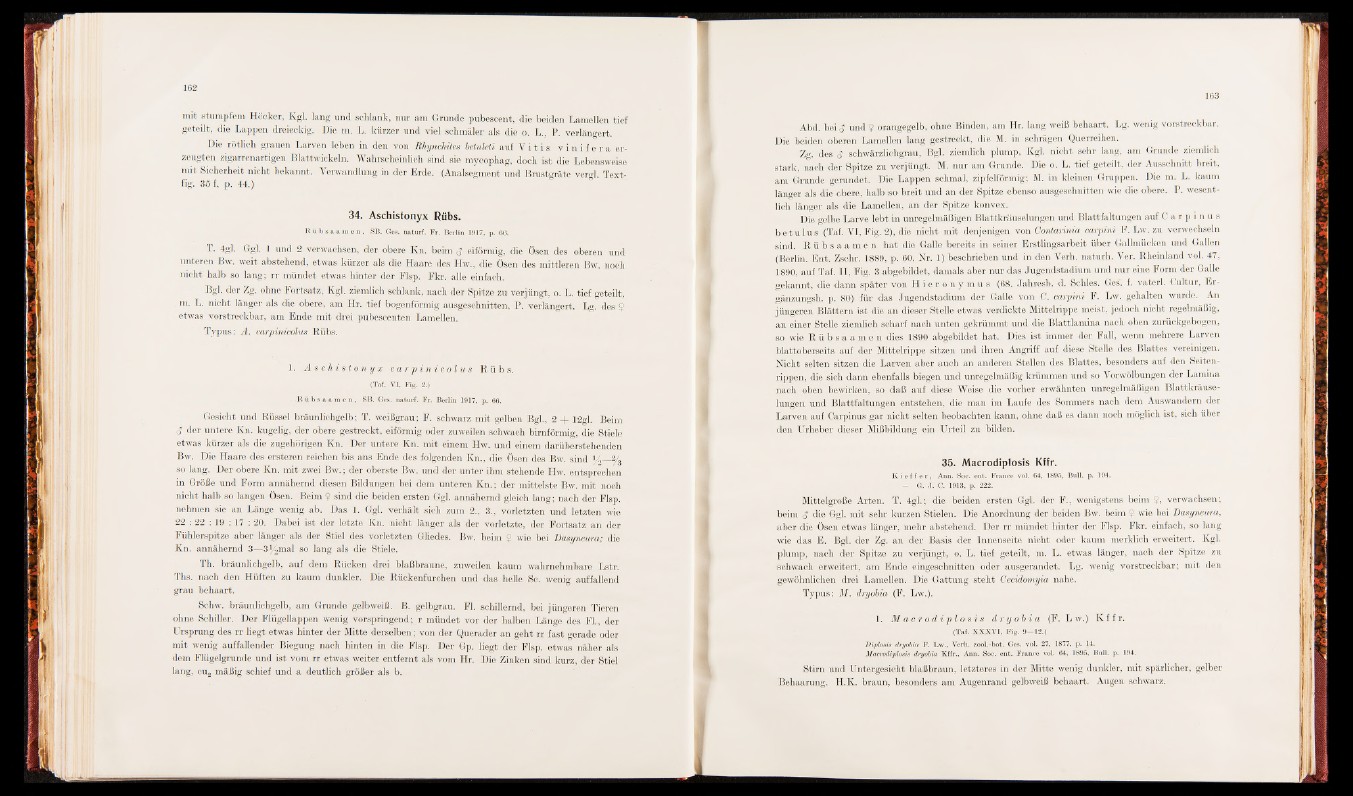
mit stumpfem Höcker, Kgl, lang und schlank, nur am Grunde pubescent, die beiden Lamellen tief
geteilt, die Lappen dreieckig. Die m. L. kürzer und viel schmäler als die.ife L., P. verlängert.
Die rötlich grauen Larven leben in den von Rhynchites betuleti auf V i t i s v i n i f e r a erzeugten
zigarrenartigen Blattwickeln. Wahrscheinlich sind sie mycophag, doch ist die Lebensweise
mit Sicherheit nicht bekannt. Verwandlung in der Krde. (Analscgmenl und Brustgräte vergl. Text-
% 35 f, p. 44.)
34. Aschistonyx Rübs.
R ü b s a a m e n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 66.
T. 4gl. Ggl. 1 und 2 verwachsen, der obere Kn. beim <$ eiförmig, die Ösen des oberen und
unteren Bw. weit abstehend, etwas kürzer als die Haare des Hw., die Ösen des mittleren Bw. noch
nicht halb so lang; rr mündet etwas hinter der Flsp. Fkr. alle einfach.
Bgl. der Zg. ohne Fortsatz, Kgl. ziemlich schlank, nach der Spitze zu verjüngt, o. L. tief geteilt,
m. L. nicht länger als die obere, am Hr. tief bogenförmig ausgeschnitten, P. verlängert. Lg. des $
etwas vorstreckbar, am Ende mit drei pubescenten Lamellen.
Typus: A. carpinicolus Bübs.
1. A s c h i s t o n y x c a r p i n i c o l u s Bü b s .
(Taf. VI, Fig. 2.)
,R ü b s a a m e n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 66.
Gesicht und Büssel bräunlichgelb; T. weißgrau; F. schwarz mit gelben Bgl., 2 + 12gl. Beim
<? der untere Kn. kugelig, der obere gestreckt, eiförmig oder zuweilen schwach bimförmig, die Stiele
etwas kürzer als die zugehörigen Kn. Der untere Kn. mit einem Hw. und einem darüberstehenden
Bw. Die Haare des ersteren reichen bis ans Ende des folgenden Kn., die Ösen des Bw. sind % %
so lang. Der obere Kn. mit zwei Bw.; der oberste Bw. und der unter ihm stehende Hw. entsprechen
in Größe und Form annähernd diesen Bildungen bei dem unteren Kn.; der mittelste Bw. mit noch
nicht halb so langen Ösen. Beim $ sind die beiden ersten Ggl. annähernd gleich lang; naGh der Flsp.
nehmen sie an Länge wenig ab. Das 1. Ggl. verhält sich zum 2., 3., vorletzten und letzten wie
22 : 22 : 19 : 17 : 20. Dabei ist der letzte Kn. nicht länger als der vorletzte, der Fortsatz an der
Fühlerspitze aber länger als der Stiel des vorletzten Gliedes. Bw. beim ? wie bei Dasyneura; die
Kn. annähernd 3—zy^mal so lang als die Stiele.
Th. bräunlichgelb, auf dem Bücken drei blaßbraune, zuweilen kaum wahrnehmbare Lstr.
Ths. nach den Hüften zu kaum dunkler. Die Bückenfurchen und das helle Sc. wenig auffallend
grau behaart.
Schw. bräunlichgelb, am Grunde gelbweiß. B. gelbgrau. Fl. schillernd, bei jüngeren Tieren
ohne Schiller. Der Flügellappen wenig vorspringend; r mündet vor der halben Länge des Fl., der
Ursprung des rr liegt etwas hinter der Mitte derselben; von der Querader an geht rr fast gerade oder
mit wenig auffaUender Biegung nach hinten in die Flsp. Der Gp. liegt der Flsp. etwas näher als
dem Flügelgrunde und ist vom rr etwas weiter entfernt als vom Hr. Die Zinken sind kurz, der Stiel
lang, cu2 mäßig schief und a deutlich größer als b.
Abd. bei $ und $ orangegelb, ohne Binden, am Hr. lang weiß behaart. Lg. wenig vorstreckbar.
Die beiden oberen Lamellen lang gestreckt, die M. in schrägen QueTreihen.
Zg. des A schwärzlichgrau, Bgl. ziemlich plump, Kgl. nicht sehr lang, am Grunde ziemlich
stark, nach der Spitze zu verjüngt. M. nur am Grunde. Die o. L. tief geteilt, der Ausschnitt breit,
am Grunde gerundet. Die Lappen schmal, zipfelförmig; M. in kleinen Gruppen. Die m. L. kaum
länger als die obere, halb so breit und an der Spitze ebenso ausgeschnitten wie die obere. P . wesentlich
länger als die Lamellen, an der Spitze konvex.
Die gelbe Larve lebt in unregelmäßigen Blattkräuselungen und Blattfaltungen auf C a r p i n u s
b e t u l u s (Taf. VI, Fig. 2), die nicht mit denjenigen von Contarinia carpini F. Lw. zu verwechseln
sind. B ü b s a a m e n hat die Galle bereits in seiner Erstlingsarbeit über Gallmücken und Gallen
(Berlin. Ent. Zschr. 1889, p. 60, Nr. 1) beschrieben und in den Verh. naturh. Ver. Bheinland vol. 47,
1890, auf Taf. II, Fig. 3 abgebildet, damals aber nur das Jugendstadium und nur eine Form der Galle
gekannt, die dann später von H i e r o n y m u s (68. Jahresb. d. Schles. Ges', f. vaterl. Cultur, Er-
gänzungsh. p. 80) für das Jugendstadium der Galle von C. carpini F. Lw. gehalten wurde. An
jüngeren Blättern ist die an dieser Stelle etwas verdickte Mittelrippe meist, jedoch nicht regelmäßig,
an einer Stelle ziemlich scharf nach unten gekrümmt und die Blattlamina nach oben zurückgebogen,
so wie B ü b s a a m e n dies 1890 abgebildet hat. Dies ist immer der Fall, wenn mehrere Larven
blattoberseits auf der Mittelrippe sitzen und ihren Angriff auf diese Stelle des Blattes vereinigen.
Nicht selten sitzen die Larven aber auch an anderen Stellen des Blattes, besonders auf den Seitenrippen,
die sich dann ebenfalls biegen und unregelmäßig krümmen und so Vorwölbungen der Lamina
nach oben bewirken, so daß auf diese Weise die vorher erwähnten umegelmäßigen Blattkräuselungen
und Blattfaltungen entstehen, die man im Laufe des Sommers nach dem Auswandern der
Larven auf Carpinus gar nicht selten beobachten kann, ohne daß es dann noch möglich ist, sich über
den Urheber dieser Mißbildung ein Urteil zu bilden.
35. Macrodiplosis Kffr.
K i e f f e r , Ann. Soc. ent. France vol. 64, 1895, Bull. p. 194.
— G. J. C. 1913, p. 222.
Mittelgroße Arten. T. 4gl.; die beiden ersten Ggl. der F., wenigstens beim ?, verwachsen;
beim d1 die Ggl. mit sehr kurzen Stielen. Die Anordnung der beiden Bw. beim ? wie bei Dasyneura,
aber die Ösen etwas länger, mehr abstehend. Der rr mündet hinter der Flsp. Fkr. einfach, so lang
wie das E. Bgl. der Zg. an der Basis der Innenseite nicht oder kaum merklich erweitert. Kgl.
plump, nach der Spitze zu verjüngt, o. L. tief geteilt, m. L. etwas länger, nach der Spitze zu
schwach erweitert, am Ende eingeschnitten oder ausgerandet. Lg. wenig vorstreckbar; mit den
gewöhnlichen drei Lamellen. Die Gattung steht Cecidomyia nahe.
Typus: M. dryobia (F. Lw.).
1. M a c r o d i p l o s i s d r y o b i a (F. Lw.) Kf f r .
(Taf. XXXVI, Fig. 9 -12.)
Diplosis dryobia F. Lw., Verli. zool.-bot. Ges. vol. 27, 1877, p. 14.
Macrodiplosis dryobia Kffr., Ahn. Soc. ent. France vol. 64, 1895, Bull. p. 194.
Stirn und Untergesicht blaßbraun, letzteres in der Mitte wenig dunkler, mit spärlicher, gelber
Behaarung. H.K. braun, besonders am Augenrand gelbweiß behaart. Augen schwarz.