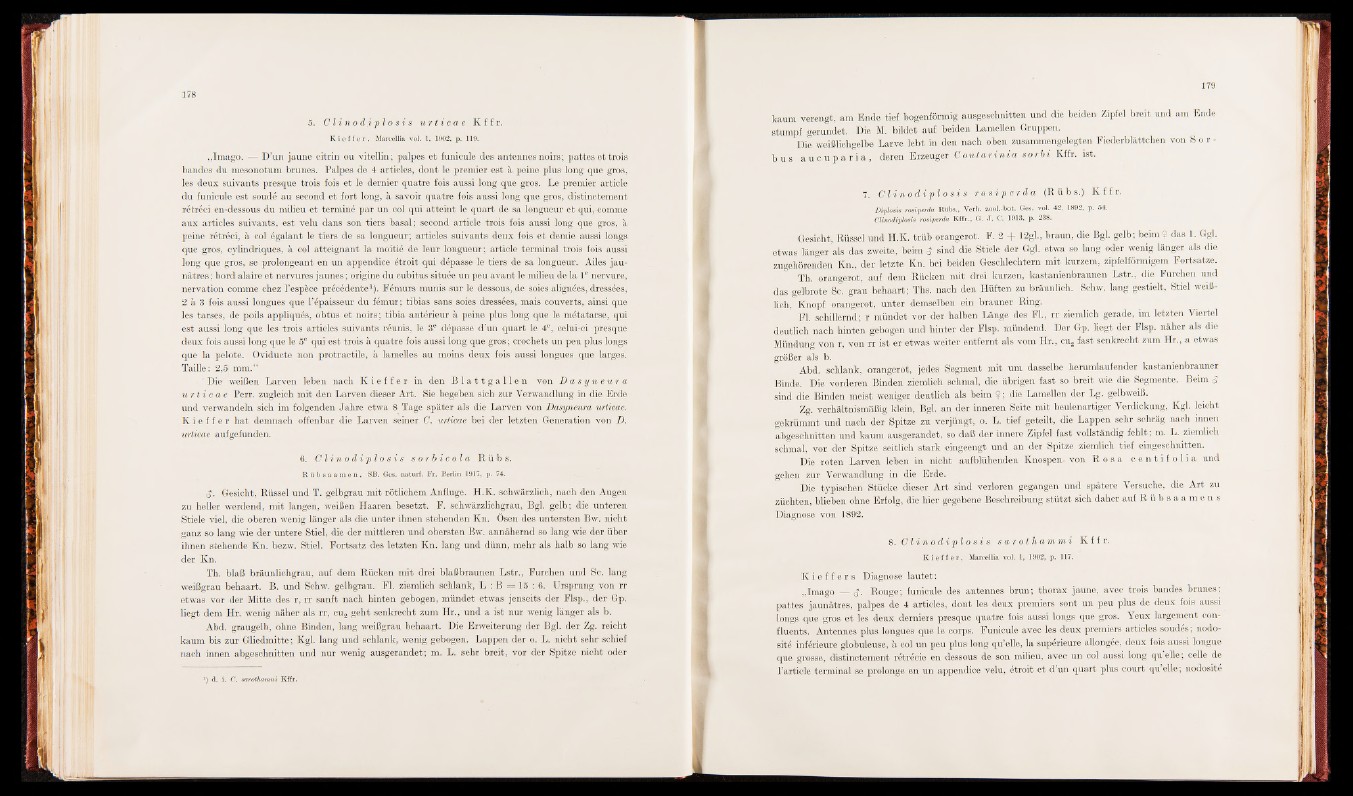
5. C l i n o d i p l o s i s u r t i c a e Kf f r .
Ki e f f e r , Marccllia vol. 1, 1902, p. 119.
„Imago. — D’un jaune citrin ou vitellin; palpes et funicule des antennes noirs ; patbes et trois
bandes du mesonotum brunes. Palpes de 4 articles, dont le premier est à peine plus long que gros,
les deux suivants presque trois fois et le dernier quatre fois aussi long que gros. Le premier article
du funicule est soudé au second et fort long, à savoir quatre fois aussi long que gros, distinctement
rétréci en-dessous du milieu et terminé par un col qui atteint le quart de sa longueur et qui, comme
aux articles suivants, est velu dans son tiers basai; second article trois fois aussi long que gros, à
peine rétréci, à col égalant le tiers de sa longueur; articles suivants deux fois et demie aussi longs
que gros, cylindriques, à col atteignant la moitié de leur longueur; article terminal trois fois aussi
long que gros, se prolongeant en un appendice étroit qui dépasse le tiers de sa longueur. Ailes jaunâtres;
bord alaire et nervures jaunes; origine du cubitus située un peu avant le milieu de la Ie nervure,
nervation comme chez l’espèce précédente1). Fémurs munis sur le dessous, de soies alignées, dressées,
2 à 3 fois aussi longues que l’épaisseur du fémur; tibias sans soies dressées, mais couverts, ainsi que
les tarses, de poils appliqués, obtus et noirs; tibia antérieur à peine plus long que le métatarse, qui
est aussi long que les trois articles suivants réunis, le 3e dépasse d’un quart le 4e, celui-ci presque
deux fois aussi long que le 5e qui est trois à quatre fois aussi long que gros ; crochets un peu plus longs
que la pelote. Oviducte non protractile, à lamelles au moins deux fois aussi longues que larges.
Taille: 2,5 mm.“
' Die weißen Larven leben nach K i e f f e r in den B l a t t g a l l e n von D a s y n e u r a
u r t i c a e Perr. zugleich mit den Larven dieser Art. Sie begeben sich zur Verwandlung in die Erde
und verwandeln sich im folgenden Jahre etwa 8 Tage später als die Larven von Dasyneura urticae.
K i e f f e r h a t demnach offenbar die Larven seiner C. urticae bei der letzten Generation von D.
urticae aufgefunden.
6. C U n o d i p l o s i s s o r b i c o l a Rü b s .
E i i b s a ame n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 74.
c£. Gesicht, Rüssel und T. gelbgrau mit rötlichem Anfluge. H.K. schwärzlich, nach den Augen
zu heller werdend, mit langen, weißen Haaren besetzt. F. schwärzlichgrau, Bgl. gelb; die unteren
Stiele viel, die oberen wenig länger als die unter ihnen stehenden Kn. Ösen des untersten Bw. nicht
ganz so lang wie der untere Stiel, die der mittleren und obersten Bw. annähernd so lang wie der über
ihnen stehende Kn. bezw. Stiel. Fortsatz des letzten Kn. lang und dünn, mehr als halb so lang wie
der Kn.
Th. blaß bräunlichgrau, auf dem Rücken mit drei blaßbraunen Lstr., Furchen und Sc. laug
weißgrau behaart. B. und Schw. gelbgrau. Fl. ziemlich schlank, L : B|f§ 15 : 6. Ursprung von rr
etwas vor der Mitte des r, rr sanft nach hinten gebogen, mündet etwas jenseits der Flsp., der Gp.
liegt dem Hr. wenig näher als rr, cu2 geht senkrecht zum Hr., und a ist nur wenig länger als b.
Abd. graugelb, ohne Binden, lang weißgrau behaart. Die Erweiterung der Bgl. der Zg. reicht
kaum bis zur Gliedmitte; Kgl. lang und schlank, wenig gebogen. Lappen der o. L. nicht sehr schief
nach innen abgeschnitten und nur wenig ausgerandet; m. L. sehr breit, vor der Spitze nicht oder
') d. i. C. sarothamni Kffr.
kaum verengt awi-Ende tief bogenförmig ausgeschnitten und die beiden Zipfel breit und am Ende
stumpf gerundet. Die M. bildet auf beiden Lamellen Gruppen.
Die vcißiichge'.be Larve lebt in den nach oben zusammengelegten Fiederblättehen von S o r -
brjjfp a u c u p a r i a , deren Erzeuger (ïÿ.ftt a r i n i a s'-Qr b i Kffr. ist.
7 . C l i ti o d ijt lo s .t s r o 11 •/» c r d a {11 ü-b s::) Kf f r .
Dvplosis rosiperda Rübs., Verh. zool.-böt. Ges. vol. 42, 1892, p. 54.
Clinodiplosis rosiperda Kffr., G. J . C. 1913, p. 238.
Gesicht, Rüssel und H.K. trüb orangerot. F. 2 + 12gl., braun, die Bgl. gelb ; beim $ dag 1. Ggl.
etwas langer a i das zweite, beim<J sind die Stiele der Ggl. etwa so lang oder wenig länger als die
zugèhôrendén Kn., der letzte Kn. bei beiden Ueseiilwmtern mit kurzem, zipfelförmigem Fortsatze.
Th. prangerot, Rücken mit drei kurzen, kastanienbraunen Lstr., die Furchen und
das gelbrote Sc.. grau beh a a itr Ths. nach den Hüften zu bräunlich. Schw. lang gestielt, Stiel weißlich,
Knopf orangerot, unter demselben ein brauner Ring.
Fl. schillernd; r mündet vor der halben Länge des Fl., rr ziemlich gerade, im letzten Viertel
deutlich nach h i^H g e b o g e n und hinter d ||F ls p . mündend. Ä r Gp. liegt der Flsp. näher als die
Mündung v fn r, vbn rr ist er etwas weiter entfernt als vom Hr , cu^ölft senkrecht zum Hr., a etwas
größer als b.
Abd. schlank,, orangerot-, jedes. Segment mit um dasselbe herumlaufender kastanienbrauner
Binde. Die vorderen Binden ziemlich Schmal, die übrigen fast so breit wie die Segmente. Beim <J
sind dÿçBinden mffät weniger deutlich als beim die Lamellen der Lg. gelbweiß.
Zg. verhältnismäßig klein, Bgl. an der inneren gelte mit beulenartiger Verdickung, Kgl. leicht
gekrümmt und f S E d e r Spitze zu v e rjü n g t o f § tief geteilt, die Lappen sehr schräg nach innen
abgeschhitten und kaum ausgerandet, ^ R ß : der innere Zipfel fa st vollständig fehlt; m. L. ziemlich
schmal, vor der Spitze seitlich stark eingeengt und an dm Spitze ziemlich tief eingeschnitten.
Die roten Larven leben in nicht aufblühenden Knospen, von B o f a s e n t i f o 1 i a und
geben zur Verwandlung in die Erde.
Die typischen Stücke dieser Art sind verloren gegangen und spätere Versuche, die Art zu
züchten, blieben ohne Erfolg, die hier gegebene Beschreibung stützt sich daher auf R ü b s a a m e n s
Diagnose von 1892.
8. C l i n o d i p l o s i s s a r o t h a m m i Kf f r .
Ki e f f e r , Marcellia vol. 1, 1902, p. 117.
K i e f f e r s Diagnose lautet :
„Imago — d- Rouge; funicule des antennes brun; thorax jaune, avec trois bandes brunes;
pattes jaunâtres, palpes de 4 articles, dont lés deux premiers sont un peu plus de deux fois aussi
longs que gros et les deux derniers presque quatre fois aussi longs que gros. Yeux largement confluents.
Antennes plus longues que le corps. Funicule avec les deux premiers articles soudés; nodosité
inférieure globuleuse, à col un peu plus long qu’elle, la supérieure allongée, deux fois aussi longue
que grosse, distinctement rétrécie en dessous de son milieu, avec un col aussi long qu’elle; celle de
l’article terminal se prolonge en un appendice velu, étroit et d’un quart plus court qu’elle; nodosité