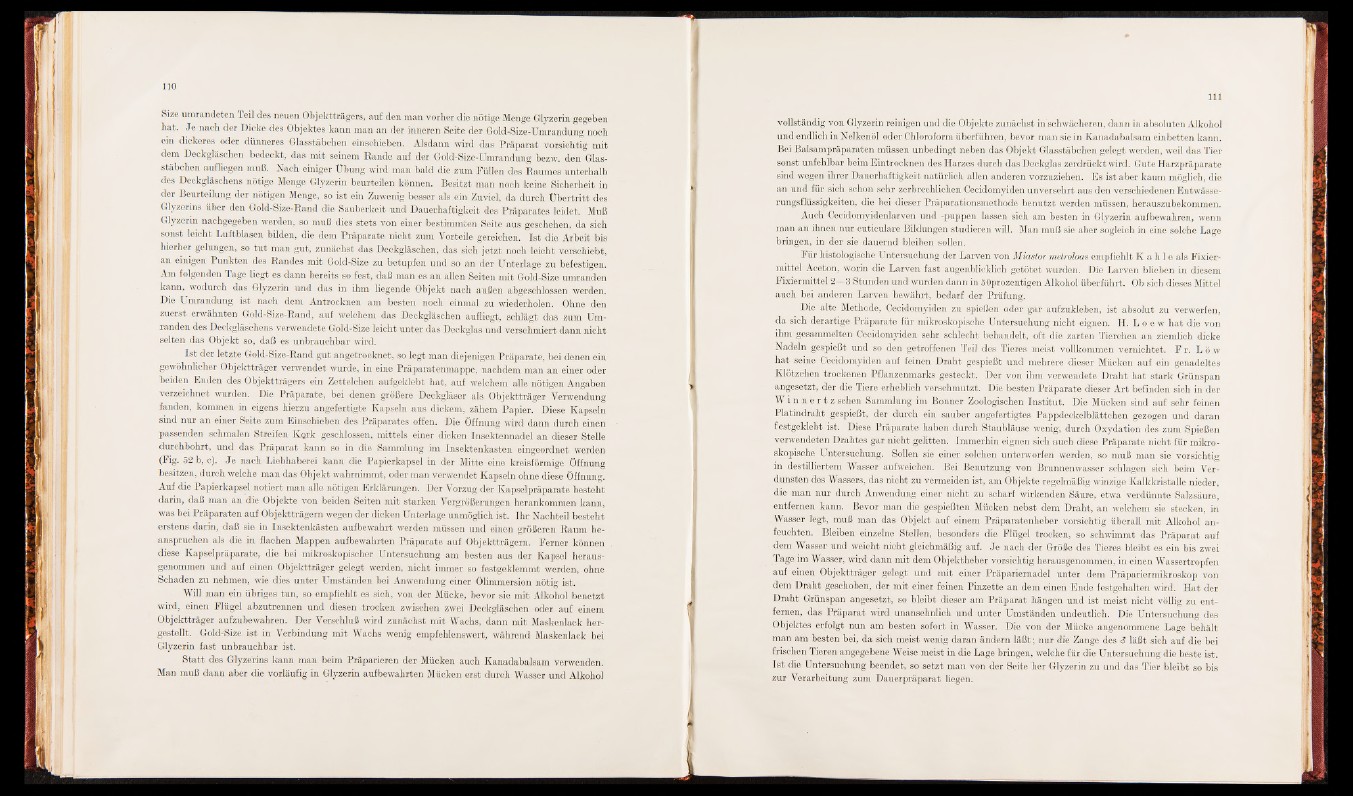
Size umrandeten Teil des neuen Objektträgers, auf den man vorher die nötige Menge Glyzerin gegeben
hat. Je nach der Dicke des Objektes kann man an der inneren Seite der Gold-Size-Umrandung noch
ein dickeres oder dünneres Glasstäbchen einschieben. Alsdann wird das Präparat vorsichtig mit
dem Deckgläschen bedeckt, das mit seinem Rande auf der Gold-Size-Umrandung bezw. den Glasstäbchen
aufliegen muß. Nach einiger Übung wird man bald die zum Füllen des Raumes unterhalb
des Deckgläschens nötige Menge Glyzerin beurteilen können. Besitzt man noch keine Sicherheit in
der Beurteilung der nötigen Menge, so ist ein Zuwenig besser als ein Zuviel, da durch Übertritt des
Glyzerins über den Gold-Size-Rand die Sauberkeit und Dauerhaftigkeit des Präparates leidet. Muß
Glyzerin nachgegeben werden, so muß dies stets von einer bestimmten Seite aus geschehen, da sich
sonst leicht Luftblasen bilden, die dem Präparate nicht zum Vorteile gereichen. Is t die Arbeit bis
hierher gelungen, so tu t man gut, zunächst das Deckgläschen, das sich jetzt noch leicht verschiebt,
an einigen Punkten des Randes mit Gold-Size zu betupfen und so an der Unterlage zu befestigen.
Am folgenden Tage liegt es dann bereits so fest, daß man es an allen Seiten mit Gold-Size umranden
kann, wodurch das Glyzerin und das in ihm liegende Objekt nach außen abgeschlossen werden.
Die Umrandung ist nach dem Antrocknen am besten noch einmal zu wiederholen. Ohne den
zuerst erwähnten Gold-Size-Rand, auf welchem das Deckgläschen aufliegt, schlägt das zum Umranden
des Deckgläschens verwendete Gold-Size leicht unter das Deckglas und verschmiert dann nicht
selten das Objekt so, daß es unbrauchbar wird.
Ist der letzte Gold-Size-Rand gut angetrocknet, so legt man diejenigen Präparate, bei denen ein
gewöhnlicher Objektträger verwendet wurde, in eine Präparatenmappe, nachdem man an einer oder
beiden Enden des Objektträgers ein Zettelchen auf geklebt hat, auf welchem alle nötigen Angaben
verzeichnet wurden. Die Präparate, bei denen größere Deckgläser als Objektträger Verwendung
fanden, kommen in eigens hierzu angefertigte Kapseln aus dickem, zähem Papier. Diese Kapseln
sind nur an einer Seite zum Einschieben des Präparates offen. Die Öffnung wird dann durch einen
passenden schmalen Streifen Kork geschlossen, mittels einer dicken Insektennadel an dieser Stelle
durchbohrt, und das Präparat kann so in die Sammlung im Insektenkasten eingeordnet werden
(Fig. 52 b, c). Je nach Liebhaberei kann die Papierkapsel in der Mitte eine kreisförmige Öffnung
besitzen, durch welche man das Objekt wahrnimmt, oder man verwendet Kapseln ohne diese Öffnung.
Auf die Papierkapsel notiert man alle nötigen Erklärungen. Der Vorzug der Kapselpräparate besteht
darin, daß man an die Objekte von beiden Seiten mit starken Vergrößerungen herankommen kann,
was bei Präparaten auf Objektträgern wegen der dicken Unterlage unmöglich ist. Ihr Nachteil besteht
erstens darin, daß sie in Insektenkästen aufbewahrt werden müssen und einen größeren Raum beanspruchen
als die in flachen Mappen aufbewahrten Präparate auf Objektträgern. Ferner können
diese Kapselpräparate, die bei mikroskopischer Untersuchung am besten aus der Kapsel herausgenommen
und auf einen Objektträger gelegt werden, nicht immer so festgeklemmt werden, ohne
Schaden zu nehmen, wie dies unter Umständen bei Anwendung einer Ölimmersion nötig ist.
Will man ein übriges tun, so empfiehlt es sich, von der Mücke, bevor sie mit Alkohol benetzt
wird, einen Flügel abzutrennen und diesen trocken zwischen zwei Deckgläschen oder auf einem
Objektträger aufzubewahren. Der Verschluß wird zunächst mit Wachs, dann mit Maskenlack hergestellt.
Gold-Bize. ist in' Verbindung mit Wachs wenig empfehlenswert, während Maskenlack bei
Glyzerin fast unbrauchbar ist.
Sta tt des Glyzerins kann man beim Präparieren der Mücken auch Kanadabalsam verwenden.
Man muß dann aber die vorläufig in Glyzerin aufbewahrten Mücken erst durch Wasser und Alkohol
vollständig von Glyzerin reinigen und die Objekte zunächst in schwächeren, dann in absoluten Alkohol
und endlich in Nelkenöl oder Chloroform überführen, bevor man sie in Kanadabalsam einbetten kann.
Bei Balsampräparaten müssen unbedingt neben das Objekt Glasstäbchen gelegt werden, weil das Tier
sonst unfehlbar beim Eintrocknen des Harzes durch das Deckglas zerdrückt wird. Gute Harzpräparate
sind wegen ihrer Dauerhaftigkeit natürlich allen anderen vorzuziehen. Es ist aber kaum möglich, die
an und für sich schon sehr zerbrechlichen Cecidomyiden unversehrt aus den verschiedenen Entwässerungsflüssigkeiten,
die bei dieser Präparationsmethode benutzt werden müssen, herauszubekommen.
Auch Cecidomyidenlarven und -puppen lassen sich am besten in Glyzerin auf bewahren, wenn
man an ihnen nur cuticulare Bildungen studieren will. Man muß sie aber sogleich in eine solche Lage
bringen, in der sie dauernd bleiben sollen.
Für histologische Untersuchung der Larven von Miastor metrobas empfiehlt K a h 1 e als Fixiermittel
Aceton, worin die Larven fast augenblicklich getötet wurden. Die Larven blieben in diesem
Fixiermittel 2—3 Stunden und wurden dann in 50prozentigen Alkohol überführt. Ob sich dieses Mittel
auch bei anderen Larven bewährt, bedarf der Prüfung.
Die alte Methode, Cecidomyiden zu spießen oder gar aufzukleben, ist absolut zu verwerfen,
da sich derartige Präparate für mikroskopische Untersuchung nicht eignen. H. L o e w hat die von
ihm gesammelten Cecidomyiden sehr schlecht behandelt, oft die zarten Tierchen an ziemlich dicke
Nadeln gespießt und so den getroffenen Teil des Tieres meist vollkommen vernichtet. F r . Lö.w
hat seine Cecidomyiden auf feinen Draht gespießt und mehrere dieser Mücken auf ein genadeltes
Klötzchen trockenen Pflanzenmarks gesteckt. Der von ihm verwendete Draht hat stark Grünspan
angesetzt, der die Tiere erheblich verschmutzt. Die besten Präparate dieser Art befinden sich in der
W i n n e r t z s e h e n Sammlung im Bonner Zoologischen Institut. Die Mücken sind auf sehr feinen
Platindraht gespießt, der durch ein sauber angefertigtes Pappdeckelblättchen gezogen und daran
festgeklebt ist. Diese Präparate haben durch Staubläuse wenig, durch Oxydation des zum Spießen
verwendeten Drahtes gar nicht gelitten. Immerhin eignen sich auch diese Präparate nicht für mikroskopische
Untersuchung. Sollen sie einer solchen unterworfen werden, so muß man sie vorsichtig
in destilliertem Wasser aufweichen. Bei Benutzung von Brunnenwasser schlagen sich beim Verdunsten
des Wassers, das nicht zu vermeiden ist, am Objekte regelmäßig winzige Kalkkristalle nieder,
die man nur durch Anwendung einer nicht zu scharf wirkenden Säure, etwa verdünnte Salzsäure,
entfernen kann. Bevor man die gespießten Mücken nebst dem Draht, an welchem sie stecken, in
Wasser legt, muß man das Objekt auf einem Präparatenheber vorsichtig überall mit Alkohol anfeuchten.
Bleiben einzelne Stellen, besonders die Flügel trocken, so schwimmt das Präparat auf
dem Wasser und weicht nicht gleichmäßig auf. Je nach der Größe des Tieres bleibt es ein bis zwei
Tage im Wasser, wird dann m it dem Objektheber vorsichtig herausgenommen, in einen Wassertropfen
auf einen Objektträger gelegt und mit einer Präpariernadel hinter dem Präpariermikroskop von
dem Draht geschoben, der mit einer feinen Pinzette an dem einen Ende festgehalten wird. Hat der
Draht Grünspan angesetzt, so bleibt dieser am Präparat hängen und ist meist nicht völlig zu entfernen,
das Präparat wird, unansehnlich und unter Umständen undeutlich. Die Untersuchung des
Objektes erfolgt nun am besten sofort in Wasser. Die von der Mücke angenommene Lage behält
man am besten bei, da sich meist wenig daran ändern läßt; nur die Zange des 6 läßt sich auf die bei
frischen Tieren angegebene Weise meist in die Lage bringen, welche für die Untersuchung die beste ist.
Ist die Untersuchung beendet, so setzt man von der Seite 'her Glyzerin zu und das Tier bleibt so bis
zur Verarbeitung zum Dauerpräparat liegen.