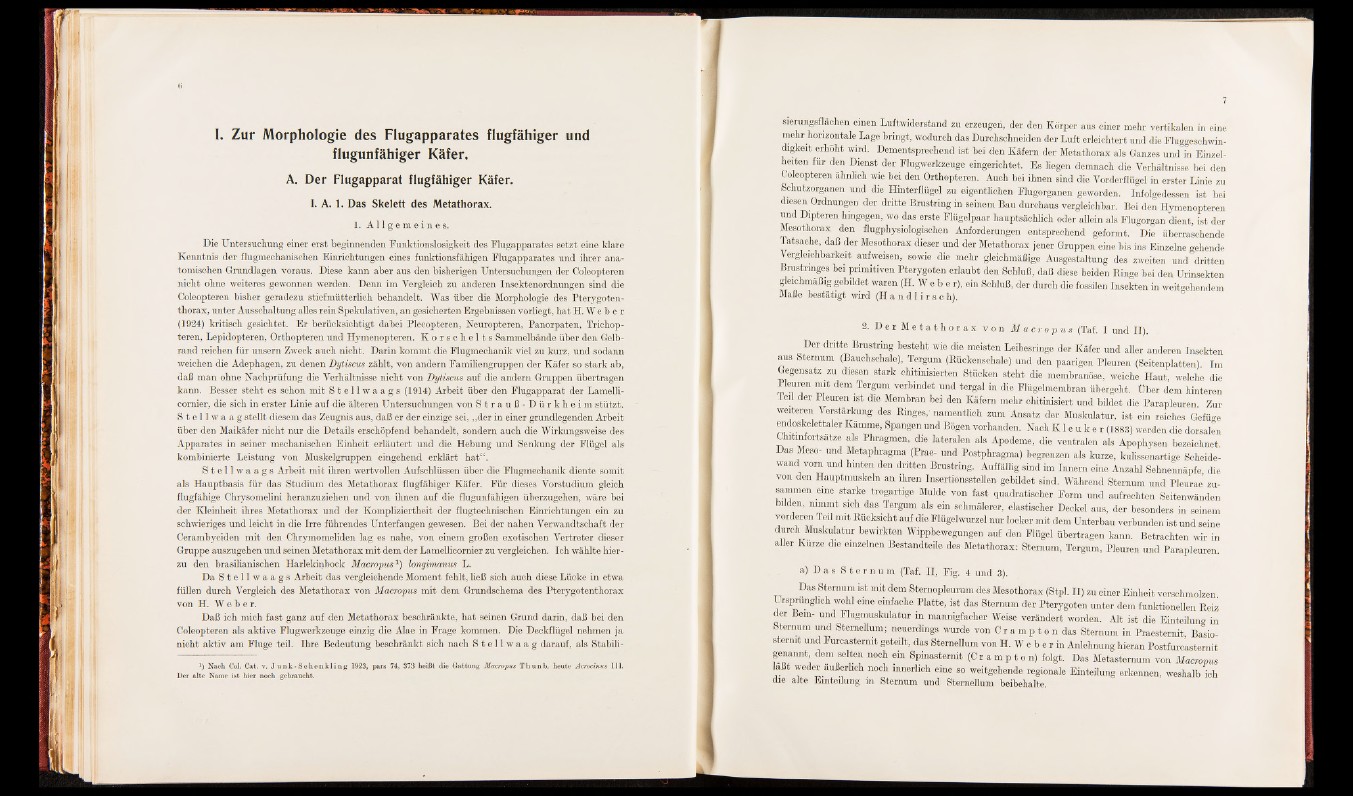
I. Zur Morphologie des Flugapparates flugfähiger und
flugunfähiger Käfer.
A. Der Flugapparat flugfähiger Käfer.
I. A. 1. Das Skelett des Metathorax.
1. A l l g e m e i n e s .
Die Untersuchung einer erst beginnenden Funktionslosigkeit des Flugapparates setzt eine klare
Kenntnis der flugmechaniscben Einrichtungen eines funktionsfähigen Flugapparates und ihrer anatomischen
Grundlagen voraus. Diese kann aber aus den bisherigen Untersuchungen der Coleopteren
nicht ohne weiteres gewonnen werden. Denn im Vergleich zu anderen Insektenordnungen sind die
Coleopteren bisher geradezu stiefmütterlich behandelt. Was über die Morphologie des Pterygoten-
thorax, unter Ausschaltung alles rein Spekulativen, an gesicherten Ergebnissen vorliegt, h a t H. W e b e r
(1924) kritisch gesichtet. Er berücksichtigt dabei Plecopteren, Neuropteren, Panorpaten, Trichop-
teren, Lepidopteren, Orthopteren und Hymenopteren. K o r s c h e l t s Sammelbände über den Gelbrand
reichen für unsern Zweck auch nicht. Darin kommt die Flugmechanik viel zu kurz, und sodann
weichen die Adephagen, zu denen Dytiscus zählt, von ändern Familiengruppen der Käfer so stark ab,
daß man ohne Nachprüfung die Verhältnisse nicht von Dytiscus auf die ändern Gruppen übertragen
kann. Besser steht es schon mit S t e l l w a a g s (1914) Arbeit über den Flugapparat der Lamelli-
cornier, die sich in erster Linie auf die älteren Untersuchungen von S t r a u ß - D ü r k h e i m stützt.
S t e i l w a a g stellt diesem das Zeugnis aus, daß er der einzige sei, „der in einer grundlegenden Arbeit
über den Maikäfer nicht nur die Details erschöpfend behandelt, sondern auch die Wirkungsweise des
Apparates in seiner mechanischen Einheit erläutert und die Hebung und Senkung der Flügel als
kombinierte Leistung von Muskelgruppen eingehend erklärt h a t“ .
S t e l l w a a g s Arbeit mit ihren wertvollen Aufschlüssen über die Flugmechanik diente somit
als Hauptbasis für das Studium des Metathorax flugfähiger Käfer. Für dieses Vorstudium gleich
flugfähige Chrysomelini heranzuziehen und von ihnen auf die flugunfähigen überzugehen, wäre bei
der Kleinheit ihres Metathorax und der Kompliziertheit der flugtechnischen Einrichtungen ein zu
schwieriges und leicht in die Irre führendes Unterfangen gewesen. Bei der nahen Verwandtschaft der
Cerambyciden mit den Chrymomeliden lag es nahe, von einem großen exotischen Vertreter dieser
Gruppe auszugehen und seinen Metathorax mit dem der Lamellicornier zu vergleichen. Ich wählte hierzu
den brasilianischen Harlekinbock Macropus1) bngimanus L.
Da S t e l l w a a g s Arbeit das vergleichende Moment fehlt, ließ sich auch diese Lücke in etwa
füllen durch Vergleich des Metathorax von Macropus mit dem Grundschema des Pterygotenthorax
von H. W e b e r .
Daß ich mich fast ganz auf den Metathorax beschränkte, h a t seinen Grund darin, daß bei den
Coleopteren als aktive Flugwerkzeuge einzig die Alae in Frage kommen. Die Deckflügel nehmen ja
nicht aktiv am Fluge teil. Ihre Bedeutung beschränkt sich nach S t e l l w a a g darauf, als Stabili1)
Nach Col. Cat. v. J u n k - S c h e n k l i n g 1923, pars 74, 373 heißt die Gattung Macr&pus Thunb. heute Aorocirms Ul.
Der alte Name ist hier noch gebraucht.
sierungsflächen einen Luftwiderstand zu erzeugen, der den Körper aus einer mehr vertikalen in eine
mehr horizontale Lage bringt, wodurch das Durchschneiden der Luft erleichtert und die Fluggeschwindigkeit
erhöht wird. Dementsprechend ist bei den Käfern der Metathorax als Ganzes und in Einzelheiten
für den Dienst der Flugwerkzeuge eingerichtet. Es liegen demnach die Verhältnisse bei den
Coleopteren ähnlich wie f f i den Orthopteren. Auch bei ihnen sind die Vorderflügel in erster T.inic 2U
Schutzorganen und die Hinterflügel zu eigentlichen Flugorganen geworden. Infolgedessen ist bei
diesen Ordnungen der dritte Brustring in seinem Bau durchaus vergleichbar. Bei den Hymenopteren
und Dipteren hingegen, wo das erste Flügelpaar hauptsächlich oder allein als Flugorgan dient, ist der
Mesothorax den flugphysiplogischen Anforderungen entsprechend geformt. Die überraschende
Tatsache, daß der Mesothorax dieser und der Metathorax jener Gruppen eine bis ins Einzelne gehende
Vergleichbarkeit aufweisen, sowie die mehr gleichmäßige Ausgestaltung des zweiten und dritten
Brustringes bei primitiven Pterygoten erlaubt den Schluß, daß diese.beiden Ringe bei den Urinsekten
gleichmäßig gebildet waren (H. W e h: e r), ein Schluß, der durch die fossilen Insekten in weitgehendem
Maße bestätigt wird ( H a n d l i rWh ) .
2. D e r M e t a t h p r a x: v o n M a er. o p (Taf. I und II).
Der dritte Brustring besteht wie die meisten Leibesringe der Käfer und aller anderen Insekten
raus Sternum (Bauchschale), Tergum (Rückenschale) und den paarigen Pleuren (Seitenplatten). Im
Gegensafz. zu diesen stark chitinisierten Stücken steht die membranöse, weiche Haut, welche die
Pleuren mit dem Tergum verbindet und tergal in die Flügelmembran übergeht. Uber dem hinteren
Teil der Pleuren ist die Membran bei den Käfern mehr chitinisiert und bildet die Parapleuren. Zur
weiteren Verstärkung des Ringes,' namentlich zum Ansatz de* Muskulatur, ist ein reiches Gefüge
endoskelettaler Kämme, Spangen und Bögen vorhanden. Nach K 1 e u k e r (1S83) werden die dorsalen
Chitmfortsatzfgals Phragmen, die lateralen als Apodeme, die ventralen als Apophysen bezeichnet.
Das Meso- und Metaphragma (Prae- und Postphragma) begrenzen als kurze, kulissenartige Scheidewand
vorn und hinten den dritten Brustring. Auffällig sind im Innern eine Anzahl Sehnennäpfe, die
von den Hauptmuskeln an ihren Insertionsstellen gebildet sind. Während Sternum und Pleurae zusammen
eine starke trogartige Mulde von fast quadratischer Form und aufrechten Seitenwänden
bilden, nimmt sich das Tergum als ein schmälerer, elastischer Deckel aus, der besonders in seinem
vorderen Teil mit Rücksicht auf die Flügelwurzel nur locker mit dem Unterbau verbunden ist und seine
durch Muskulatur bewirkten Wippbewegungen auf den Flügel übertragen kann. Betrachten wir in
aller Kurze die einzelnen Bestandteile®** Metathorax: Sternum, Tergum, Pleuren und Parapleuren.
a) D a s S t e r n u m (Taf. II, Fig. 4 und 3).
Das Sternum ist mit dem Sternopleurum des Mesothorax (Stpl. II) zu einer Einheit verschmolzen
Ursprünglich wohl eine einfache Platte, ist das Sternum der Pterygoten unter dem funktioneilen Reiz
der Bern- und Flugmuskulatur in mannigfacher Weise verändert worden. Alt ist die Einteilung in
Sternum und Sternellum; neuerdings wurde von C r a m p t o n das Sternum in Praesternit Basio-
stermt und Furcastemit geteilt, das Sternellum von H. W e b e r in Anlehnung hieran Postfurcasternit
genannt dem selten noch ein Spinastemit f r a m p t ö n) folgt. Das Metasteraum von Macropus
laßt weder äußerlich noch innerlich eine so weitgehende regionale Einteilung erkennen, weshalb ich
die alte Einteilung in Sternum und Sternellum beibehalte.