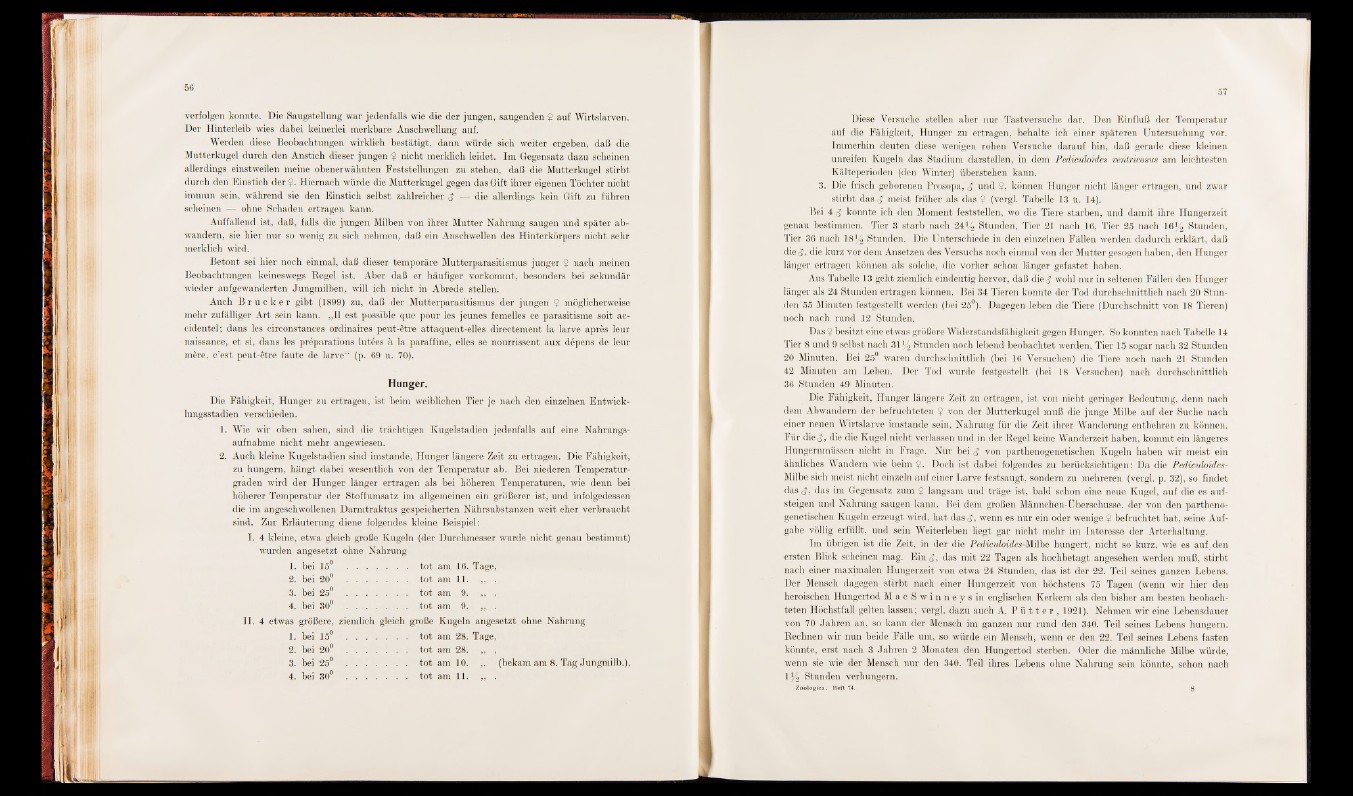
verfolgen konnte. Die Saugstellung war jedenfalls wie die der jungen, saugenden $ auf Wirtslarven.
Der Hinterleib wies dabei keinerlei merkbare Anschwellung auf.
Werden diese Beobachtungen wirklich bestätigt, dann würde sich weiter ergeben, daß die
Mutterkugel durch den Anstich dieser jungen $ nicht merklich leidet. Im Gegensatz dazu scheinen
allerdings einstweilen meine obenerwähnten Feststellungen zu stehen, daß die Mutterkugel stirbt
durch den Einstich der $. Hiernach würde die Mutterkugel gegen das Gift ihrer eigenen Töchter nicht
immun sein, während sie den Einstich selbst zahlreicher d die allerdings kein Gift zu führen
scheinen — ohne Schaden ertragen kann.
Auffallend ist, daß, falls die jungen Milben von ihrer Mutter Nahrung saugen und später abwandern,
sie hier nur so wenig zu sich nehmen, daß ein Anschwellen des Hinterkörpers nicht sehr
merklich wird.
Betont sei hier noch einmal, daß dieser temporäre Mutterparasitismus junger $ nach meinen
Beobachtungen keineswegs Regel ist. Aber daß er häufiger vorkommt, besonders bei sekundär
wieder auf gewanderten Jungmilben, will ich nicht in Abrede stellen.
Auch B r ü c k e r gibt (1899) zu, daß der Mutterparasitismus der jungen üp möglicherweise
mehr zufälliger Art sein kann. „II est possible que pour les jeunes femelles ce parasitisme soit accidentel;
dans les circonstances ordinaires peut-être attaquent-elles directement la larve après leur
naissance, et si, dans les préparations lutées à la paraffine, elles se nourrissent aux dépens de leur
mère, c’est peut-être faute de larve“ (p. 69 u. 70).
Hunger.
Die Fähigkeit, Hunger zu ertragen, ist beim weiblichen Tier je nach den einzelnen Entwicklungsstadien
verschieden.
1. Wie wir oben sahen, sind die trächtigen Kugelstadien jedenfalls auf eine Nahrungsaufnahme
nicht mehr angewiesen.
2. Auch kleine Kugelstadien sind imstande, Hunger längere Zeit zu ertragen. Die Fähigkeit,
zu hungern, hängt dabei wesentlich von der Temperatur ab. Bei niederen Temperaturgraden
wird der Hunger länger ertragen als bei höheren Temperaturen, wie denn bei
höherer Temperatur der Stoffumsatz im allgemeinen ein größerer ist, und infolgedessen
die im angeschwollenen Darmtraktus gespeicherten Nährsubstanzen weit eher verbraucht
sind. Zur Erläuterung diene folgendes kleine Beispiel:
I. 4 kleine, etwa gleich große Kugeln (der Durchmesser wurde nicht genau bestimmt)
wurden angesetzt ohne Nahrung
1. bei 15° to t am 16. Tage,
2. bei 2 0 ° ............................... to t am 11. ,, ,
3. bei 2 5 ° ............................... to t am 9. „ ,
4. bei 3 0 ° .................... . to t am 9. ,, .
II. 4 etwas größere, ziemlich gleich große Kugeln angesetzt ohne Nahrung
1. bei 1 5 ° to t am 28. Tage,
2. bei 2 0 ° ............................... to t am 28. „ ,
3. bei 2 5 ° to t am 10. „ (bekam am 8. Tag Jungmilb.),
4. bei 3 0 ° ............................... to t am 11. ,, .
Diese Versuche stellen aber nur Tastversuche dar. Den Einfluß der Temperatur
auf die Fähigkeit, Hunger zu ertragen, behalte ich einer späteren Untersuchung vor.
Immerhin deuten diese wenigen rohen Versuche darauf hin, daß gerade diese kleinen
unreifen Kugeln das Stadium darstellen, in dem Pediculoides ventricosus am leichtesten
Kälteperioden (den Winter) überstehen kann.
3. Die frisch geborenen Prosopa, $ und $, können Hunger nicht länger ertragen, und zwar
stirbt das <$ meist früher als das $ (vergl. Tabelle 13 ü. 14).
Bei 4 <$ konnte ich den Moment feststellen, wo die Tiere starben, und damit ihre Hungerzeit
genau bestimmen. Tier 3 starb nach 24% Stunden, Tier 21 nach 16, Tier 25 nach 16% Stunden,
Tier 36 nach 18% Stunden. Die Unterschiede in den einzelnen Fällen werden dadurch erklärt, daß
diedj die kurz vor dem Ansetzen des Versuchs noch einmal von der Mutter gesogen haben, den Hunger
länger ertragen können als solche, die vorher schon länger gefastet haben.
Aus Tabelle 13 geht ziemlich eindeutig hervor, daß died wohl nur in seltenen Fällen den Hunger
länger als 24 Stunden ertragen können. Bei 34 Tieren konnte der Tod durchschnittlich nach 20 Stunden
55 Minuten festgestellt werden (bei 25°). Dagegen leben die Tiere (Durchschnitt von 18 Tieren)
noch nach rund 12 Stunden.
Das $ besitzt eine etwas größere Widerstandsfähigkeit gegen Hunger. So konnten nach Tabelle 14
Tier 8 und 9 selbst nach 31% Stunden noch lebend beobachtet werden, Tier 15 sogar nach 32 Stunden
20 Minuten. Bei 25 waren durchschnittlich (bei 16 Versuchen) die Tiere noch nach 21 Stunden
42 Minuten am Leben. Der Tod wurde festgestellt (bei 18 Versuchen) nach durchschnittlich
36 Stunden 49 Minuten.
Die Fähigkeit, Hunger längere Zeit zu ertragen, ist von nicht geringer Bedeutung, denn nach
dem Abwandern der befruchteten $ von der Mutterkugel muß die junge Milbe auf der Suche nach
einer neuen Wirtslarve imstande sein, Nahrung für die Zeit ihrer Wanderung entbehren zu können.
Für died, die die Kugel nicht verlassen und in der Regel keine Wanderzeit haben, kommt ein längeres
Hungernmüssen nicht in Frage. Nur bei $ von parthenogenetischen Kugeln haben wir meist ein
ähnliches Wandern wie beim $. Doch ist dabei folgendes zu berücksichtigen: Da die Pedicubides-
Milbe sich meist nicht einzeln auf einer Larve festsaugt, sondern zu mehreren (vergl. p. 32), so findet
das d, das im Gegensatz zum $ langsam und träge ist, bald schon eine neue Kugel, auf die es auf-
steigen und Nahrung saugen kann. Bei dem großen Männchen-Überschüsse, der von den parthenogenetischen
Kugeln erzeugt wird, hat da s^, wenn es nur ein oder wenige $ befruchtet hat, seine Aufgabe
völlig erfüllt, und sein Weiterleben liegt gar nicht mehr im Interesse der Arterhaltung.
Im übrigen ist die Zeit, in der die Pediculoides-Milbe hungert, nicht so kurz, wie es auf .den
ersten Blick scheinen mag. Ein d, das mit 22 Tagen als hochbetagt angesehen werden muß, stirbt
nach einer maximalen Hungerzeit von etwa 24 Stunden, das ist der 22. Teil seines ganzen Lebens.
Der Mensch dagegen stirbt nach einer Hungerzeit von höchstens 75 Tagen (wenn wir hier den
heroischen Hungertod M a c S w i n n e y s i n englischen Kerkern als den bisher am besten beobachteten
Höchstfall gelten lassen; vergl. dazu auch A. P ü 11 e r , 1921). Nehmen wir eine Lebensdauer
von 70 Jahren an, so kann der Mensch im ganzen nur rund den 340. Teil seines Lebens hungern.
Rechnen wir nun beide Fälle um, so würde ein Mensch, wenn er den 22. Teil seines Lebens fasten
könnte, erst nach 3 Jahren 2 Monaten den Hungertod sterben. Oder die männliche Milbe würde,
wenn sie wie der Mensch nur den 340. Teil ihres Lebens ohne Nahrung sein könnte, schon nach
1% Stunden verhungern.
Zoologica. Heft 74. 3