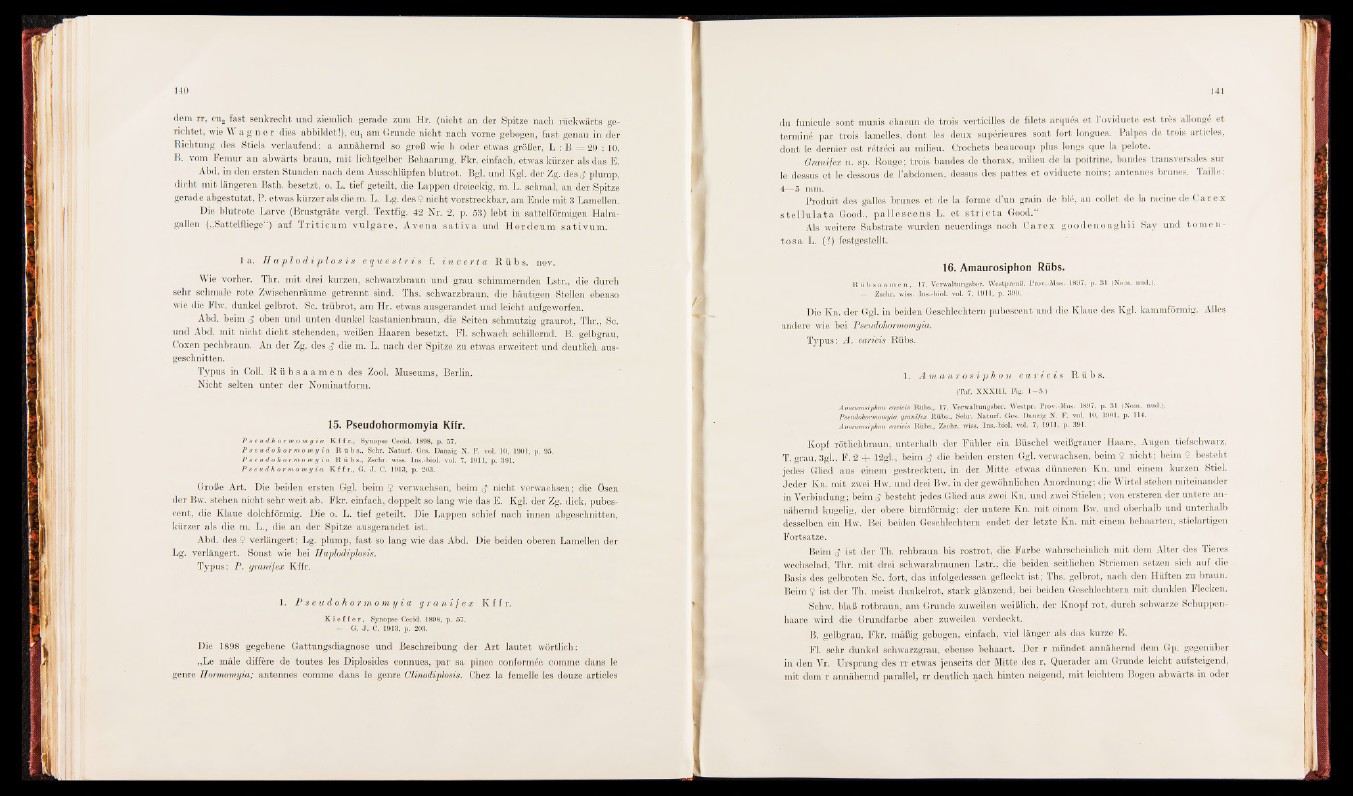
dem rr, cu2 fast senkrecht und ziemlich gerade zum Hr. (nicht an der Spitze nach rückwärts gerichtet,
w i eW a g n e r dies abbildet!), 0% am Grunde nicht nach vorne gebogen, fast genau in der
Richtung des Stiels verlaufend; a annähernd so groß wie b oder etwas größer, L : B » 29 : 10.
B. vom Femur an abwärts braun, mit lichtgelber Behaarung, Fkr. einfach, etwas kürzer als das E.
Abd. in den ersten Stunden nach dem Ausschlüpfen blutrot. Bgl. und Kgl. der Zg. des plump,
dicht mit längeren Bsth. besetzt, o. L. tief geteilt, die Lappen, dreieckig, m. L. schmal, an der Spitze
gerade abgestutzt, P. etwas kürzer als die m. L. Lg. des1? nicht vorstreckbar, am Ende mit 3 Lamellen.
Die blutrote Larve (Brustgräte vergl. Textfig. 42 Nr. 2, p. 53) lebt in .sattelförmigen Halmgallen
(„Sattelfliege“) auf Tr i t i cum vulgar e, Avena s a t i va und Ho r d e um sat ivum.
l a. H a p l o d i p l o s i s e q u e s t r i s f. i n c e r t a Rü b s . nov.
Wie vorher. Thr. mit drei kurzen, schwarzbraun und grau schimmernden Lstr., die durch
sehr schmale rote Zwischenräume getrennt sind. Ths. schwarzbraun, die häutigen Stellen ebenso
wie die Flw. dunkel gelbrot. Sc. trübrot, am Hr. etwas ausgerandet und leicht aufgeworfen.
Abd. beim $ obeD und unten dunkel kastanienbraun, die Seiten schmutzig graurot, Thr., Sc.
und Abd. mit nicht dicht stehenden, weißen Haaren besetzt. Fl. schwach schillernd. 11. gelbgradj
Coxen pechbraun. An der Zg. des <J die m. L. nach der Spitze zu etwas erweitert und deutlich aus-
geschnitten.
Typus in Coll. R ü b s a a m e n des Zool. Museums, Berlin.
Nicht selten unter der Nominatform.
15. Pseudohormomyia Kffr.
P s e u d h o r m o m y i a Kf f r . , Synopse Cecid. 1898, p. 57.
P s e u d o h o r m o m y i a Rübs . , Sehr. Naturf. Ges. Danzig N. F. vol. 10, 1901, p. 95.
P s e u d o h o r m o m y i a Rübs . , Zschr. wiss. Ins.-biol. vol. 7, 1911, p. 391.
P s e u d h o r m o m y i a Kf f r . , G. J. C. 1913, p. 203.
Große Art. Die beiden ersten Ggl. beim $ verwachsen, beim nicht verwachsen; die Ösen
der Bw. stehen nicht sehr weit ab. Fkr. einfach, doppelt so lang wie das E. Kgl. der Zg. dick, pubes-
cent, die Klaue dolchförmig. Die o. L. tief geteilt. Die Lappen schief nach innen abgeschnitten,
kürzer als die m. L., die an der Spitze ausgerandet ist.
Abd. des $ verlängert; Lg. plump, fast so lang wie das Abd. Die beiden oberen Lamellen der
Lg. verlängert. Sonst wie bei Haplodipbsis.
Typus: P. granifex Kffr.
1. P s e u d o h o r m o m y i a g r a n i f e x Kf f r .
K i e f f e r , Synopse Cecid. 1898, p. 57.
- G. J . C. 1913, p. 203.
Die 1898 gegebene Gattungsdiagnose,und Beschreibung der Art lautet wörtlich:
,,Le mâle diffère de toutes les Diplosides connues, par sa pince conforméë comme dans le
genre Hormomyia; antennes comme dans le genre Clinodiplosis. Chez la femelle les douze articles
du funicule sont munis chacun de trois verticilles de filets arques et 1 oviducte est très allonge et
terminé par trois lamelles, dont les deux supérieures Sont fort longues. Palpes de trois articles,
dont le dernier e # rétréci au milieu. Crochets. Î&ueôUp plus longs que la pelote.
Granifex n.. sp. Rouge; trois bandes de thorax, milieu de la poitrine, bandes transversales sur
le dessus éifÿdessous de l’abdomen, dessus des paf.es et oviducte noirs; antennes brunes. Taille:
4—5 mm.
Produit des galles brunes et de la forme d’un grain de blé, au collet de la racine de C a r e x
s t e l l ul a t a Good., pa' . lescens L, et: s t r i c t a Good.“
Als weitere Substrate wurden neuerdings noch ex goodenoughi i Say und t omen-
tosa L. |f j festgestellt.
16. Amaurosiphon Rübs.
R ü b s a a m e n , 17. Verwaltungsber. Westpreuß. Pro v.-Mus. 1897, p. 31 (Nom. nud.).
— Zschr. wiss. Ins.-biol. vol. 7, 1911, p. 390.
Die Kn. der Ggl. in beiden Geschlechtern pubescent und die Klaue des Kgl. kammförmig. Alles
andere wie bei Pseudohormomyia.
Typus: A. caricis Rübs.
1. A m a u r o s i p h o n c a r i ci s R ü b s .
(Taf. XXXIII, Fig. 1 -5 .)
Amaurosiphon caricis Rübs., 17. Verwaltungsber. Westpr. Prov.-Mus. 1897, p. 31 (Nom. nud.).
Pseudohormomyia granifex Rübs., Sehr. Naturf. Ges. Danzig N. F. vol. 10, 1901, p. 114.
Amaurosiphon caricis Rübs., Zschr. wiss. Ins.-biol. vol. 7, 1911, p. 391.
Kopf; rötliehbraun, Unterhalb der Fühler ein Büschel weißgrauer Haare, Augen tiefschwarz.
T. grau, 3gl., F. 2: + 12gl., beim 3 die beiden ersten Ggl. verwachsen, beim $ nicht; beim 9 besteht
jedes Glied aus einem gestreckten, in der Mitte etwas dünneren Kn. und einem kurzen Stiel.
Jeder Kn. mit zwei Hw. und drei Bw. in der gewöhnlichen Anordnung; die Wirtel stehen miteinander
in Verbindung; beim <J besteht jedes Glied aus zwei Kn. und zwei Stielen; von ersteren der untere annähernd
kugelig, der obere bimförmig; der untere Kn. mit einem Bw. und oberhalb und unterhalb
desselben ein Hw. Bei beiden Geschlechtern endet derdbtzté Kn. mit einem behaarten, stielartigen
Fortsatze.
Beim ÿ ist der Th. rehbraun bis rostrot, die Farbe wahrscheinlich mit dem Alter des Tieres
wechselnd, Thr. mit drei schwarzbraunen Lstr., die beiden seitlichen Striemen setzen sich auf die
Basis des gelbroten Sc. fort, das infolgedessen gefleckt ist; Ths. gelbrot, nach den Hüften zu braun.
Beim Ç ist der Th. meist dunkelrot, stark, glänzend, bei beiden Geschlechtern mit dunklen Flecken.
Schw. blaß rotbraun, am Grunde zuweilen weißlich, der Knopf rot, durch schwarze Schuppenhaare
wird die Grundfarbe aber zuweilen verdeckt.
B. gelbgrau, Fkr. mäßig gebogen, einfach, viel länger als das kurze E.
Fl. sehr dunkel schwarzgrau, ebenso behaart. Der -r mündet annähernd dem Gp. gegenüber
in den Vr. Ursprung des rr etwas jenseits der Mitte des jflQiieradcr am Grunde leicht aüfsteigend,
mit dem r annähernd parallel, rr deutlich nach hinten neigend, mit leichtem Bogen abwärts in oder