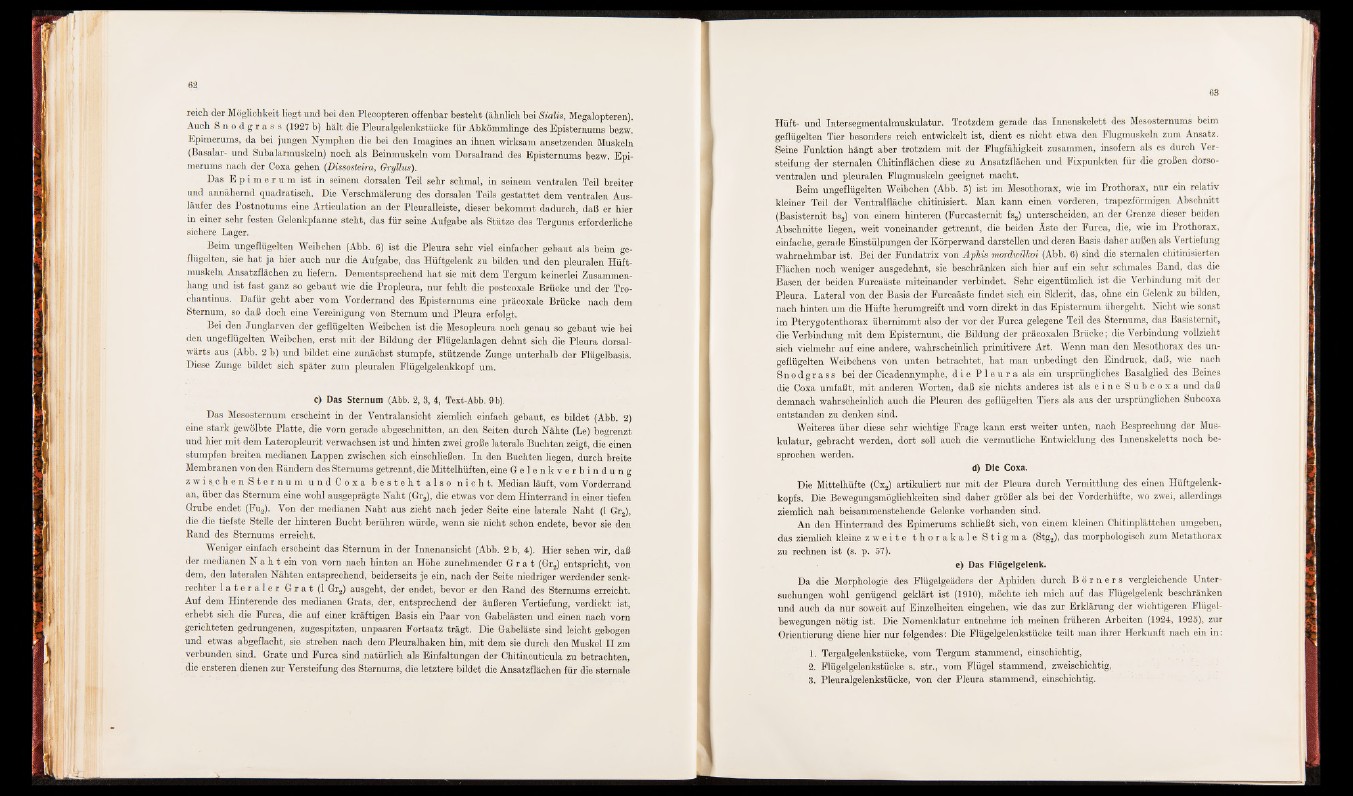
reich der Möglichkeit hegt und bei den Plecopteren offenbar besteht (ähnlich bei Sialis, Megalopteren).
Auch S n o d g r a s s (1927 b) hält die Pleuralgelenkstücke für Abkömmlinge des Episternums bezw.
Epimerums, da bei jungen Nymphen die bei den Imagines an ihnen wirksam ansetzenden Muskeln
(Basalar- und Subalarmuskeln) noch als Beinmuskeln vom Dorsalrand des Episternums bezw. Epimerums
nach der Coxa gehen (Dissosteira, Gryllus).
Das E p i m e r u m ist in seinem dorsalen Teil sehr schmal, in seinem ventralen Teil breiter
und annähernd quadratisch. Die Verschmälerung des dorsalen Teils gestattet dem ventralen Ausläufer
des Postnotums eine Articulation an der Pleuralleiste, dieser bekommt dadurch, daß er hier
in einer sehr festen Gelenkpfanne steht, das für seine Aufgabe als Stütze des Tergums erforderliche
sichere Lager.
Beim ungeflügelten Weibchen (Abb. 6) ist die Pleura sehr viel einfacher gebaut als beim geflügelten,
sie hat ja hier auch nur die Aufgabe, das Hüftgelenk zu bilden und den pleuralen Hüft-
muskeln Ansatzflächen zu liefern. Dementsprechend hat sie mit dem Tergum keinerlei Zusammenhang
und ist fast ganz so gebaut wie die Propleura, nur fehlt die postcoxale Brücke und der Tro-
chantinus. Dafür geht aber vom Vorderrand des Episternums eine präcoxale Brücke nach dem
Sternum, so daß doch eine Vereinigung von Sternum und Pleura erfolgt.
Bei den Junglarven der geflügelten Weibchen ist die Mesopleura noch genau so gebaut wie bei
den ungeflügelten Weibchen, erst mit der Bildung der Flügelanlagen dehnt sich die Pleura dorsal-
wärts aus (Abb. 2 b) und bildet eine zunächst stumpfe, stützende Zunge unterhalb der Flügelbasis.
Diese Zunge bildet sich später zum pleuralen Flügelgelenkkopf um.
c) Das Sternum (Abb. 2, 3, 4, Text-Abb. 9 b).
Das Mesosternum erscheint in der Ventralansicht ziemlich einfach gebaut, es bildet (Abb. 2)
eine stark gewölbte Platte, die vorn gerade abgeschnitten, an den Seiten durch Nähte (Le) begrenzt
und hier mit dem Lateropleurit verwachsen ist und hinten zwei große laterale Buchten zeigt, die einen
stumpfen breiten medianen Lappen zwischen sich einschließen. In den Buchten hegen, durch breite
Membranen von den Rändern des Sternums getrennt, die Mittelhüften, eine G e l e n k v e r b i n d u n g
z w i s c h e n S t e r n u m u n d C o x a b e s t e h t a l s o n i c h t . Median läuft, vom Vorderrand
an, über das Sternum eine wohl ausgeprägte Naht (Gr2), die etwas vor dem Hinterrand in einer tiefen
Grube endet (Fu2). Von der medianen Naht aus zieht nach jeder Seite eine laterale Naht (1 Gr2),
die die tiefste Stelle der hinteren Bucht berühren würde, wenn sie nicht schon endete, bevor sie den
Rand des Sternums erreicht.
Weniger einfach erscheint das Sternum in der Innenansicht (Abb. 2 b, 4). Hier sehen wir, daß
der medianen N a h t ein von vorn nach hinten an Höhe zunehmender G r a t (Gr2) entspricht, von
dem, den lateralen Nähten entsprechend, beiderseits je ein, nach der Seite niedriger werdender senkrechter
l a t e r a l e r G r a t (1 Gr2) ausgeht, der endet, bevor er den Rand des Sternums erreicht.
Auf dem Hinterende des medianen Grats, der, entsprechend der äußeren Vertiefung, verdickt ist,
erhebt sich die Furca, die auf einer kräftigen Basis ein Paar von Gabelästen und einen nach vorn
gerichteten gedrungenen, zugespitzten, unpaaren Fortsatz trägt. Die Gabeläste sind leicht gebogen
und etwas abgeflacht, sie streben nach dem Pleuralhaken hin, mit dem sie durch den Muskel I I zm
verbunden sind. Grate und Furca sind natürlich als Einfaltungen der Chitincuticula zu betrachten,
die ersteren dienen zur Versteifung des Sternums, die letztere bildet die Ansatzflächen für die sternale
Hüft- und Intersegmentalmuskulatur. Trotzdem gerade das Innenskelett des Mesosternums beim
geflügelten Tier besonders reich entwickelt ist, dient es nicht etwa den Flugmuskeln zum Ansatz.
Seine Funktion hängt aber trotzdem mit der Flugfähigkeit zusammen, insofern als es durch Versteifung
der sternalen Chitinflächen diese zu Ansatzflächen und Fixpunkten für die großen dorso-
ventralen und pleuralen Flugmuskeln geeignet macht.
Beim ungeflügelten Weibchen (Abb. 5) ist im Mesothorax, wie im Prothorax, nur ein relativ
kleiner Teil der Ventralfläche chitinisiert. Man kann einen vorderen, trapezförmigen Abschnitt
(Basisternit bs2) von einem hinteren (Furcasternit fs2) unterscheiden, an der Grenze dieser beiden
Abschnitte liegen, weit voneinander getrennt, die beiden Äste der Furca, die, wie im Prothorax,
einfache, gerade Einstülpungen der Körperwand darstellen und deren Basis daher außen als Vertiefung
wahrnehmbar ist. Bei der Fundatrix von Aphis mordwilkoi (Abb. 6) sind die sternalen chitinisierten
Flächen noch weniger ausgedehnt, sie beschränken sich hier auf ein sehr schmales Band, das die
Basen der beiden Furcaäste miteinander verbindet. Sehr eigentümlich ist die Verbindung mit der
Pleura. Lateral von der Basis der Furcaäste findet sich ein Sklerit, das, ohne ein Gelenk zu bilden,
nach hinten um die Hüfte herumgreift und vorn direkt in das Episternum übergeht. Nicht wie sonst
im Pterygotenthorax übernimmt also der vor der Furca gelegene Teil des Sternums, das Basisternit,
die Verbindung mit dem Episternum, die Bildung der präcoxalen Brücke; die Verbindung vollzieht
sich vielmehr auf eine andere, wahrscheinlich primitivere Art. Wenn man den Mesothorax des ungeflügelten
Weibchens von unten betrachtet, h a t man unbedingt den Eindruck, daß, wie nach
Sn o d g r a s s bei der Cicadennymphe, d i e P l e u r a als ein ursprüngliches Basalglied des Beines
die Coxa umfaßt, mit anderen Worten, daß sie nichts anderes ist als e i n e S u b c o x a und daß
demnach wahrscheinlich auch die Pleuren des geflügelten Tiers als aus der ursprünglichen Subcoxa
entstanden zu denken sind.
Weiteres über diese sehr wichtige Frage kann erst weiter unten, nach Besprechung der Muskulatur,
gebracht werden, dort soll auch die vermutliche Entwicklung des Innenskeletts noch besprochen
werden.
d) Die Coxa.
Die Mittelhüfte (Cx2) artikuliert nur mit der Pleura durch Vermittlung des einen Hüftgelenkkopfs.
Die Bewegungsmöglichkeiten sind daher größer als bei der Vorderhüfte, wo zwei, allerdings
ziemlich nah beisammenstehende Gelenke vorhanden sind.
An den Hinterrand des Epimerums schließt sich, von einem kleinen Chitinplättchen umgeben,
das ziemlich kleine z w e i t e t h o r a k a l e S t i g m a (Stg2), das morphologisch zum Metathorax
zu rechnen ist (s. p. 57).
e) Das Flügelgelenk.
Da die Morphologie des Flügelgeäders der Aphiden durch B ö r n e r s vergleichende Untersuchungen
wohl genügend geklärt ist (1910), möchte ich mich auf das Flügelgelenk beschränken
und auch da nur soweit auf Einzelheiten eingehen, wie das zur Erklärung der wichtigeren Flügelbewegungen
nötig ist. Die Nomenklatur entnehme ich meinen früheren Arbeiten (1924, 1925), zur
Orientierung diene hier nur folgendes-: Die Flügelgelenkstücke teilt man ihrer Herkunft nach ein in:
1. Tergalgelenkstücke, vom Tergum stammend, einschichtig,
2. Flügelgelenkstücke s. str., vom Flügel stammend, zweischichtig,
3. Pleuralgelenkstücke, von der Pleura stammend, einschichtig.