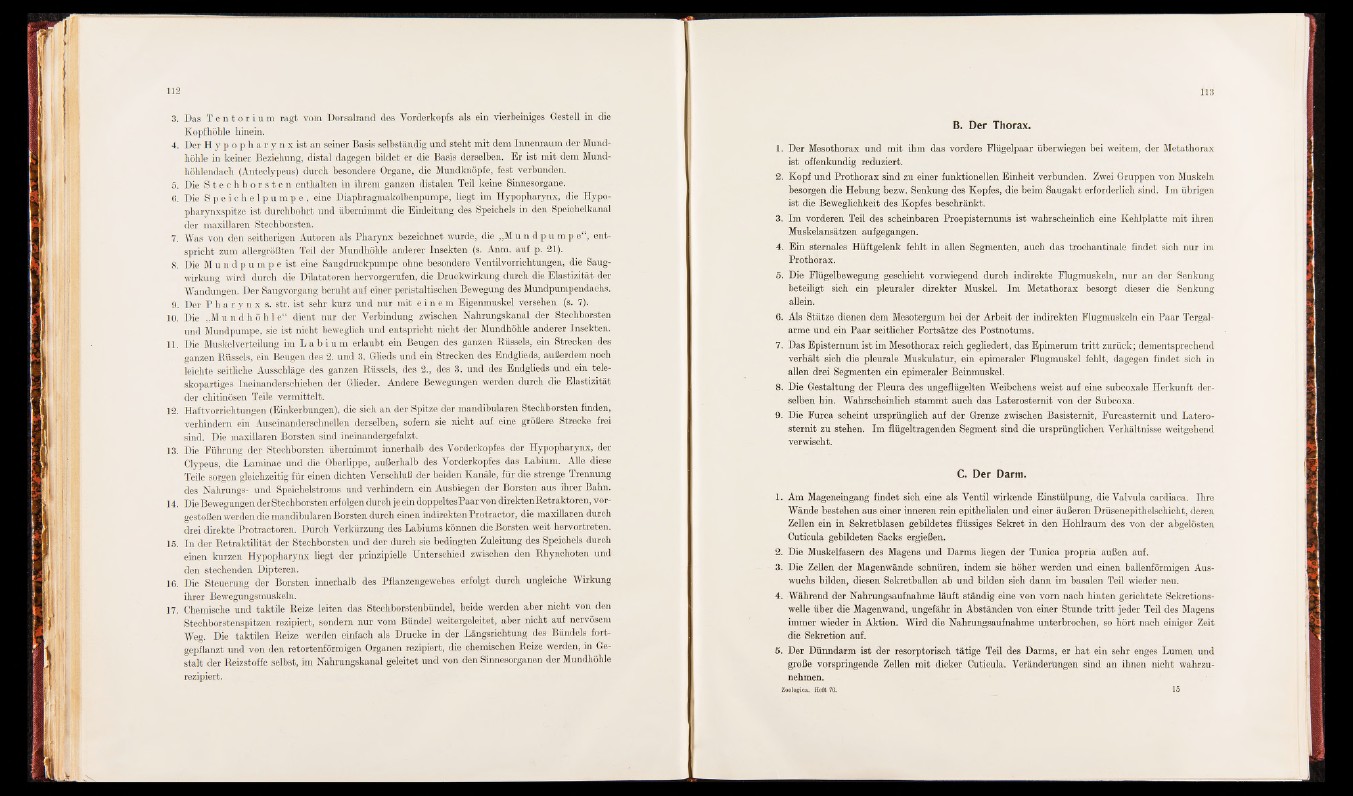
3. Das T e n t o r i u m ragt vom Dorsalrand des Vorderkopfs als ein vierbeiniges Gestell in die
Kopfhöhle hinein.
4. Der H y p o p h a r y n x ist an seiner Basis selbständig und steht mit dem Innenraum der Mundhöhle
in keiner Beziehung, distal dagegen bildet er die Basis derselben. Er ist mit dem Mundhöhlendach
(Anteclypeus) durch besondere Organe, die Mundknöpfe, fest verbunden.
5. Die S t e c h b o r s t e n enthalten in ihrem ganzen distalen Teil keine Sinnesorgane.
6. Die S p e i c h e l p u m p e , eine Diaphragmakolbenpumpe, liegt im Hypopharynx, die Hypopharynxspitze
ist durchbohrt und übernimmt die Einleitung des Speichels in den Speichelkanal
der maxillaren Stechborsten.
7. Was von den seitherigen Autoren als Pharynx bezeichnet wurde, die „M u n d p u m p e“ , entspricht
zum allergrößten Teil der Mundhöhle anderer Insekten (s. Anm. auf p. 21).
8. Die M u n d p u m p e ist eine Saugdruckpumpe ohne besondere Ventilvorrichtungen, die Saugwirkung
wird durch die Dilatatoren hervorgerufen, die Druckwirkung durch die Elastizität der
Wandungen. Der Saugvorgang beruht auf einer peristaltischen Bewegung des Mundpumpendachs.
9. Der P h a r y n x s. str. ist sehr kurz und nur mit e i n e m Eigenmuskel versehen (s. 7).
10. Die „M u n d h ö h 1 e“ dient nur der Verbindung zwischen Nahrungskanal der Stechborsten
und Mundpumpe, sie ist nicht beweglich und entspricht nicht der Mundhöhle anderer Insekten.
11. Die Muskelverteilung im L a b i u m erlaubt ein Beugen des ganzen Rüssels, ein Strecken des
ganzen Rüssels, ein Beugen des 2. und 3. Glieds und ein Strecken des Endglieds, außerdem noch
leichte seitliche Ausschläge des ganzen Rüssels, des 2., des 3. und des Endglieds und ein teleskopartiges
Ineinanderschieben der Glieder. Andere Bewegungen werden durch die Elastizität
der chitinösen Teile vermittelt.
12. Haftvorrichtungen (Einkerbungen), die sich an der Spitze der mandibularen Stechborsten finden,
verhindern ein Auseinanderschnellen derselben, sofern sie nicht auf eine größere Strecke frei
sind. Die maxillaren Borsten sind ineinandergefalzt.
13. Die Führung der Stechborsten übernimmt innerhalb des Vorderkopfes der Hypopharynx, der
Clypeus, die Laminae und die Oberlippe, außerhalb des Vorderkopfes das Labium. Alle diese
Teile sorgen gleichzeitig für einen dichten Verschluß der beiden Kanäle, für die strenge Trennung
des Nahrungs- und Speichelstroms und verhindern ein Ausbiegen der Borsten aus ihrer Bahn.
14. Die Bewegungen der Stechborsten erfolgen durch je ein doppeltesPaar von direktenRetraktoren, vorgestoßen
werden die mandibularen Borsten durch einen indirekten Protractor, die maxillaren durch
drei direkte Protractoren. Durch Verkürzung des Labiums können die Borsten weit hervortreten.
15. In der Retraktilität der Stechborsten und der durch sie bedingten Zuleitung des Speichels durch
einen kurzen Hypopharynx hegt der prinzipielle Unterschied zwischen den Rhynchoten und
den stechenden Dipteren.
16. Die Steuerung der Borsten innerhalb des Pflanzengewebes erfolgt durch ungleiche Wirkung
ihrer Bewegungsmuskeln.
17. Chemische und taktile Beize leiten das Stechborstenbündel, beide werden aber nicht von den
Stechborstenspitzen rezipiert, sondern nur vom Bündel weitergeleitet, aber nicht auf nervösem
Weg. Die taktilen Beize werden einfach als Drucke in der Längsrichtung des Bündels fortgepflanzt
und von den retortenförmigen Organen rezipiert, die chemischen Beize werden, in Gestalt
der Beizstoffe selbst, im Nahrungskanal geleitet und von den Sinnesorganen der Mundhöhle
rezipiert.
B. Der Thorax.
1. Der Mesothorax und mit ihm das vordere Flügelpaar überwiegen bei weitem, der Metathorax
ist offenkundig reduziert.
2. Kopf und Prothorax sind zu einer funktionellen Einheit verbunden. Zwei Gruppen von Muskeln
besorgen die Hebung bezw. Senkung des Kopfes, die beim Saugakt erforderlich sind. Im übrigen
ist die Beweglichkeit des Kopfes beschränkt.
3. Im vorderen Teil des scheinbaren Proepisternums ist wahrscheinlich eine Kehlplatte mit ihren
Muskelansätzen aufgegangen.
4. Ein sternales Hüftgelenk fehlt in allen Segmenten, auch das trochantinale findet sich nur im
Prothorax.
5. Die Flügelbewegung geschieht vorwiegend durch indirekte Flugmuskeln, nur an der Senkung
beteiligt sich ein pleuraler direkter Muskel. Im Metathorax besorgt dieser die Senkung
allein.
6. Als Stütze dienen dem Mesotergum bei der Arbeit der indirekten Flugmuskeln ein Paar Tergal-
arme und ein Paar seitlicher Fortsätze des Postnotums.
7. Das Episternum ist im Mesothorax reich gegliedert, das Epimerum tr itt zurück; dementsprechend
verhält sich die pleurale Muskulatur, ein epimeraler Flugmuskel fehlt, dagegen findet sich in
allen drei Segmenten ein epimeraler Beinmuskel.
8. Die Gestaltung der Pleura des ungeflügelten Weibchens weist auf eine subcoxale Herkunft derselben
hin. Wahrscheinlich stammt auch das Laterosternit von der Subcoxa.
9. Die Furca scheint ursprünglich auf der Grenze zwischen Basisternit, Furcasternit und Laterosternit
zu stehen. Im flügeltragenden Segment sind die ursprünglichen Verhältnisse weitgehend
verwischt.
C. Der Darm.
1.. Am Mageneingang findet sich eine als Ventil wirkende Einstülpung, die Valvula cardiaca. Ihre
Wände bestehen aus einer inneren rein epithelialen und einer äußeren Drüsenepithelschicht, deren
Zellen ein in Sekretblasen gebildetes flüssiges Sekret in den Hohlraum des von der abgelösten
Cuticula gebildeten Sacks ergießen.
2. Die Muskelfasern des Magens und Darms liegen der Tunica propria außen auf.
3. Die Zellen der Magenwände schnüren, indem sie höher werden und einen ballenförmigen Auswuchs
bilden, diesen Sekretballen ab und bilden sich dann im basalen Teil wdeder neu.
4. Während der Nahrungsaufnahme läuft ständig eine von vorn nach hinten gerichtete Sekretionswelle
über die Magenwand, ungefähr in Abständen von einer Stunde tr itt jeder Teil des Magens
immer wieder in Aktion. Wird die Nahrungsaufnahme unterbrochen, so hört nach einiger Zeit
die Sekretion auf.
5. Der Dünndarm ist der resorptorisch tätige Teil des Darms, er hat ein sehr enges Lumen und
große vorspringende Zellen mit dicker Cuticula. Veränderungen sind an ihnen nicht wahrzunehmen.
Zoologlca. Heft 76. 15