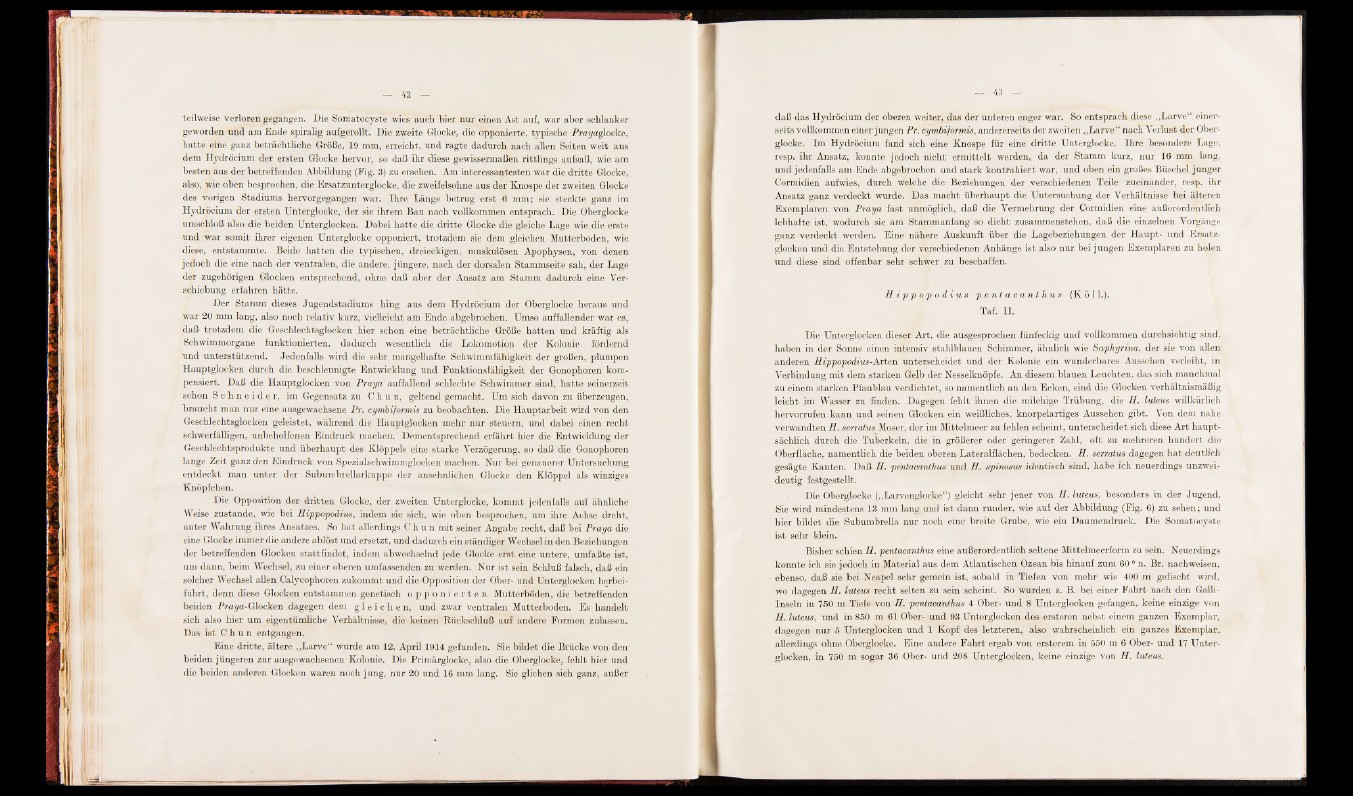
teilweise verloren gegangen. Die Somatocyste wies auch hier nur einen Ast auf, war aber schlanker
geworden und am Ende spiralig aufgerollt. Die zweite Glocke, die opponierte, typische Prayaglocke,
hatte eine ganz beträchtliche Größe, 19 mm, erreicht, und ragte dadurch nach allen Seiten weit aus
dem Hydröcium der ersten Glocke hervor, so daß ihr diese gewissermaßen rittlings aufsaß, wie am
besten aus der betreffenden Abbildung (Fig. 3) zu ersehen. Am interessantesten war die dritte Glocke,
also, wie oben besprochen, die Ersatzunterglocke, die zweifelsohne aus der Knospe der zweiten Glocke
des vorigen Stadiums hervorgegangen war. Ihre Länge betrug erst 6 mm; sie steckte ganz im
Hydröcium der ersten Unterglocke, der sie ihrem Bau nach vollkommen entsprach. Die Oberglocke
umschloß also die beiden Unterglocken. Dabei hatte die dritte Glocke die gleiche Lage wie die erste
und war somit ihrer eigenen Unterglocke opponiert, trotzdem sie dem gleichen Mutterboden, wie
diese, entstammte. Beide hatten die typischen, dreieckigen, muskulösen Apophysen, von denen
jedoch die eine nach der ventralen, die andere, jüngere, nach der dorsalen Stammseite sah, der Lage
der zugehörigen Glocken entsprechend, ohne daß aber der Ansatz am Stamm dadurch eine Verschiebung
erfahren hätte.
Der Stamm dieses Jugendstadiums hing aus dem Hydröcium der Oberglocke heraus und
war 20 mm lang, also noch relativ kurz, vielleicht am Ende abgebrochen. Umso auffallender war es,
daß trotzdem die Geschlechtsglocken hier schon eine beträchtliche Größe hatten und kräftig als
Schwimmorgane funktionierten, dadurch wesentlich die Lokomotion der Kolonie fördernd
und unterstützend. Jedenfalls wird die sehr mangelhafte Schwimmfähigkeit der großen, plumpen
Hauptglocken durch die beschleunigte Entwicklung und Funktionsfähigkeit der Gonophoren kompensiert.
Daß die Hauptglocken von Praya auffallend schlechte Schwimmer sind, hatte seinerzeit
schon S c h n e i d e r , im Gegensatz zu C h u n, geltend gemacht. Um sich davon zu überzeugen,
braucht man nur eine ausgewachsene Pr. cymbiformis zu beobachten. Die Hauptarbeit wird von den
Geschlechtsglocken geleistet, während die Hauptglocken mehr nur steuern, und dabei einen recht
schwerfälligen, unbeholfenen Eindruck machen. Dementsprechend erfährt hier die Entwicklung der
Geschlechtsprodukte und überhaupt des Klöppels eine starke Verzögerung, so daß die Gonophoren
lange Zeit ganzden Eindruck von Spezialschwimm glocken machen. Nur bei genauerer Untersuchung
entdeckt man unter der Subumbrellarkuppe der ansehnlichen Glocke den Klöppel als winziges
Knöpfchen.
Die Opposition der dritten Glocke, der zweiten Unterglocke, kommt jedenfalls auf ähnliche
Weise zustande, wie bei Hippopodius, indem sie sich, wie oben besprochen, um ihre Achse dreht,
unter Wahrung ihres Ansatzes. So hat allerdings C h u n mit seiner Angabe recht, daß bei Praya die
eine Glocke immer die andere ablöst und ersetzt, und dadurch ein ständiger Wechsel in den Beziehungen
der betreffenden Glocken stattfindet, indem abwechselnd jede Glocke erst eine untere, umfaßte ist,
um dann, beim Wechsel, zu einer oberen umfassenden zu werden. Nur ist sein Schluß falsch, daß ein
solcher Wechsel allen Calycophoren zukommt und die Opposition der Ober- und Unterglocken herbeiführt,
denn diese Glocken entstammen genetisch o p p o n i e r t e n Mutterböden, die betreffenden
beiden Praya-Glocken dagegen dem g l e i c h e n , und zwar ventralen Mutterboden. Es handelt
sich also hier um eigentümliche Verhältnisse, die keinen Rückschluß auf andere Formen zulassen.
Das ist C h u n entgangen.
Eine dritte, ältere „Larve“ wurde am 12. April 1914 gefunden. Sie bildet die Brücke von den
beiden jüngeren zur ausgewachsenen Kolonie. Die Primärglocke, also die Oberglocke, fehlt hier und
die beiden anderen Glocken waren noch jung, nur 20 und 16 mm lang. Sie glichen sich ganz, außer
daß das Hydröcium der oberen weiter, das der unteren enger war. So entsprach diese „Larve“, einerseits
vollkommen einer jungen Pr. cymbiformis, andererseits der zweiten „Larve“ nach Verlust der Oberglocke.
Im Hydröcium fand sich eine Knospe für eine dritte Unterglocke. Ihre besondere Lage,
resp. ihr Ansatz, konnte jedoch nicht ermittelt werden, da der Stamm kurz, nur 16 mm lang,
und jedenfalls am Ende abgebrochen und stark kontrahiert war, und oben ein großes Büschel junger
Cormidien aufwies, durch welche die Beziehungen der verschiedenen Teile zueinander, resp. ihr
Ansatz ganz verdeckt wurde. Das macht überhaupt die Untersuchung der Verhältnisse bei älteren
Exemplaren von Praya fast unmöglich, daß die Vermehrung der Cormidien eine außerordentlich
lebhafte ist, wodurch sie am Stammanfang so dicht zusammenstehen, daß die einzelnen Vorgänge
ganz verdeckt werden. Eine nähere Auskunft über die Lagebeziehungen der Haupt- und Ersatzglocken
und die Entstehung der verschiedenen Anhänge ist also nur bei jungen Exemplaren zu holen
und diese sind offenbar sehr schwer zu beschaffen.
H i p p o p o d i u s p e n t a c a n t h u s (K o ll.) .
Taf. II.
Die Unterglocken dieser Art, die ausgesprochen fünfeckig und vollkommen durchsichtig sind,
haben in der Sonne einen intensiv stahlblauen Schimmer, ähnlich wie Saphyrina, der sie von allen
anderen Hippopodius-Alten unterscheidet und der Kolonie ein wunderbares Aussehen verleiht, in
Verbindung mit dem starken Gelb der Nesselknöpfe. An diesem blauen Leuchten, das sich manchmal
zu einem starken Pfaublau verdichtet, so namentlich an den Ecken, sind die Glocken verhältnismäßig
leicht im Wasser zu finden. Dagegen fehlt ihnen die milchige Trübung, die H. luteus willkürlich
hervorrufen kann und seinen Glocken ein weißliches, knorpelartiges Aussehen gibt. Von dem nahe
verwandten H. serratus Moser, der im Mittelmeer zu fehlen scheint, unterscheidet sich diese Art hauptsächlich
durch die Tuberkeln, die in größerer oder geringerer Zahl, oft zu mehreren hundert die
Oberfläche, namentlich die beiden oberen Lateralflächen, bedecken. H. serratus dagegen hat deutlich
gesägte Kanten. Daß H. pentacanthus und H. spinosus identisch sind, habe ich neuerdings unzweideutig
festgestellt.
Die Oberglocke („Larvenglocke“) gleicht sehr jener von H. luteus, besonders in der Jugend.
Sie wird mindestens 13 mm lang und ist dann runder, wie auf der Abbildung (Fig. 6) zu sehen; und
hier bildet die Subumbrella nur noch eine breite Grube, wie ein Daumendruck. Die Somatocyste
ist sehr klein.
Bisher schien H. pentacanthus eine außerordentlich seltene Mittelmeerform zu sein. Neuerdings
konnte ich sie jedoch in Material aus dem Atlantischen Ozean bis hinauf zum 600 n. Br. nach weisen,
ebenso, daß sie bei Neapel sehr gemein ist, sobald in Tiefen von mehr wie 400 m gefischt wird,
wo dagegen H. luteus recht selten zu sein scheint. So wurden z. B. bei einer Fahrt nach den Galli-
Inseln in 750 m Tiefe von H. pentacanthus 4 Ober- und 8 Unterglocken gefangen, keine einzige von
H. luteus, und in 850 m 61 Ober- und 93 Unterglocken des ersteren nebst einem ganzen Exemplar,
dagegen nur 5 Unterglocken und 1 Kopf des letzteren, also wahrscheinlich ein ganzes Exemplar,
allerdings ohne Oberglocke. Eine andere Fahrt ergab von ersterem in 550 m 6 Ober- und 17 Unterglocken,
in 750 m sogar 36 Ober- und 208 Unterglocken, keine einzige von H. luteus.