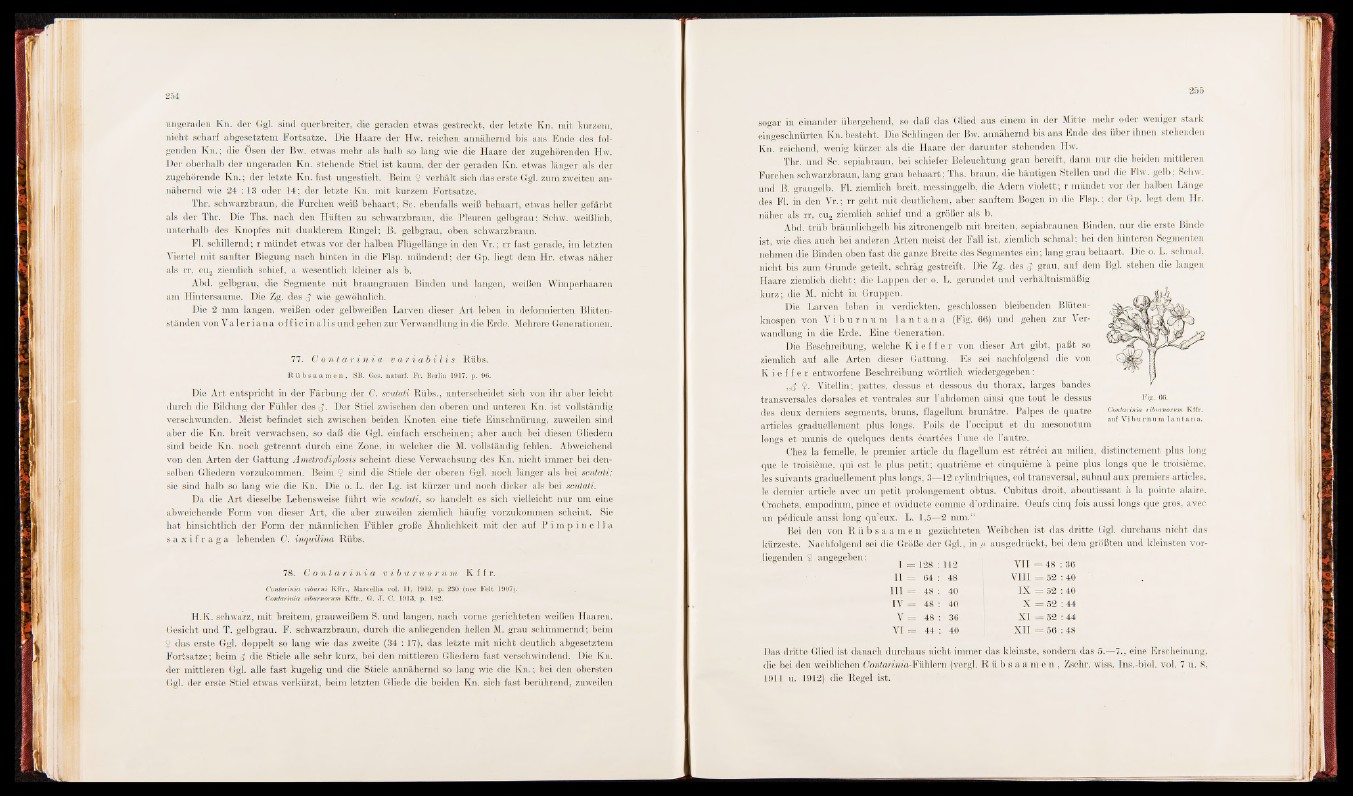
ungeraden Kn. der Ggl. sind querbreiter, die geraden etwas gestreckt, der letzte Kn. mit kurzem,
nickt sckarf abgesetztem Fortsatze. Die Haare der Hw. reichen annähernd bis ans Ende des folgenden
Kn.; die Ösen der Bw. etwas mehr als halb so lang wie die Haare der zugehörenden Hw.
Der oberhalb der ungeraden Kn. stehende Stiel ist kaum, der der geraden Kn. etwas länger als der
zugehörende K n .; der letzte Kn. fast ungestielt. Beim ? verhält sich das erste Ggl. zum zweiten annähernd
wie 24 : 13 oder 14; der letzte Kn. mit kurzem Fortsatze.
Thr. schwarzbraun, die Furchen weiß behaart; Sc. ebenfalls weiß behaart, etwas heller gefärbt
als der Thr. Die Ths. nach den Hüften zu schwarzbraun, die Pleuren gelbgrau; Schw. weißlich,
unterhalb des Knopfes mit dunklerem Ringel; B. gelbgrau, oben schwarzbraun.
Fl. schillernd; r mündet etwas vor der halben Flügellänge in den Yr.; rr fast gerade, im letzten
Viertel mit sanfter Biegung nach hinten in die Flsp. mündend; der Gp. liegt dem Hr. etwas näher
als rr, cu2 ziemlich schief, a wesentlich kleiner als b.
Abd. gelbgraUj die Segmente mit braungrauen Binden und langen, weißen Wimperhaaren
am Hintersaume. Die Zg. des wie gewöhnlich.
Die 2 mm langen, weißen oder gelbweißen Larven dieser Art leben in deformierten Blütenständen
von Va l e r i ana of f icinal i s und gehen zur Verwandlung in die Erde. Mehrere Generationen.
77. C o n t a r i n i a v a r i a b i l i s Rübs.
R ü b s a a m e n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 96.
Die Art entspricht in der Färbung der C. scutati Rübs., unterscheidet sich von ihr aber leicht
durch die Bildung der Fühler des <£. Der Stiel zwischen den oberen und unteren Kn. ist vollständig
verschwunden. Meist befindet sich zwischen beiden Knoten eine tiefe Einschnürung, zuweilen sind
aber die Kn. breit verwachsen, so daß die Ggl. einfach erscheinen; aber auch bei diesen Gliedern
sind beide Kn. noch getrennt durch eine Zone, in welcher die M. vollständig fehlen. Abweichend
von den Arten der Gattung Ametrodiplosis scheint diese Verwachsung des Kn. nicht immer bei denselben
Gliedern vorzukommen. Beim $ sind die Stiele der oberen Ggl. noch länger als bei scutati:
sie sind halb so lang wie die Kn. Die o. L. der Lg. ist kürzer und noch dicker als bei scutati.
Da die Art dieselbe Lebensweise führt wie scutati, so handelt es sich vielleicht nur um eine
abweichende Form von dieser Art, die aber zuweilen ziemlich häufig vorzukommen scheint. Sie
hat hinsichtlich der Form der männlichen Fühler große Ähnlichkeit mit der auf P i m p i n e 11a
s a x i f r a g a lebenden G. inquilina Rübs.
78. C o n t a r i n i a v i b u r n o r u m Kf f r .
Conlarinia vibumi Kffr., Marcellia vol. 11, 1912, p. 230 (nec Feit 1907).
Contarinia viburnorum Kffr., G. J . C. 1913, p. 182.
H.K. schwarz, mit breitem, grauweißem S. und langen, nach vorne gerichteten weißen Haaren.
Gesicht und T. gelbgrau. F. schwarzbraun, durch die anliegenden hellen M. grau schimmernd; beim
$ das erste Ggl. doppelt so lang wie das zweite (34 : 17), das letzte mit nicht deutlich abgesetztem
Fortsatze; beim <$ die Stiele alle sehr kurz, bei den mittleren Gliedern fast verschwindend. Die K11.
der mittleren Ggl. alle fast kugelig und die Stiele annähernd so lang wie die K n .; bei den obersten
Ggl. der erste Stiel etwas verkürzt, beim letzten Gliede die beiden Kn. sich fast berührend, zuweilen
sogar in einander übergehend, so daß das Glied aus einem in der Mitte mehr oder weniger stark
eingeschnürten Kn. besteht. Die Schlingen der Bw. annähernd bis ans Ende des über ihnen stehenden
Kn. reichend, wenig kürzer als die Haare der darunter stehenden Hw.
Thr. und Sc. sepiabraun, bei schiefer Beleuchtung grau bereift, dann nur die beiden mittleren
Furchen schwarzbraun, lang grau behaart; Ths. braun, die häutigen Stellen und die Flw. gelb; Schw.
und B. graugelb. Fl. ziemlich breit, messinggelb, die Adern violett; r mündet vor der halben Länge
des Fl. in den Vr. ; rr geht mit deutlichem, aber sanftem Bogen in die Flsp. ; der Gp. legt dem Hr.
näher als rr, cu2 ziemlich schief und a größer als b.
Abd. trüb bräunlichgelb bis zitronengelb mit breiten, sepiabraunen Binden, nur die erste Binde
ist, wie dies auch bei anderen Arten meist der Fall ist, ziemlich schmal; bei den hinteren Segmenten
nehmen die Binden oben fast die ganze Breite des Segmentes ein; lang grau behaart. Die o. L. schmal,
nicht bis zum Grunde geteilt, schräg gestreift. Die Zg. des ¿ grau, auf dem Bgl. stehen die langen
Haare ziemlich dicht; die Lappen der o. L. gerundet und verhältnismäßig
kurz; die M. nicht in Gruppen.
Die Larven leben in verdickten, geschlossen bleibenden Blütenknospen
von V i b u r n u m l a n t a n a (Fig. 66) und gehen zur Verwandlung
in die Erde. Eine Generation.
Die Beschreibung, welche K i e f f e r von dieser Art gibt, paßt so
ziemlich auf alle Arten dieser Gattung. Es sei nachfolgend die von
K i e f f e r entworfene Beschreibung wörtlich wiedergegeben :
„<£ $. Vitellin; pattes, dessus et dessous du thorax, larges bandes
transversales dorsales et ventrales sur l’abdomen ainsi que tout le dessus
des deux derniers segments, bruns, flagellum brunâtre. Palpes de quatre
articles graduellement plus longs. Poils de l’occiput et du mesonotum
longs et munis de quelques dents écartées l’une de l’autre.
Chez la femelle, le premier article du flagellum est rétréci au milieu, distinctement plus long
que le troisième, qui est le plus petit; quatrième et cinquième à peine plus longs que le troisième,
les suivants graduellement plus longs,, 3—12 cylindriques, col transversal, subnul aux premiers articles,
le dernier article avec un petit prolongement obtus. Cubitus droit, aboutissant à la pointe alaire.
Crochets, empodium, pince et oviducte comme d’ordinaire. Oeufs cinq fois aussi longs que gros, avec
un pédicule aussi long qu’eux. L. 1,5—2 mm.“
Bei den von R ü b s a a m e n gezüchteten Weibchen ist das dritte Ggl. durchaus nicht das
kürzeste. Nachfolgend sei die Größe der Ggl., in ausgedrückt, bei dem größten und kleinsten vorliegenden
$ angegeben:
Contarinia viburnoru
auf Vi bur num lai
■i Kffr,
t a n a.
I = 128 : 112 VII H§48 :: 36
II = 64 :: 48 VIII g 52 : 40
I II = 48 :: 40 IX = 52 : 40
IVM 48 : 40 X = 52 : 44
V 48 : 36 XI
n
tOot
: 44
VI H 44 : 40 XII H 56 : 48
Das dritte Glied ist danach durchaus nicht immer das kleinste, sondern das 5.—7., eine Erscheinung,
die bei den weiblichen Contarinia-Y ühlern (vergl. R ü b s a a m e n , Zschr. wiss. Ins.-biol. vol. 7 u. 8,
1911 u. 1.912) die Regel ist. ’