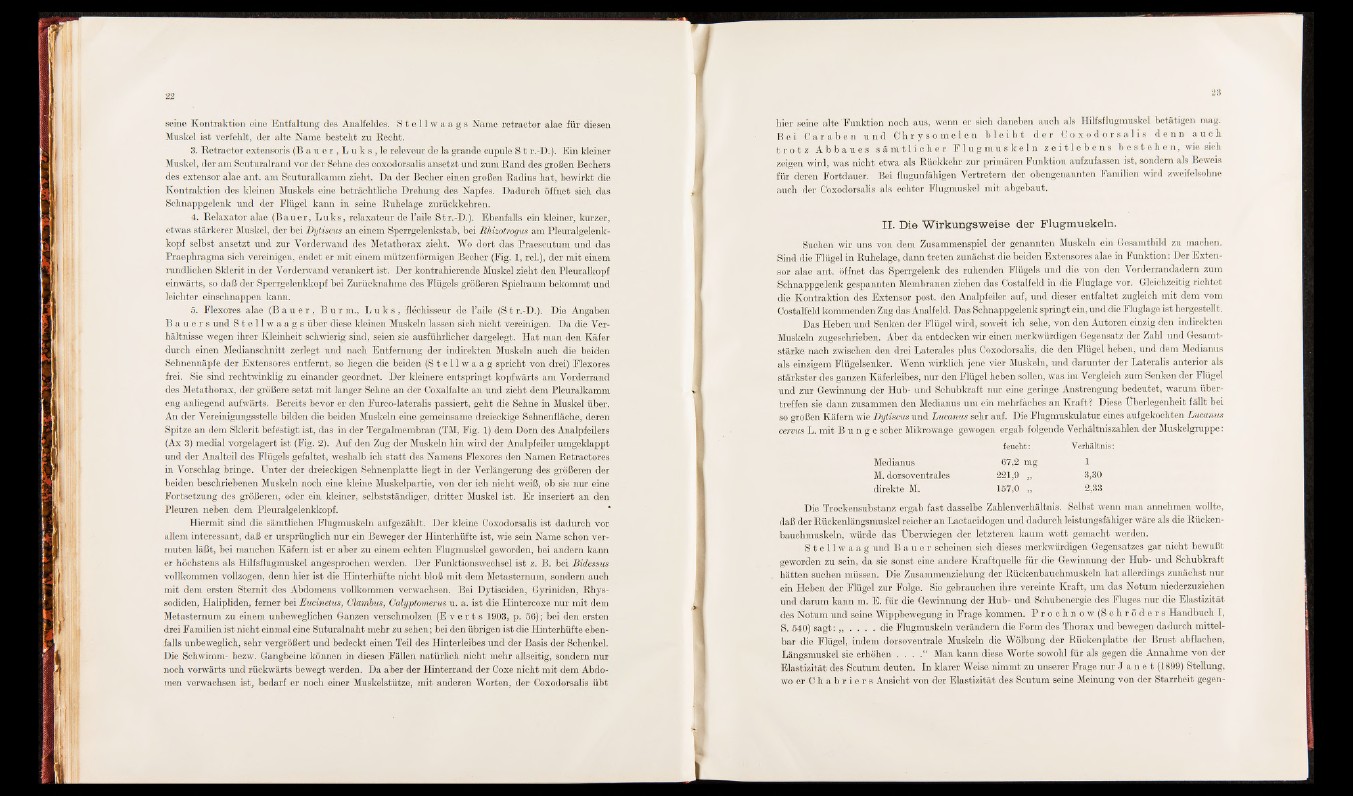
seine Kontraktion eine Entfaltung des Analfeldes. S t e l l w a a g s Name retractor alae für diesen
Muskel ist verfehlt, der alte Name besteht zu Recht.
3. Retractor extensoris ( B a u e r , L u k s , le releveur de la grande cupule S t r.-D.). Ein kleiner
Muskel, der am Scuturalrand vor der Sehne des coxodorsalis ansetzt-und zum Rand des großen Bechers
des extensor alae ant. am Scuturalkamm zieht. Da der Becher einen großen Radius hat, bewirkt die
Kontraktion des kleinen Muskels eine beträchtliche Drehung des Napfes. Dadurch öffnet sich das
Schnappgelenk und der Flügel kann in seine Ruhelage zurückkehren.
4. Relaxator alae (B a u e r , Luks , relaxateur de l’aile S t r.-D.). Ebenfalls ein kleiner, kurzer,
etwas stärkerer Muskel, der bei Dytiscus an einem Sperrgelenkstab, bei Rhizotrogus am Pleuralgelenkkopf
selbst ansetzt und zur Vorderwand des Metathorax zieht. Wo dort das Praescutum und das
Praephragma sich vereinigen, endet er mit einem mützenförmigen Becher (Fig. 1, rel.), der mit einem
rundlichen Sklerit in der Vorderwand verankert ist. Der kontrahierende Muskel zieht den Pleuralkopf
einwärts, so daß der Sperrgelenkkopf bei Zurücknahme des Flügels größeren Spielraum bekommt und
leichter einschnappen kann.
5. Flexores alae ( B a u e r , B u r m., L u k s , fléchisseur de l’aile (S t r.-D.). Die Angaben
B a u e r s und S t e l l w a a g s über diese kleinen Muskeln lassen sich nicht vereinigen. Da die Verhältnisse
wegen ihrer Kleinheit schwierig sind, seien sie ausführlicher dargelegt. Hat man den Käfer
durch einen Medianschnitt zerlegt und nach Entfernung der indirekten Muskeln auch die beiden
Sehnennäpfe der Extensores entfernt, so hegen die beiden ( S t e l l w a a g spricht von drei) Flexores
frei. Sie sind rechtwinklig zu einander geordnet. Der kleinere entspringt kopfwärts am Vorderrand
des Metathorax, der größere setzt mit langer Sehne an der Coxalfalte an und zieht dem Pleuralkamm
eng anhegend aufwärts. Bereits bevor er den Furco-laterahs passiert, geht die Sehne in Muskel über.
An der Vereinigungsstelle bilden die beiden Muskeln eine gemeinsame dreieckige Sehnenfläche, deren
Spitze an dem Sklerit befestigt ist, das in der Tergalmembran (TM, Fig. 1) dem Dorn des Analpfeilers
(Ax 3) medial vorgelagert ist (Fig. 2). Auf den Zug der Muskeln hin wird der Analpfeiler umgeklappt
und der Analteil des Flügels gefaltet, weshalb ich sta tt des Namens Flexores den Namen Retractores
in Vorschlag bringe. Unter der dreieckigen Sehnenplatte liegt in der Verlängerung des größeren der
beiden beschriebenen Muskeln noch eine kleine Muskelpartie, von der ich nicht weiß, ob sie nur eine
Fortsetzung des größeren, oder ein kleiner, selbstständiger, dritter Muskel ist. Er inseriert an den
Pleuren neben dem Pleuralgelenkkopf.
Hiermit sind die sämthchen Flugmuskeln aufgezählt. Der kleine Coxodorsahs ist dadurch vor
allem interessant, daß er ursprünglich nur ein Beweger der Hinterhüfte ist, wie sein Name schon vermuten
läßt, bei manchen Käfern ist er aber zu einem echten Flugmuskel geworden, bei ändern kann
er höchstens als Hilfsflugmuskel angesprochen werden. Der Funktionswechsel ist z. B. bei Bidessus
vollkommen vollzogen, denn hier ist die Hinterhüfte nicht bloß mit dem Metasternum, sondern auch
mit dem ersten Sternit des Abdomens vollkommen verwachsen. Bei Dytisciden, Gyriniden, Rhys-
sodiden, Halipliden, ferner bei Eudnetus, Clambus, Calyptomerus u. a. ist die Hintercoxe nur mit dem
Metasternum zu einem unbeweglichen Ganzen verschmolzen (E v e r t s 1903, p. 56); bei den ersten
drei Familien ist nicht einmal eine Suturalnaht mehr zu sehen; bei den übrigen ist die Hinterhüfte ebenfalls
unbeweglich, sehr vergrößert und bedeckt einen Teil des Hinterleibes und der Basis der Schenkel.
Die Schwimm- bezw. Gangbeine können in diesen Fällen natürlich nicht mehr allseitig, sondern nur
noch vorwärts und rückwärts bewegt werden. Da aber der Hinterrand der Coxe nicht mit dem Abdomen
verwachsen ist, bedarf er noch einer Muskelstütze, mit anderen Worten, der Coxodorsalis übt
hier seine alte Funktion noch aus, wenn er sich daneben auch als Hilfsflugmuskel betätigen mag.
B e i C a r a b e n u n d O h r y s o m e l e n b l e i b t d e r C o x o d o r s a l i s d e n n a u c h
t r o t z A b b a u e s s ä m t l i c h e r F l u g m u s k e l n z e i t l e b e n s b e s t e h e n , wie sich
zeigen wird, was nicht etwa als Rückkehr zur primären Funktion aufzufassen ist, sondern als Beweis
für deren Fortdauer. Bei flugunfähigen Vertretern der obengenannten Familien wird zweifelsohne
auch der Coxodorsalis als echter Flugmuskel mit abgebaut.
II . Die W irk u n g sw e ise der F lu gm u skeln .
Suchen wir uns von dem Zusammenspiel der genannten Muskeln ein Gesamtbild zu machen.
Sind die Flügel in Ruhelage, dann treten zunächst die beiden Extensores alae in Funktion: Der Extensor
alae ant. öffnet das Sperrgelenk des ruhenden Flügels und die von den Vorderrandadern zum
Schnappgelenk gespannten Membranen ziehen das Costalfeld in die Fluglage vor. Gleichzeitig richtet
die Kontraktion des Extensor post, den Analpfeiler auf, und dieser entfaltet zugleich mit dem vom
Costalfeld kommenden Zug das Analfeld. Das Schnappgelenk springt ein, und die Fluglage ist hergestellt.
Das Heben und Senken der Flügel wird, soweit ich sehe, von den Autoren einzig den indirekten
Muskeln zugeschrieben. Aber da entdecken wir einen merkwürdigen Gegensatz der Zahl und Gesamtstärke
nach zwischen den drei Laterales plus Coxodorsahs, die den Flügel heben, und dem Medianus
als einzigem Flügelsenker. Wenn wirklich jene vier Muskeln, und darunter der Lateralis anterior als
stärkster des ganzen Käferleibes, nur den Flügel heben sollen, was im Vergleich zum Senken der Flügel
und zur Gewinnung der Hub- und Schubkraft nur eine geringe Anstrengung bedeutet, warum übertreffen
sie dann zusammen den Medianus um ein mehrfaches an Kraft? Diese Überlegenheit fällt bei
so großen Käfern wie Dytiscus und Lucanus sehr auf. Die Flugmuskulatur eines aufgekochten Lucanus
cervus L. mit B u n g e scher Mikrowage gewogen ergab folgende Verhältniszahlen der Muskelgruppe:
feucht: V erhältnis:
Medianus 67,2 mg 1
M. dorsoventrales 221,9 ,, 3,30
direkte M. 157,0 „ 2,33
Die Trockensubstanz ergab fast dasselbe Zahlenverhältnis. Selbst wenn man annehmen wollte,
daß der Rückenlängsmuskel reicher an Lactacidogen und dadurch leistungsfähiger wäre als die Rückenbauchmuskeln,
würde das Überwiegen der letzteren kaum wett gemacht werden.
S t e l l w a a g und B a u e r scheinen sich dieses merkwürdigen Gegensatzes gar nicht bewußt
geworden zu sein, da sie sonst eine andere Kraftquelle für die Gewinnung der Hub- und Schubkraft
hätten suchen müssen. Die Zusammenziehung der Rückenbauchmuskeln h a t allerdings zunächst nur
ein Heben der Flügel zur Folge. Sie gebrauchen ihre vereinte Kraft, um das Notum niederzuziehen
und darum kann m. E. für die Gewinnung der Hub- und Schubenergie des Fluges nur die Elastizität
des Notum und seine Wippbewegung in Frage kommen. P r o c h n o w ( S c h r ö d e r s Handbuch I,
S. 540) sagt: „ . . . . die Flugmuskeln verändern die Form des Thorax und-bewegen dadurch mittelbar
die Flügel, indem dorsoventrale Muskeln die Wölbung der Rückenplatte der Brust abflachen,
Längsmuskel sie erhöhen . . . .“ Man kann diese Worte sowohl für als gegen die Annahme von der
Elastizität des Scutum deuten. In klarer Weise nimmt zu unserer Frage nur J a n e t (1899) Stellung,
w o e r C h a b r i e r s Ansicht von der Elastizität des Scutum seine Meinung von der Starrheit gegen