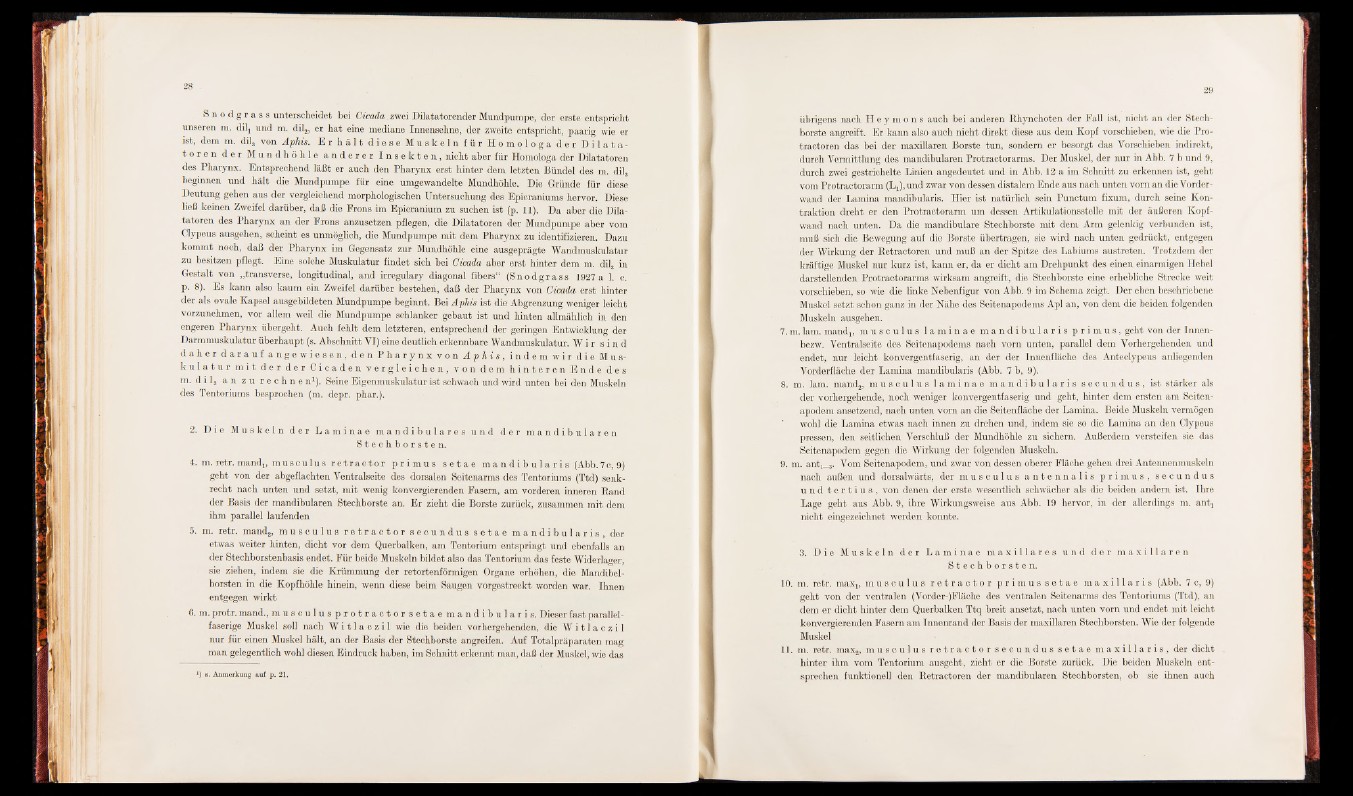
S n o d g r a s s unterscheidet bei Cicada zwei Dilatatorender Mundpumpe, der erste entspricht
unseren m. di^ und m. dil2, er h a t eine mediane Innensehne, der zweite entspricht, paarig wie er
ist, dem m. dil3 von Aphis. E r h ä l t d i e s e M u s k e l n f ü r H o m o l o g a d e r D i l a t a t
o r e n d e r M u n d h ö h l e a n d e r e r I n s e k t e n , nicht aber für Homologa der Dilatatoren
des Pharynx. Entsprechend läßt er auch den Pharynx erst hinter dem letzten Bündel des m. dil3
beginnen und hält die Mundpumpe für eine umgewandelte Mundhöhle. Die Gründe für diese
Deutung gehen aus der vergleichend morphologischen Untersuchung des Epicraniums hervor. Diese
ließ keinen Zweifel darüber, daß die Frons im Epicranium zu suchen ist (p. 11). Da aber die Dilatatoren
des Pharynx an der Frons anzusetzen pflegen, die Dilatatoren der Mundpumpe aber vom
Clypeus ausgehen, scheint es unmöglich, die Mundpumpe mit dem Pharynx zu identifizieren. Dazu
kommt noch, daß der Pharynx im Gegensatz zur Mundhöhle eine ausgeprägte Wandmuskulatur
zu besitzen pflegt. Eine solche Muskulatur findet sich bei Cicada aber erst hinter dem m. dil3 in
Gestalt von „transverse, longitudinal, and irregulary diagonal fibers“ (Sn o d g r a s s 1927a 1. c.
p. 8). Es kann also kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß der Pharynx von Cicada erst hinter
der als ovale Kapsel ausgebildeten Mundpumpe beginnt. Bei Aphis ist die Abgrenzung weniger leicht
vorzunehmen, vor allem weil die Mundpumpe schlanker gebaut ist und hinten allmählich in den
engeren Pharynx übergeht. Auch fehlt dem letzteren, entsprechend der geringen Entwicklung der
Darmmuskulatur überhaupt (s. Abschnitt VI) eine deutlich erkennbare Wandmuskulatur. W i r s i n d
d a h e r d a r a u f a n g e w i e s e n , d e n P h a r y n x v o n A p h i s , i n d e m w i r d i e Mus k
u l a t u r m i t d e r d e r C i c a d e n v e r g l e i c h e n , v o n d em h i n t e r e n E n d e d e s
m. d i l 3 a n z u r e c h n e n 1). Seine Eigenmuskulatur ist schwach und wird unten bei den Muskeln
des Tentoriums besprochen (m. depr. phar.).
2. D i e M u s k e l n d e r L a m i n a e m a n d i b u l a r e s u n d d e r m a n d i b u l a r e n
S t e c h b o r s t e n .
4. m. retr. mand*, m u s c u l u s r e t r a c t o r p r i m u s s e t a e m a n d i b u l a r i s (Abb.7c, 9)
geht von der abgeflachten Ventralseite des dorsalen Seitenarms des Tentoriums (Ttd) senkrecht
nach unten und setzt, mit wenig konvergierenden Fasern, am vorderen inneren Rand
der Basis der mandibularen Stechborste an. Er zieht die Borste zurück, zusammen mit dem
ihm parallel laufenden
5. m. retr. mand2, m u s c u l u s r e t r a c t o r s e c u n d u s s e t a e m a n d i b u l a r i s , der
etwas weiter hinten, dicht vor dem Querbalken, am Tentorium entspringt und ebenfalls an
der Stechborstenbasis endet. Für beide Muskeln bildet also das Tentorium das feste Widerlager,
sie ziehen, indem sie die Krümmung der retortenförmigen Organe erhöhen, die Mandibel-
borsten in die Kopfhöhle hinein, wenn diese beim Saugen vorgestreckt worden war. Ihnen
entgegen wirkt
6. m. protr. mand., m u s c u l u s p r o t r a c t o r s e t a e m a n d i b u l a r i s . Dieser fast parallelfaserige
Muskel soll nach W i t l a c z i l wie die beiden vorhergehenden, die W i t l a c z i l
nur für einen Muskel hält, an der Basis der Stechborste angreifen. Auf Totalpräparaten mag
man gelegentlich wohl diesen Eindruck haben, im Schnitt erkennt man, daß der Muskel, wie das
übrigens nach H e y m o n s auch bei anderen Rhynchoten der Fall ist, nicht an der Stechborste
angreift. Er kann also auch nicht direkt diese aus dem Kopf vorschieben, wie die Pro-
tractoren das bei der maxillaren Borste tun, sondern er besorgt das Vorschieben indirekt,
durch Vermittlung des mandibularen Protractorarms. Der Muskel, der nur in Abb. 7 b und 9,
durch zwei gestrichelte Linien angedeutet und in Abb. 12 a im Schnitt zu erkennen ist, geht
vom Protractorarm (L ^ u n d zwar von dessen distalem Ende aus nach unten vorn an die Vorderwand
der Lamina mandibularis. Hier ist natürlich sein Punctum fixum, durch seine Kontraktion
dreht er den Protractorarm um dessen Artikulationsstelle mit der äußeren Kopfwand
nach unten. Da die mandibulare Stechborste mit dem Arm gelenkig verbunden ist,
muß sich die Bewegung auf die Borste übertragen, sie wird nach unten gedrückt, entgegen
der Wirkung der Retractoren und muß an der Spitze des Labiums austreten. Trotzdem der
kräftige Muskel nur kurz ist, kann er, da er dicht am Drehpunkt des einen einarmigen Hebel
darstellenden Protractorarms wirksam angreift, die Stechborste eine erhebliche Strecke weit
vorschieben, so wie die linke Nebenfigur von Abb. 9 im Schema zeigt. Der eben beschriebene
Muskel setzt schon ganz in der Nähe des Seitenapodems Apl an, von dem die beiden folgenden
Muskeln ausgehen.
7.m.lam. mandl5 m u s c u l u s l a m i n a e m a n d i b u l a r i s p r i m u s , geht von der Innen-
bezw. Ventralseite des Seitenapodems nach vorn unten, parallel dem Vorhergehenden und
endet, nur leicht konvergentfaserig, an der der Innenfläche des Anteclypeus anliegenden
Vorderfläche der Lamina mandibularis (Abb. 7 b, 9).
8. m. lam. mand2, m u s c u l u s l a m i n a e m a n d i b u l a r i s s e c u n d u s , ist stärker als
der vorhergehende, noch weniger konvergentfaserig und geht, hinter dem ersten am Seiten-
apodem ansetzend, nach unten vorn an die Seitenfläche der Lamina. Beide Muskeln vermögen
wohl die Lamina etwas nach innen zu drehen und, indem sie so die Lamina an den Clypeus
pressen, den seitlichen Verschluß der Mundhöhle zu sichern. Außerdem versteifen sie das
Seitenapodem gegen die Wirkung der folgenden Muskeln.
9. m. ant!_3. Vom Seitenapodem, und zwar von dessen oberer Fläche gehen drei Antennenmuskeln
nach außen und dorsalwärts, der m u s c u l u s a n t e n n a l i s p r i m u s , s e c u n d u s
u n d t e r t i u s , von denen der erste wesentlich schwächer als die beiden ändern ist. Ihre
Lage geht aus Abb. 9, ihre Wirkungsweise aus Abb. 19 hervor, in der allerdings m. antj
nicht eingezeichnet werden konnte.
3. D i e M u s k e l n d e r L a m i n a e m a x i l l a r e s u n d d e r m a x i l l a r e n
S t e c h b o r s t e n .
10. m. retr. max1? m u s c u l u s r e t r a c t o r p r i m u s s e t a e m a x i l l a r i s (Abb. 7 c, 9)
geht von der ventralen (Vorder-)Fläche des ventralen Seitenarms des Tentoriums (Ttd), an
dem er dicht hinter dem Querbalken Ttq breit ansetzt, nach unten vorn und endet mit leicht
konvergierenden Fasern am Innenrand der Basis der maxillaren Stechborsten. Wie der folgende
Muskel
11. m. retr. max2, m u s c u l u s r e t r a c t o r s e c u n d u s s e t a e m a x i l l a r i s , der dicht
hinter ihm vom Tentorium ausgeht, zieht er die Borste zurück. Die beiden Muskeln entsprechen
funktionell den Retractoren der mandibularen Stechborsten, ob sie ihnen auch