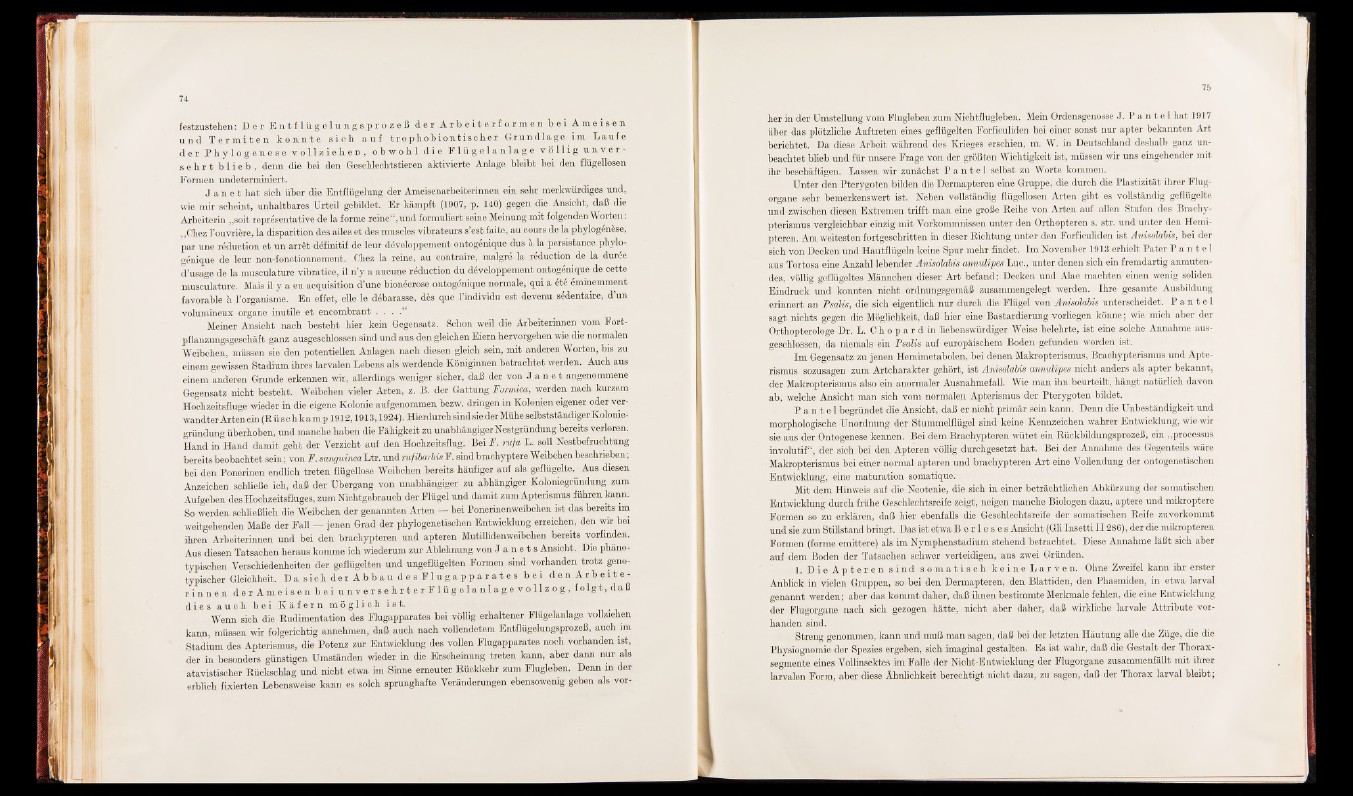
festzustehen: D e r E n t f l ü g é l u n g s p r o z e ß d e r A r b e i t e i f b i m e n b e i A m e i s e n
u n d T e r m i t e n k o n n t e s i c h a u f t j r o p h o b i o n t i s c h e r G r u n d l a g e im La u f e
d e r P h y l o g e n e s e v o l l z i e h e n , o b w o h l d i e F l ü g e l a n l a g e v ö l l i g u n v e r s
e h r t b l i e b , denn dië bei den Geschlechtstieren aktivierte Anlage bleibt bei den flügellosen
Formen undeterminiert.
J a n e t h a t sich über die Entflügelung der Ameisenarbeiterinnen ein sehr merkwürdiges und,
wie mir scheint, unhaltbares Urteil gebildet. Er kämpft (1907, p. 140) gegen die Ansicht, daß die
Arbeiterin „soit représentative de la forme reine“, und formuliert seine Meinung m it folgenden Worten :
„Chez l’ouvrière, la disparition des ailes et des muscles vibrateurs s’est faite, au cours de la phylogenèse,
par une réduction et un arrêt définitif de leur développement oütogénique dus à la persistance phylo-
génique de leur non-fonctionnement. Chez la reine, au contraire, malgré la rédüçiion de la durée
d’usage de la musculature vibratice, il n’y a aucune réduction du développement bntogémque de cette
musculature. Mais il y a eu acquisition d’une bionécrose onlogénique normale, qui a été éminemment
favorable à l’organisme. En effet, elle le débarasse, dès que l’individu est devenu sédentaire, d’un
volumineux organe inutile e t encombrant . . . .“
Meiner Ansicht nach besteht hieT kein Gegensatz. Schon weil die Arbeiterinnen vom Fortpflanzungsgeschäft
ganz ausgeschlossen sind und aus den gleichen Eiern hervorgehen wie die normalen
Weibchen, müssen sie den potentiellen Anlagen nach diesen gleich sein, mit anderen Worten, bis zu
einem gewissen Stadium ihres larvalen Lebens als werdende Königinnen betrachtét werden. Auch aus
einem anderen Grunde erkennen wir, allerdings weniger sicher, daß der von .1 a n e t angenommene
Gegensatz nicht besteht. Weibchen vieler Arten, z. B. der Gattung Formica, wetde^nach kurzem
Hochzeitsfluge wieder in die eigene Kolonie aufgenommen bezw. dringen in Kolonien eigener oder v e r-.
wandter Arten ein (K ü s c h k am p 1912,1913,1924). HierdurchsindsiederMüheselbstständigerKofenie-
gründung überhoben, und manche haben die Fähigkeit zu unabhängiger Nestgründung bereits verloren.
Hand in Hand damit geht der Verzicht auf den Hochzeitsflug; Bei F. mfa L. soll Nestbefruchtung
bereits beobachtet sein ; von F. sanguinea Ltr. und rufibarbis F. sind brachyptere Weibchen beschrieben ;
bei den Ponerinen endlich treten flügellose Weibchen bereits häufiger auf als geflügelte. Aus .diesen
Anzeichen schließe ich, daß der Übergang von unabhängiger zu abhängiger Koloniegründung zum
Aufgeben des Hochzeitsfluges, zum Nichtgebrauch der Flügel und damit zum Apterismus führen kann.
So werden ™Kli«Bli«Ti die Weibchen der genannten Arten — bei Ponerinenweibchen ist das bereits im
weitgehenden Maße der Fall — jenen Grad der phylogenetischen Entwicklung erreichen, den wir bei
ihren Arbeiterinnen und bei den brachypteren und apteren Mutillidenweibchen bereits vorfinden.
Aus diesen Tatsachen heraus komme ich. wiederum zur Ablehnung von J a n e t s Ansicht. Die phänotypischen
Verschiedenheiten der geflügelten und ungeflügelten Formen sind vorhanden trotz genotypischer
Gleichheit. D a s i c h de r A b b a u d e s F l u g a p p a r a t e s b e i d e n A r b e i t e i r
i n n e n de r Am e i s e n b e i u n v e r s e h r t e r F l ü g e l a n l a g e v o l l z o g , f ol gt , da ß
d i e s a u c h b e i K ä f e r n m ö g l i c h i s t .
Wenn sich die Kudimentation des Flugapparates bei völlig erhaltener Flügelanlage vollziehen
lfn.„Tlj müssen wir folgerichtig annehmen, daß auch nach vollendetem Entflügelungsprozeß, auch im
Stadium des Apterismus, die Potenz zur Entwicklung des vollen Flugapparates noch vorhanden ist,
der in besonders günstigen Umständen wieder in die Erscheinung treten kann, aber dann nur als
atavistischer Rückschlag und nicht etwa im Sinne erneuter Rückkehr zum Flugleben. Denn in der
erblich fixierten Lebensweise kann es solch sprunghafte Veränderungen ebensowenig geben als vorher
in der Umstellung vom Flugleben zum Nichtflugleben. Mein Ordensgenosse J. P a n t e 1 hat 1917
über das plötzliche Auftreten eines geflügelten Forficuliden bei einer sonst nur apter bekannten Art
berichtet. Da diese Arbeit während des Krieges erschien, m. W. in Deutschland deshalb ganz unbeachtet
blieb und füx unsere Frage von der größten Wichtigkeit ist, müssen wir uns eingehender mit
ihr beschäftigen. Lassen wir zunächst P a n t e 1 selbst zu Worte kommen.
Unter den Pterygoten bilden die Dermapteren eine Gruppe, die durch die Plastizität ihrer Flugorgane
sehr bemerkenswert ist. Neben vollständig flügellosen Arten gibt es vollständig geflügelte
und zwischen diesen Extremen trifft man eine große Reihe von Arten auf allen Stufen des Brachy-
pterismus vergleichbar einzig mit Vorkommnissen unter den Orthopteren s. str. und unter den Hemi-
pteren. Am weitesten fortgeschritten in dieser Richtung unter den Forficuliden ist Anisolabis, bei der
sich von Decken und Hautflügeln keine Spur mehr findet. Im November 1913 erhielt Pater P a n t e 1
aus Tortosa eine Anzahl lebender Anisolabis annulipes Luc., unter denen sich ein fremdartig anmutendes,
völlig geflügeltes Männchen dieser Art befand; Decken und Alae machten einen wenig soliden
Eindruck und konnten nicht ordnungsgemäß zusammengelegt werden. Ihre gesamte Ausbildung
erinnert an Psalis, die sich eigentlich nur durch die Flügel von Anisolabis unterscheidet. P a n t e 1
sagt nichts gegen die Möglichkeit, daß hier eine Bastardierung vorliegen könne; wie mich aber der
Orthopterologe Dr. L. C h o p a r d i n liebenswürdiger Weise belehrte, ist eine solche Annahme ausgeschlossen,
da niemals ein Psalis auf europäischem Boden gefunden worden ist.
Im Gegensatz zu jenen Hemimetabolen, bei denen Makropterismus, Brachypterismus und Apterismus
sozusagen zum Artcharakter gehört, ist Anisolabis annulipes nicht anders als apter bekannt,
der Makropterismus also ein anormaler Ausnahmefall. Wie man ihn beurteilt, hängt natürlich davon
ab, welche Ansicht man sich vom normalen Apterismus der Pterygoten bildet.
P a n t e 1 begründet die Ansicht, daß er nicht primär sein kann. Denn die Unbeständigkeit und
morphologische Unordnung der Stummelflügel sind keine Kennzeichen wahrer Entwicklung, wie wir
sie aus der Ontogenese kennen. Bei dem Brachypteren wütet ein Rückbildungsprozeß, ein „processus
involutif“, der sich bei den Apteren völlig durchgesetzt hat. Bei der Annahme des Gegenteils wäre
Makropterismus bei einer normal apteren und brachypteren Art eine Vollendung der ontogenetischen
Entwicklung, eine maturation somatique.
Mit dem Hinweis auf die Neotenie, die sich in einer beträchtlichen Abkürzung der somatischen
Entwicklung durch frühe Geschlechtsreife zeigt, neigen manche Biologen dazu, aptere und mikroptere
Formen so zu erklären, daß hier ebenfalls die Geschlechtsreife der somatischen Reife zuvorkommt
und sie zum Stillstand bringt. Das ist etwa B e r l e s e s Ansicht (Gli Insetti I I 286), der die mikropteren
Formen (forme emittere) als im Nymphenstadium stehend betrachtet. Diese Annahme läßt sich aber
auf dem Boden der Tatsachen schwer verteidigen, aus zwei Gründen.
1. D i e A p t e r e n s i n d s o m a t i s c h k e i n e L a r v e n . Ohne Zweifel kann ihr erster
Anblick in vielen Gruppen, so bei den Dermapteren, den Blattiden, den Phasmiden, in etwa larval
genannt werden; aber das kommt daher, daß ihnen bestimmte Merkmale fehlen, die eine Entwicklung
der Flugorgane nach sich gezogen hätte, nicht aber daher, daß wirkliche larvale Attribute vorhanden
sind.
Streng genommen, kann und muß man sagen, daß bei der letzten Häutung alle die Züge, die die
Physiognomie der Spezies ergeben, sich imaginal gestalten. Es ist wahr, daß die Gestalt der Thoraxsegmente
eines Vollinsektes im Falle der Nicht-Entwicklung der Flugorgane zusammenfällt mit ihrer
larvalen Form, aber diese Ähnlichkeit berechtigt nicht dazu, zu sagen, daß der Thorax larval bleibt;