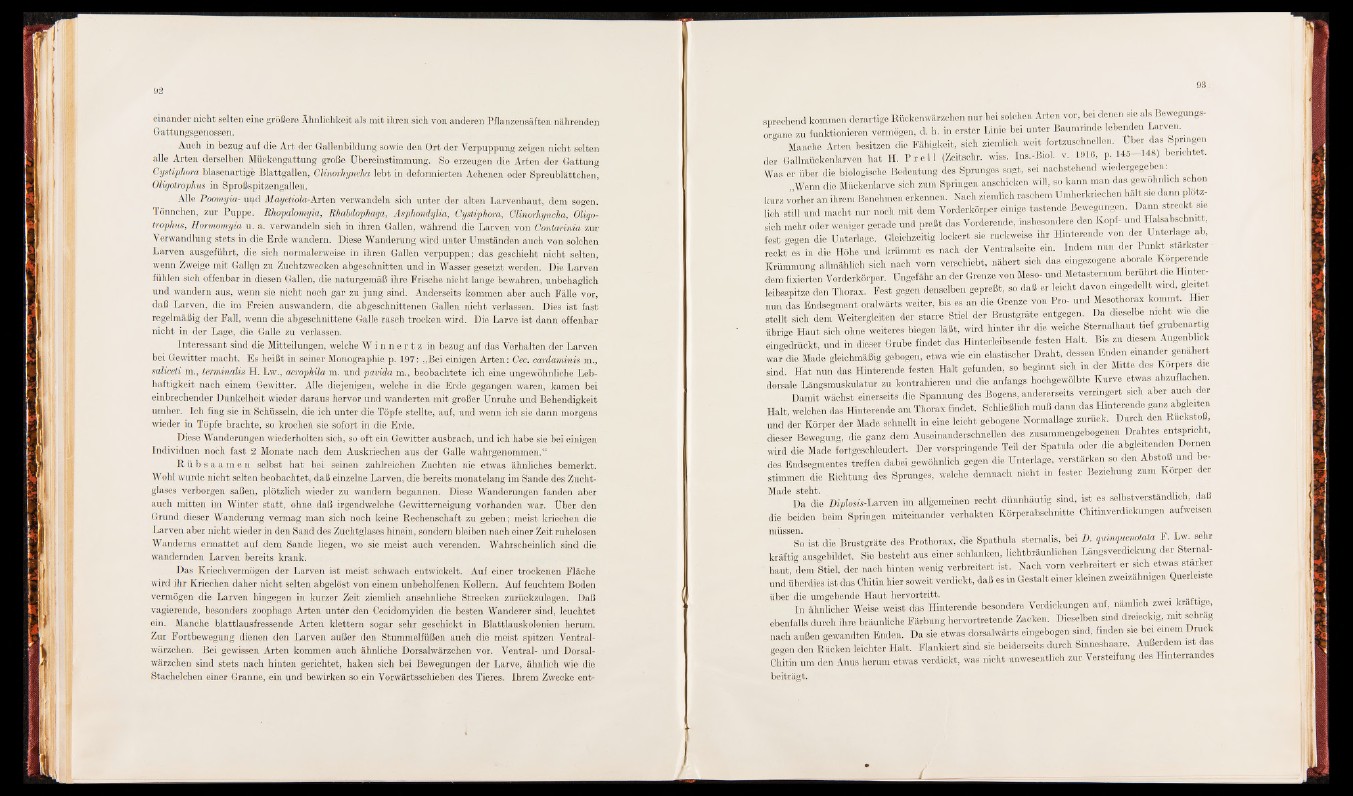
einander nicht selten eine größere Ähnlichkeit als m it ihren sich von anderen Pflanzensäften nährenden
Gattungsgenossen.
Auch in bezug auf die Art der Gallenbildung sowie den Ort der Verpuppung zeigen nicht selten
alle Arten derselben Mückengattung große Übereinstimmung. So erzeugen die Arten der Gattung
Cystiphora blasenartige Blattgallen, Clinorhyncha lebt in deformierten Achenen oder Spreublättchen,
Oligotrophus in Sproßspitzengallen.
Alle Poomyia- und Mayetiola-Aiten verwandeln sich unter der alten Larvenhaut, dem sogen.
Tönnchen, zur Puppe. Rhopalomyia, Rhabdopkaga, Asphondylia, Cystiphora, Clinorhyncha, Oligotrophus,
Hormomyia u. a. verwandeln sich in ihren Gallen, während die Larven von Contarinia zur
Verwandlung stets in die Erde wandern. Diese Wanderung wird unter Umständen auch von solchen
Larven ausgeführt, die sich normalerweise in ihren Gallen verpuppen; das geschieht nicht selten,
wenn Zweige mit Gallon zu Zuchtzwecken abgeschnitten und in Wasser gesetzt werden. Die Larven
fühlen sich offenbar in diesen Gallen, die naturgemäß ihre Frische nicht lange bewahren, unbehaglich
und wandern aus, wenn sie nicht noch gar zu jung sind. Anderseits kommen aber auch Fälle vor,
daß Larven, die im Freien auswandern, die abgeschnittenen Gallen nicht verlassen. Dies ist fast
regelmäßig der Fall, wenn die abgeschnittene Galle rasch trocken wird. Die Larve ist dann offenbar
nicht in der Lage, die Galle zu verlassen.
Interessant sind die Mitteilungen, welche W i n n e r t z in bezug auf das Verhalten der Larven
bei Gewitter macht. Es heißt in seiner Monographie p. 197: „Bei einigen Arten: Cec. cardaminis m.,
saliceti m., terminalis H. Lw., acrophila m. und pavida m., beobachtete ich eine ungewöhnliche Lebhaftigkeit
nach einem Gewitter. Alle diejenigen, welche in die Erde gegangen waren, kamen bei
einbrechender Dunkelheit wieder daraus hervor und wanderten mit großer Unruhe und Behendigkeit
umher. Ich fing sie in Schüsseln, die ich unter die Töpfe stellte, auf, und wenn ich sie dann morgens
wieder in Töpfe brachte, so krochen sie sofort in die Erde.
Diese Wanderungen wiederholten sich, so oft ein Gewitter ausbrach, und ich habe sie bei einigen
Individuen noch fast 2 Monate nach dem Auskriechen aus der Galle wahrgenommen.“
R ü b s a a m e n selbst hat bei seinen zahlreichen Zuchten nie etwas ähnliches bemerkt.
Wohl wurde nicht selten beobachtet* daß einzelne Larven, die bereits monatelang im Sande des Zuchtglases
verborgen saßen, plötzlich wieder zu wandern begannen. Diese Wanderungen fanden aber
auch mitten im Winter statt, ohne daß irgendwelche Gewitterneigung vorhanden war. Uber den
Grund dieser Wanderung vermag man sich noch keine Rechenschaft zu geben; meist kriechen die
Larven aber nicht wieder in den Sand des Zuchtglases hinein, sondern bleiben nach einer Zeit ruhelosen
Wanderns ermattet auf dem Sande liegen, wo sie .meist auch verenden. Wahrscheinlich sind die
wandernden Larven bereits krank.
Das Kriechvermögen der Larven ist meist schwach entwickelt. Auf einer trockenen Fläche
wird ihr Kriechen daher nicht selten abgelöst von einem unbeholfenen Kollern. Auf feuchtem Boden
vermögen die Larven hingegen in kurzer Zeit ziemlich ansehnliche Strecken zurückzulegen. Daß
vagierende, besonders zoophage Arten unter den Cecidomyiden die besten Wanderer sind, leuchtet
ein. Manche blattlausfressende Arten klettern sogar sehr geschickt in Blattlauskolonien herum.
Zur Fortbewegung dienen den Larven außer den Stummelfüßen auch die meist spitzen Ventralwärzchen.
Bei gewissen Arten kommen auch ähnliche Dorsalwärzchen vor. Ventral- und Dorsalwärzchen
sind stets nach hinten gerichtet, haken sich bei Bewegungen der Larve, ähnlich wie die
Stachelchen einer Granne, ein und bewirken so ein Vorwärtsschieben des Tieres. Ihrem Zwecke entsprechend
kommen derartige Rückenwärzchen nur bei solchen Arten vor, bei denen sie als Bewegungsorgane
H funktionieren vermögen, d. h. in erster Linie bei unter Baumrinde lebenden Larven.
Manche Arten besitzen die Fähigkeit, sich ziemlich weit fortzuschnellen. Uber das Sprmgen
der Gallmückenlarven hat H. P r e l l (Zeitsphr. wiss. Ins.-Biol. v. 1916, 1 145—:148) berichtet.
Was er über die biologische Bedeutung des Sprung® sagt, sei nachstehend wiedergegeben
Wenn die Mückenlarve sich zum Springen anschicken will, so kann man das gewöhnlich schon
kurz vorher an ihrem Benehmen erkennen. Nach ziemlich raschem Umherkriechen hält sie dann plötzlich
still und macht nur noch mit dem .Vorderkörper einige tastende Bewegungen. Dann streckt sie
sich mehr oder weniger gerade und preßt das Vorderende, insbesondere den Kopf- und Halsabschnitt,
fest gegen die Unterlage. Gleichzeitig lockert ■ ruckweise ihr Hinterende von der Unterlage ab,
reckt es in B— und krümmt es nach der Ventralseite ein. Indem nun der Punkt stärkster •
Krümmung allmählich 5 e h nach vorn verschiebt, nähert sich das eingezogene aborale Korperende
dem fixierten Vörderköfper. Ungefähr an der Grenze von Meso- und Metasternum berührt die Hinterleibsspitze
den Thorax. Fest gegen denselben gepreßt, so daß er leicht davon emgedellt wird gleitet
nun das Endsegment oralwärts weiter, bis es: an die Grenze von Pro- und Mesothorax kommt. I Hier
stellt sich dem Weitergleiten der starre Stiel der Brustgräte entgegen. Da dieselbe nicht wie die
übrige Haut sich ohne weiteres biegen läßt, wird hinter ihr die weiche Stemalhaut tief grubenartig
eingedrückt, und in dieser Grube findet das Hinterleibsende festen HalfUBis zu diesem Augenblick
war die Made gleichmäßig gebogen, etwa wie ein elastischer Draht, dessen Enden einander gena |
sind. Hat nun das Hinterende festen Halt gefunden, beginnt sich m der Mitte des Körpersi die
dorsale Längsmuskulatur zu kontrahieren und die anfangs hochgewölbte Kurve etwas abzuflachen.
Damit wächst einerseits die Spannung des Bogens, andererseits verringert sich aber auch der
Halt, welchen das Hinterende am Thorax findet. Schließlich muß dann das Hinterende ganz abgleiten
und der Körper der Made_schnellt in eine leicht gebogene Normallage zuruck. Durch den Ruc o ,
dieser Bewegung, die ganz dem Auseinanderschnellen 'des zusammengebogenen Drahtes entspricht,
wird die Made fortgeschleudert. Der vorspringende Teil der Spatula öder die abgleitenden Domen
des Endsegmentes treffen dabei gewöhnlich gegen die Unterlage, verstärken so den Abstoß und bestimmen
die Richtung des Sprunges,, welche demnach nicht in fester Beziehung zum Körper der
n a d ^ d i e Diphsis-Larven im allgemeinen rÄ h t dünnhäutig sind, ist es selbstverständlich, daß
die beiden beim Springen miteinander verhakten Körperabschnitte Chitinverdickungen aufweisen
müssen. T i.
So ist die Brustgräte des Protborax, die Spatbula sternalis, bei D. qmnquenotata F. Lw. sehr
kräftiv ausgebildet.- Sie besteht aus einer schlanken, lichtbräunliehen Längsverdickung der Sternalhaut
dem Stiel, der nach hinten wenig verbreitert ist. - Nach vorn verbreitert er sich etwas starker
und überdies ist das Chitin hier soweit verdickt, daß es in Gestalt einer kleinen zweizähnigen Querleiste
über’die umgebende Haut hervortritt. . .
In ähnlicher Weise weist das Hinterende besondere Verdickungen auf, nämlich zwei kra ige,
ebenfalls durch ihre bräunliche Färbung hervortretende Zacken. Dieselben sind dreieckig, mit sc ag
nach außen gewandten Enden. Da sie etwas dorsalwärts eingebögen sind, finden sie bei einem Druck
gegen den Rücken leichter Halt. Flankiert sind sie beiderseits durch Sinneshaare. Außerdem ist das
Chitin um den Anus herum etwas verdickt, was nicht unwesentlich zur Versteifung des Hinterrandes
beiträgt.