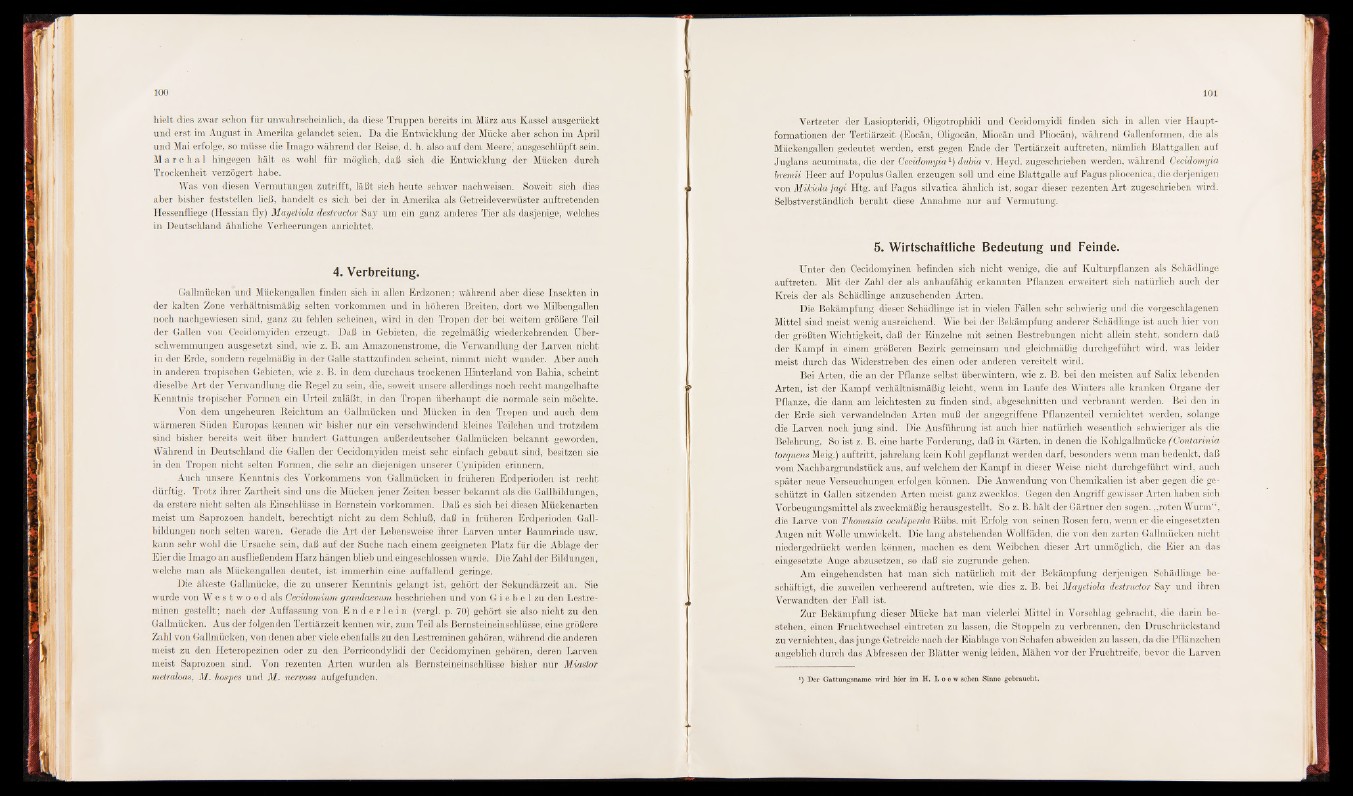
hielt dies zwar schon für unwahrscheinlich, da diese Truppen bereits im März aus Kassel ausgerückt
und erst im August in Amerika gelandet seien. Da die Entwicklung der Mücke aber schon im April
und Mai erfolge, so müsse die Imago während der Reise, d. h. also auf dem Meere, ausgeschlüpft sein.
M a r c h a 1 hingegen hält es wohl für möglich, daß sich die Entwicklung der Mücken durch
Trockenheit verzögert habe.
Was von diesen Vermutungen zutrifft, läßt sich heute schwer nachweisen. Soweit sich dies
aber bisher feststellen ließ, handelt es sich bei der in Amerika als Getreideverwüster auftretenden
Hessenfliege (Hessian fly) Mayetiola destructor Say um ein ganz anderes Tier als dasjenige, welches
in Deutschland ähnliche Verheerungen anrichtet.
4. Verbreitung.
Gallmücken und Mückengallen finden sich in allen Erdzonen; während aber diese Insekten in
der kalten Zone verhältnismäßig selten Vorkommen und in höheren Breiten, dort wo Milbengallen
noch nachgewiesen sind, ganz zu fehlen scheinen, wird in den Tropen der bei weitem größere Teil
der Gallen von Cecidomyiden erzeugt. Daß in Gebieten, die regelmäßig wiederkehrenden Überschwemmungen
ausgesetzt sind, wie z. B. am Amazonenstrome, die Verwandlung der Larven nicht
in der Erde, sondern regelmäßig in der Galle stattzufinden scheint, nimmt nicht wunder. Aber auch
in anderen tropischen Gebieten, wie z. B. in dem durchaus trockenen Hinterland von Bahia, scheint
dieselbe Art der Verwandlung die Regel zu sein, die, soweit unsere allerdings noch recht mangelhafte
Kenntnis tropischer Formen ein Urteil zuläßt, in den Tropen überhaupt die normale sein möchte.
Von dem ungeheuren Reichtum an Gallmücken und Mücken in den Tropen und auch dem
wärmeren Süden Europas kennen wir bisher nur ein verschwindend kleines Teilchen und trotzdem
sind bisher bereits weit über hundert Gattungen außerdeutscher Gallmücken bekannt geworden.
Während in Deutschland die Gallen der Cecidomyiden meist sehr einfach gebaut sind, besitzen sie
in den Tropen nicht selten Formen, die sehr an diejenigen unserer Cynipiden erinnern.
Auch unsere Kenntnis des Vorkommens von Gallmücken in früheren Erdperioden ist recht
dürftig. Trotz ihrer Zartheit sind uns die Mücken jener Zeiten besser bekannt als die Gailbildungen,
da erstere nicht selten als Einschlüsse in Bernstein Vorkommen. Daß es sich bei diesen Mückenarten
meist um Saprozoen handelt, berechtigt nicht zu dem Schluß, daß in früheren Erdperioden Gall-
bildungen noch selten waren. Gerade die Art der Lebensweise ihrer Larven unter Baumrinde usw.
kann sehr wohl die Ursache sein, daß auf der Suche nach einem geeigneten Platz für die Ablage der
Eier die Imago an ausfließendem Harz hängen blieb und eingeschlossen wurde. Die Zahl der Bildungen,
welche man als Mückengallen deutet, ist immerhin eine auffallend geringe.
Die älteste Gallmücke, die zu unserer Kenntnis gelangt ist, gehört der Sekundärzeit an. Sie
wurde von W e s t w o o d als Cecidomium grandaevum beschrieben und von G i e b e 1 zu den Lestre-
minen gestellt; nach der Auffassung von E n d e r l e i n (vergl. p. 70) gehört sie also nicht zu den
Gallmücken. Aus der folgenden Tertiärzeit kennen wir, zum Teil als Bernsteineinschlüsse, eine größere
Zahl von Gallmücken, von denen aber viele ebenfalls zu den Lestreminen gehören, während die anderen
meist zu den Heteropezinen oder zu den Porricondylidi der Cecidomyinen gehören, deren Larven
meist Saprozoen sind. Von rezenten Arten wurden als Bernsteineinschlüsse bisher nur Miastor
metraloas, M. hospes und M. nervosa auf gefunden.
Vertreter der Lasiopteridi, Oligotrophidi und Cecidomyidi finden sich in allen vier Hauptformationen
der Tertiärzeit (Eocän, Oligocän, Miocän und Pliocän), während Gallenformen, die als
Mückengallen gedeutet werden, erst gegen Ende der Tertiärzeit auftreten, nämlich Blattgallen auf
Juglans acuminata, die der Cecidomyiax) dubia v. Heyd. zugeschrieben werden, während Cecidomyia
bremii Heer auf Populus Gallen erzeugen soll und eine Blattgalle auf Fagus pliocenica, die derjenigen
von Mikiola fagi Htg. auf Fagus silvática ähnlich ist, sogar dieser rezenten Art zugeschrieben wird.
Selbstverständlich beruht diese Annahme nur auf Vermutung.
5. Wirtschaftliche Bedeutung und Feinde.
Unter den Cecidomyinen befinden sich nicht wenige, die auf Kulturpflanzen als Schädlinge
auftreten. Mit der Zahl der als anbaufähig erkannten Pflanzen erweitert sich natürlich auch der
Kreis der als Schädlinge anzusehenden Arten.
Die Bekämpfung dieser Schädlinge ist in vielen Fällen sehr schwierig und die vorgeschlagenen
Mittel sind meist wenig ausreichend. Wie bei der Bekämpfung anderer Schädlinge ist auch hier von
der größten Wichtigkeit, daß der Einzelne mit seinen Bestrebungen nicht allein steht, sondern daß
der Kampf in einem größeren Bezirk gemeinsam und gleichmäßig durchgeführt wird, was leider
meist durch das Widerstreben des einen oder anderen vereitelt wird.
Bei Arten, die an der Pflanze selbst überwintern, wie z. B. bei den meisten auf Salix lebenden
Arten, ist der Kampf verhältnismäßig leicht, wenn im Laufe des Winters alle kranken Organe der
Pflanze, die dann am leichtesten zu finden sind, abgeschnitten und verbrannt werden. Bei den in
der Erde sich verwandelnden Arten muß der angegriffene Pflanzenteil vernichtet werden, solange
die Larven noch jung sind. Die Ausführung ist auch hier natürlich wesentlich schwieriger als die
Belehrung. So ist z. B. eine harte Forderung, daß in Gärten, in denen die Kohlgailmücke (Contarinia
torquens Meig.) auftritt, jahrelang kein Kohl gepflanzt werden darf, besonders wenn man bedenkt, daß
vom Nachbargrundstück aus, auf welchem der Kampf in dieser Weise nicht durchgeführt wird, auch
später neue Verseuchungen erfolgen können. Die Anwendung von Chemikalien ist aber gegen die geschützt
in Gallen sitzenden Arten meist ganz zwecklos. Gegen den Angriff gewisser Arten haben sich
Vorbeugungsmittel als zweckmäßig herausgestellt. So z. B. hält der Gärtner den sogen, „roten Wurm“ ,
die Larve von Thomasia oculiperda Rübs. mit Erfolg von seinen Rosen fern, wenn er die eingesetzten
Augen mit Wolle umwickelt. Die lang abstehenden Wollfäden, die von den zarten Gallmücken nicht
niedergedrückt werden können, machen es dem Weibchen dieser Art unmöglich, die Eier an das
eingesetzte Auge abzusetzen, so daß sie zugrunde gehen.
Am eingehendsten hat man sich natürlich mit der Bekämpfung derjenigen Schädlinge beschäftigt,
die zuweilen verheerend auftreten, wie dies z. B. bei Mayetiola destructor Say und ihren
Verwandten der Fall ist.
Zur Bekämpfung dieser Mücke hat man vielerlei Mittel in Vorschlag gebracht, die darin bestehen,
einen Fruchtwechsel eintreten zu lassen, die Stoppeln zu verbrennen, den Druschrückstand
zu vernichten, das junge Getreide nach der Eiablage von Schafen ab weiden zu lassen, da die Pflänzchen
angeblich durch das Abfressen der Blätter wenig leiden, Mähen vor der Fruchtreife, bevor die Larven
') Der Gattungsname wird hier im H. L o e w sehen Sinne gebraucht.