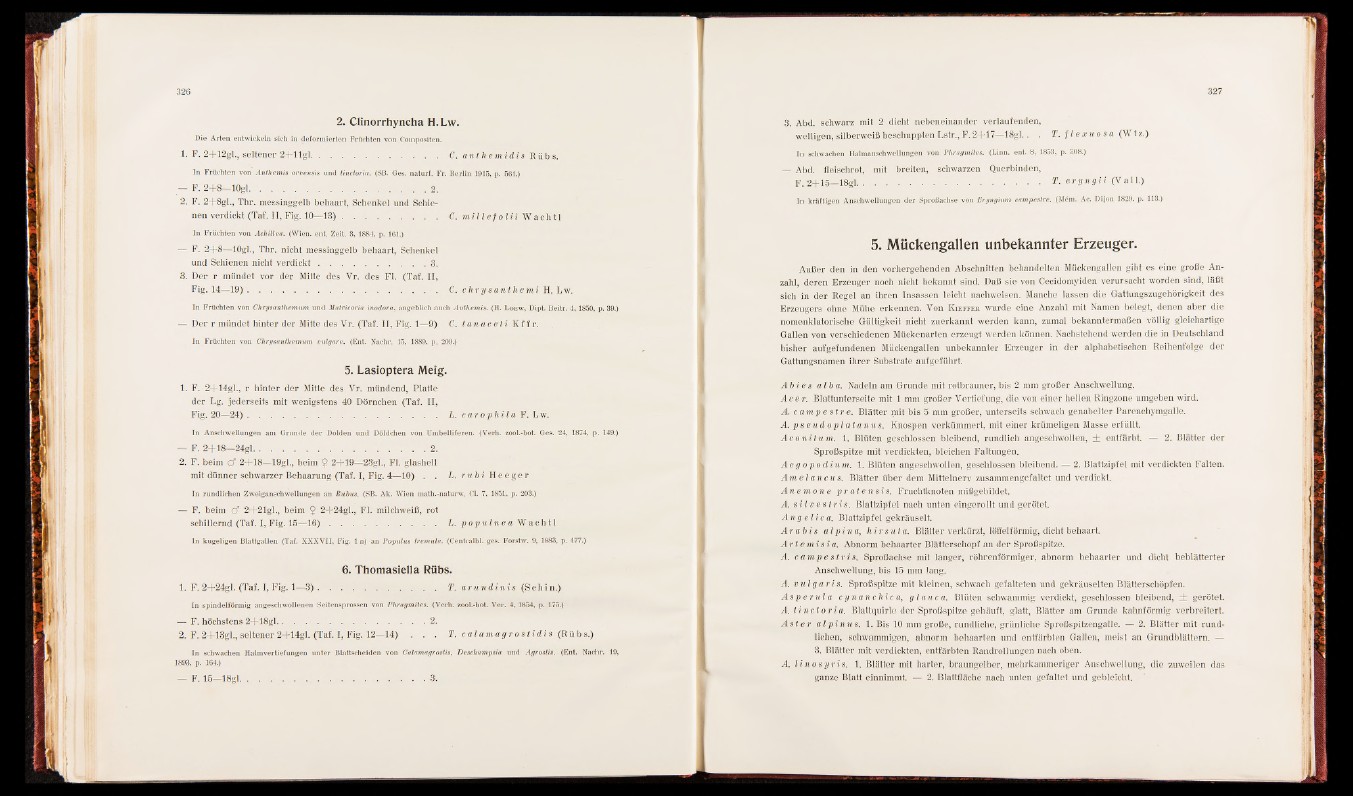
2. Clinorrhyncha H. Lw.
Die Arten entwickeln sich in deformierten Früchten von Compositen.
1. F. 2+12gl., seltener 2 + llg l.......................................................C. a n t h emi d i s Rübs. ■
In Früchten von Anthemis arvensis und tinctoria. (SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1915, p. 561.)
— F. 2+8—lOgl......................................................................... 2.
2. F. 2+8gl., Thr. messinggelb behaart, Schenkel und Schienen
verdickt (Taf. II, Fig. 10—13) . . . ....................... C. m j i i e / o h ' i Wa c h t l
In Früchten von Achillea. (Wien. ent. Zeit. 3, 1884, p. 161.)
— F. 2+8—10gl., Thr. nicht messinggelb behaart, Schenkel
und Schienen nicht v e rd ic k t............................................. 3.
3. Der r mündet vor der Mitte des Vr. des Fl. (Taf. II,
Fig. 14—19 ).............................................................................G. chry s a n t h emi H. Lw.
In Früchten von Chrysanthemum und Matricaria inodora, angeblich auch Anthemis. (H. L o ew , Dipt. Beitr. 4,1850, p. 39.)
¡¡i- Der r mündet hinter der Mitte des Vr. (Taf. II, Fig. 1—9) G. t anac e t i Kf fr .
In Früchten von Chrysanthemum vulgare. (Ent. Nachr. 15, 1889, p. 209.)
5. L a s io p te ra Meig.
1. F. 2+14gl., r hinter der Mitte des Vr. mündend, Platte
der Lg. jederseits mit wenigstens 40 Dörnchen (Taf. II,
Fig. 20—2 4 )...........................................................................L. c a r o p / i i i a F. Lw.
In Anschwellungen am Grunde der Dolden und Döldchen von Umbelliferen. (Verh. zool.-bot. Ges. 24, 1874, p. 149.)
— F. 2+18—24gl........................................................................2.
2. F. beim cf 2+18—19gl., beim $ 2+19—23gl., Fl. glashell
mit dünner schwarzer Behaarung (Taf. I, Fig. 4—10) . . L. rubi He e g e r
In rundlichen Zweiganschwellungen an Rubus. (SB. Ak. Wien math.-naturw. CI. 7, 1851, p. 203.)
+ F. beim cf 2+21gl., beim $ 2+24gl., Fl. milchweiß, rot
schillernd (Taf. I, Fig. 15—1 6 ) ..........................................L. p o p u l n e a acht l
In kugeligen Blattgallen (Taf. XXXVII, Fig. 1 n) an Popülus tremula. (Centralbl. ges. Forstw. 9, 1883, p. 477.)
6. Thomasiella Rübs.
1. F. 2+24gl. (Taf. I, Fig. 1—3 ) .................................................... T. ar u n d i n i s (Schin.)
In spindelförmig angeschwollenen Seitensprossen von Phragmites. (Verh. zool.-bot. Ver. 4, 1854, p. 175.)
F. höchstens 2+18gl. ..........................................2.
2. F. 2+13gl., seltener 2 +Mgl. (Taf. I, Fig. 12—14) . . . T. cal amagr o s t idi s (Rübs.)
In schwachen Halmvertiefungen unter Blattscheiden von Calamagrostis, Deschampsia und Agrostis. (Ent. Nachr. 19,
1893, p. 164.)
3. Abd. schwarz mit 2 dicht nebeneinander verlaufenden,
welligen, silberweiß beschuppten Lstr., F. 2+17—18gl.. . T. f l e x u o s a (Wtz.)
In schwachen Halmanschwellungen von Phragmites. (Linn. ent. 8, 1853, p. 308.)
— Abd. fleischrot, mit breiten, schwarzen Querbinden,
F. 2+15—18gl............................................................................T. e r yn gi i (Vall.)
In kräftigen Anschwellungen der Sproßachse von Eryngium campeslre. (Mem. Ac. Dijon 1829, p. 113.)
5. Mückengallen unbekannter Erzeuger.
Außer den in den vorhergehenden Abschnitten behandelten Mückengallen gibt es eine große Anzahl,
deren Erzeuger noch nicht bekannt sind. Daß sie von Cecidomyiden verursacht worden sind, läßt
sich in der Regel an ihren Insassen leicht nachweisen. Manche lassen die Gattungszugehörigkeit des
Erzeugers ohne Mühe erkennen. Von K i e f f e r wurde eine Anzahl mit Namen belegt, denen aber die
nomenklatorische Gültigkeit nicht zuerkannt werden kann, zumal bekanntermaßen völlig gleichartige
Gallen von verschiedenen Mückenarten erzeugt werden können. Nachstehend werden die in Deutschland
bisher aufgefundenen Mückengallen unbekannter Erzeuger in der alphabetischen Reihenfolge der
Gattungsnamen ihrer Substrate aufgeführt.
Abi es alb a. Nadeln am Grunde mit rotbrauner, bis 2 mm großer Anschwellung.
Acer. Blattunterseite mit 1 mm großer Vertiefung, die von einer hellen Ringzone umgeben wird.
A. camp e s t r e. Blätter mit bis 5 mm großer, unterseits schwach genabelter Parenchymgalle.
A. ps eu dop l at anu s . Knospen verkümmert, mit einer krümeligen Masse erfüllt.
Aconi tum, 1. Blüten geschlossen bleibend, rundlich angeschwollen, + entfärbt. — 2. Blätter der
Sproßspitze mit verdickten, bleichen Faltungen.
Aegopodi um. 1. Blüten angeschwollen, geschlossen bleibend. — 2. Blattzipfel mit verdickten Falten.
Amel ancus . Blätter über dem Mittelnerv zusammengefaltet und verdickt.
A nemo n e prat ens i s . Fruchtknoten mißgebildet.
A. s i l v estris. Blattzipfel nach unten eingerollt und gerötet.
Ang el ica. Blattzipfel gekräuselt.
Ar ab is alpin a, hi r suta. Blätter verkürzt, löffelförmig, dicht behaart.
Ar t emi s i a. Abnorm behaarter Blätterschopf an der Sproßspitze.
A. campe stris. Sproßachse mit langer, röhrenförmiger, abnorm behaarter und dicht beblätterter
Anschwellung, bis 15 mm lang.
A. vulgar i s . Sproßspitze mit kleinen, schwach gefalteten und gekräuselten Blätterschöpfen.
As p er ul a Gynanchica, gl au ca. Blüten schwammig verdickt, geschlossen bleibend, + gerötet.
A. t inctoria. Blattquirle der Sproßspitze gehäuft, glatt, Blätter am Grunde kahnförmig verbreitert.
As t e r alpinus . 1. Bis 10 mm große, rundliche, grünliche Sproßspitzengalle. — 2. Blätter mit rundlichen,
schwammigen, abnorm behaarten und entfärbten Gallen, meist an Grundblättern, p p
3. Blätter mit verdickten, entfärbten Randrollungen nach oben.
A. l inosyr i s . 1. Blätter mit harter, braungelber, mehrkammeriger Anschwellung, die zuweilen das
ganze Blatt einnimmt. — 2. Blattfläche nach unten gefaltet und gebleicht.