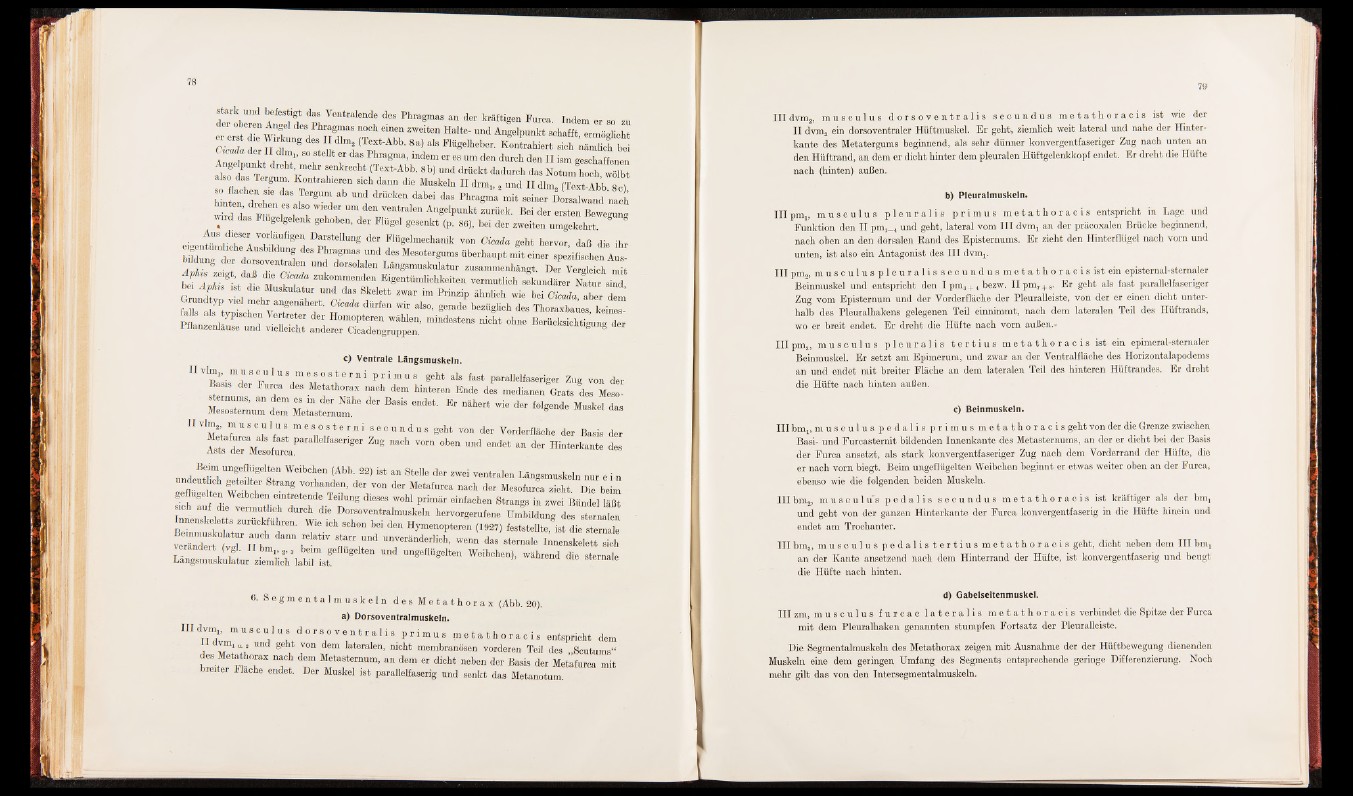
stark und befestigt das Ventralende des Phragmas an der kräftigen Furca. Tn d ^ er s0 zu
der oberen Angel des Phragmas noch einen zweiten Halte- und Angelpunkt schafft ermöglicht
f l f l l 8a) ak H i Kontrahiert sich nämlich bei
ada t e l l d H , so stellt er das Phragma, mdem er es um den durch den II ism geschaffenen
H f l H l H l (TeXt'Abb- 8b> I f l ^duxch das Notum hoch, wölbt
so flach ü ^ ° ntraluerei1 slcb dann 1 Muskeln I I drm1; H und I I dlm2 (Text-Abb 8 c)
so flachen sie das Tergum ab und drücken dabei das Phragma mit seiner Dorsalwand nach
B H 1 I H wird das Flugelgelenk gehobe nU,m d der6 nF lVüegnetlr aglees“e Bnkt (p. 8l6), b ei der zwBeaiit edn« u Wmgekehrt.
■ m | B Erstellung der Flügelmechanik von Cicada geht hervor daß die ihr
bM u T d !l m d6S Phragmas und des H B i überhaupt mit einer spezifischen Ausbildung
der dorsoventralen und dorsolalen Längsmuskulatur zusammenhängt. Der Vergleich mit
■ H | ■ ■ zukommenden Eigentümlichkeiten vermutlich sekundärer Natur sind
B B B H I S Ü H i Und I Skelett zwar K B ähnlich wie bei Cicada, aber dem
falls I a^enahert. Cicada dürfen wir also, gerade bezüglich des Thoraxbaues keines-
B H H I H H°m°Pteren wählen, mindestens nicht ohne Berücksichtigung der
Pflanzenlause und vielleicht anderer CScadengruppen. ; \ . ^ Igung aer
c) Ventrale Längsmuskeln.
Ilvlm,, mus c u l u i s m e s o s t e r n i p r im u s geht als fast parallelfaseriger Zug von der
Basis der Furca des Metathorax nach dem hinteren Ende des medianen Grats des Meso- E r an fm 11 Nähe der Basis endet Er näwt I der f°igende Muske*I Mesosternum dem Metasternum.
I H “ USC“ s+ meB B ‘ » n i s e c u n d u s g e h t von der Vorderfläche der Basis der
^ ^ S r M l w ' Zug ^ ™ °b» - d an der Hinterkante des
und H B H WeibcbeI1 <Abb' 22) I an Stelle der zwei ventralen Längsmuskeln nur e i n
undeuthch getedter Strang vorhanden, der von der Metafurca nach der Mesofurca zieht Die beim
geflügelten Weibchen eintretende Teilung dieses wohl primär einfachen Strangs in zwei Bündel läßt
sich auf die vermutlich durch die Dorsoventralmuskeln hervorgerufene Umbildung des sternalen
nnens e e s zuruckfiihren. Wie ich schon bei den Hymenopteren (1927) feststellte, ist die sterhale
f l f l f l f l unveränderhch, wenn das sternale Innenskelett sich
Längsmuskulatur ^ ^ ^ f l f l I UngeflÜgelto Weibchen), während die s t e r n a l l j
. b e g m e n t a l m u s k e l n d e s M e t a t h o r a x (Abb. 2 0 ).
a) Dorsoventralmuskeln.
III dvm,, m u s c u l u s d o r s o v e n t r a l i s p r i m u s m e t a t h o r a c i s entspricht dem
a I v b H Un g V°n lateralen, nicht membranösen vorderen Teil des „Scutums“
des Metathorax nach dem Metasternum, an dem er dicht neben der Basis der Metafurca mit
breiter Flache endet. Der Muskel ist parallelfaserig nnd senkt das Metanotum.
I II dvm2, m u s c u l u s d o r s o v e n t r a l i s s e c u n d u s m e t a t h o r a c i s ist wie der
II dvm3 ein dorsoventraler Hüftmuskel. Er geht, ziemlich weit lateral und nahe der Hinterkante
des Metatergums beginnend, als sehr dünner konvergentfaseriger Zug nach unten an
den Hüftrand, an dem er dicht hinter dem pleuralen Hüftgelenkkopf endet. Er dreht die Hüfte
nach (hinten) außen.
b) Pleuralmuskeln.
I II pm1} m u s c u l u s p l e u r a l i s p r i m u s m e t a t h o r a c i s entspricht in Lage und
Funktion den I I p m ^ und geht, lateral vom I II dvmx an der präcoxalen Brücke beginnend,
nach oben an den dorsalen Rand des Episternums. Er zieht den Hinterflügel nach vorn und
unten, ist also ein Antagonist des I II dvmx.
I II pm2, m u s c u l u s p l e u r a l i s s e c u n d u s m e t a t h o r a c i s i s t e i n episternal-sternaler
Beinmuskel und entspricht den Ipm 3+4bezw. I Ipm 7 + 8. Er geht als fast parallelfaseriger
Zug vom Episternum und der Vorderfläche der Pleuralleiste, von der er einen dicht unterhalb
des Pleuralhakens gelegenen Teil einnimmt, nach dem lateralen Teil des Hüftrands,
wo er breit endet. Er dreht die Hüfte nach vorn außen.*
IIIpm 3, m u s c u l u s p l e u r a l i s t e r t i u s m e t a t h o r a c i s ist ein epimeral-sternaler
Beinmuskel. Er setzt am Epimerum, und zwar an der Ventralfläche des Horizontalapodems
an und endet mit breiter Fläche an dem lateralen Teil des hinteren Hüftrandes. Er dreht
die Hüfte nach hinten außen.
c) Beinmuskeln.
I II bmlf m u s c u l u s p e d a l i s p r i m u s m e t a t h o r a c i s geht von der die Grenze zwischen
Basi- und Furcasternit bildenden Innenkante des Metasternums, an der er dicht bei der Basis
der Furca ansetzt, als stark konvergentfaseriger Zug nach dem Vorderrand der Hüfte, die
er nach vorn biegt. Beim ungeflügelten Weibchen beginnt er etwas weiter oben an der Furca,
ebenso wie die folgenden beiden Muskeln.
I I Ibm 2, m u s c u l u s p e d a l i s s e c u n d u s m e t a t h o r a c i s ist kräftiger als der bn^
und geht von der ganzen Hinterkante der Furca konvergentfaserig in die Hüfte hinein und
endet am Trochanter.
I II bm3, m u s c u l u s p e d a l i s t e r t i u s m e t a t h o r a c i s geht, dicht neben dem I II bmx
an der Kante ansetzend nach dem Hinterrand der Hüfte, ist konvergentfaserig und beugt
die Hüfte nach hinten.
d) Gabelseitenmuskel.
I II zm, m u s c u l u s f u r c a e l a t e r a l i s m e t a t h o r a c i s verbindet die Spitze der Furca
mit dem Pleuralhaken genannten stumpfen Fortsatz der Pleuralleiste.
Die Segmentalmuskeln des Metathorax zeigen mit Ausnahme der der Hüftbewegung dienenden
Muskeln eine dem geringen Umfang des Segments entsprechende geringe Differenzierung. Noch
mehr gilt das von den Intersegmentalmuskeln.