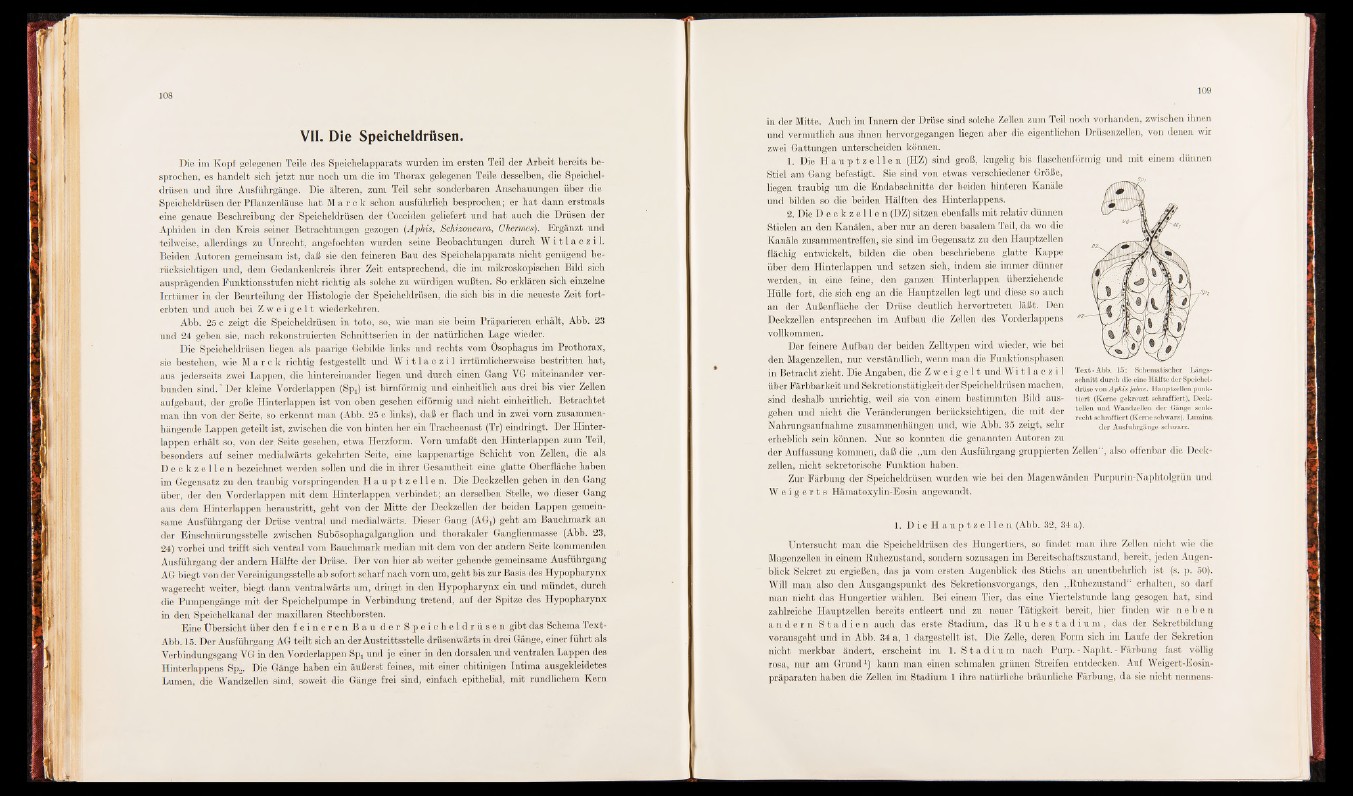
VII. Die Speicheldrüsen.
Die im Kopf gelegenen Teile des Speichelapparats wurden im ersten Teil der Arbeit bereits besprochen,
es handelt sich jetzt nur noch um die im Thorax gelegenen Teile desselben, die Speicheldrüsen
und ihre Ausführgänge. Die älteren, zum Teil sehr sonderbaren Anschauungen über die
Speicheldrüsen der Pflanzenläuse hat M a r e k schon ausführlich besprochen; er h a t dann erstmals
eine genaue Beschreibung der Speicheldrüsen der Cocciden geliefert und hat auch die Drüsen der
Aphiden in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen {Aphis, Schizoneura, Ghermes). Ergänzt und
teilweise, allerdings zu Unrecht, angefochten wurden seine Beobachtungen durch W i t l a c z i l .
Beiden Autoren gemeinsam ist, daß sie den feineren Bau des Speichelapparats nicht genügend berücksichtigen
und, dem Gedankenkreis ihrer Zeit entsprechend, die im mikroskopischen Bild sich
ausprägenden Funktionsstufen nicht richtig als solche zu würdigen wußten. So erklären sich einzelne
Irrtümer in der Beurteilung der Histologie der Speicheldrüsen, die sich bis in die neueste Zeit forterbten
und auch bei Z w e i g e l t wiederkehren.
Abb. 25 c zeigt die Speicheldrüsen in toto, so, wie man sie beim Präparieren erhält, Abb. 23
und 24 geben sie, nach rekonstruierten Schnittserien in der natürlichen Lage wieder.
Die Speicheldrüsen liegen als paarige Gebilde links und rechts vom Ösophagus im Prothorax,
sie bestehen, wie M a r e k richtig festgestellt und W i t l a c z i l irrtümlicherweise bestritten hat,
aus jederseits zwei Lappen, die hintereinander liegen und durch einen Gang VG miteinander verbunden
sind. "Der kleine Yorderlappen (Spx) ist birnförmig und einheitlich aus drei bis vier Zellen
aufgebaut, der große Hinterlappen ist von oben gesehen eiförmig und nicht einheitlich. Betrachtet
man ihn von der Seite, so erkennt man (Abb. 25 c links), daß er flach und in zwei vorn zusammenhängende
Lappen geteilt ist, zwischen die von hinten her ein Tracheenast (Tr) eindringt. Der Hinterlappen
erhält so, von der Seite gesehen, etwa Herzform. Yorn umfaßt den Hinterlappen zum Teil,
besonders auf seiner medialwärts gekehrten Seite, eine kappenartige Schicht von Zellen, die als
D e c k z e l l e n bezeichnet werden sollen und die in ihrer Gesamtheit eine glatte Oberfläche haben
im Gegensatz zu den traubig vorspringenden H a u p t z e l l e n . Die Deckzellen gehen in den Gang
über, der den Vorderlappen mit dem Hinterlappen verbindet; an derselben Stelle, wo dieser Gang
aus dem Hinterlappen heraustritt, geht von der Mitte der Deckzellen der beiden Lappen gemeinsame
Ausführgang der Drüse ventral und medialwärts. Dieser Gang (AGj) geht am Bauchmark an
der Einschnürungsstelle zwischen Subösophagalganglion und thorakaler Ganglienmasse (Abb. 23,
24) vorbei und trifft sich ventral vom Bauchmark median mit dem von der ändern Seite kommenden
Ausführgang der ändern Hälfte der Drüse. Der von hier ab weiter gehende gemeinsame Ausführgang
AG biegt von der Vereinigungsstelle ab sofort scharf nach vorn um, geht bis zur Basis des Hypopharynx
wagerecht weiter, biegt dann ventralwärts um, dringt in den Hypopharynx ein und mündet, durch
die Pumpengänge mit der Speichelpumpe in Verbindung tretend, auf der Spitze des Hypopharynx
in den Speichelkanal der maxillaren Stechborsten.
Eine Übersicht über den f e i n e r e n B a u d e r S p e i c h e l d r ü s e n gibt das Schema Texb-
Abb. 15. Der Ausführgang AG teilt sich an der Austrittsstelle drüsenwärts in drei Gänge, einer führt als
Verbindungsgang VG in den Vorderlappen Spx und je einer in den dorsalen und ventralen Lappen des
Hinterlappens Sp2. Die Gänge haben ein äußerst feines, mit einer chitinigen Intima ausgekleidetes
Lumen, die Wandzellen sind, soweit die Gänge frei sind, einfach epithelial, mit rundlichem Kern
in der Mitte. Auch im Innern der Drüse sind solche Zellen zum Teil noch vorhanden, zwischen ihnen
und vermutlich aus ihnen hervorgegangen liegen aber die eigentlichen Drüsenzellen, von denen wir
zwei Gattungen unterscheiden können.
1. Die H a u p t z e l l e n (HZ) sind groß, kugelig bis flaschenförmig und mit einem dünnen
Stiel am Gang befestigt. Sie sind von etwas verschiedener Größe,
liegen traubig um die Endabschnitte der beiden hinteren Kanäle
und bilden so die beiden Hälften des Hinterlappens.
2. Die D e c k z e l l e n (DZ) sitzen ebenfalls mit relativ dünnen
Stielen an den Kanälen, aber nur an deren basalem Teil, da wo die
Kanäle Zusammentreffen, sie sind im Gegensatz zu den Hauptzellen
flächig entwickelt, bilden die oben beschriebene glatte Kappe
über dem Hinterlappen und setzen sich, indem sie immer dünner
werden, in eine feine, den ganzen Hinterlappen überziehende
Hülle fort, die sich eng an die Hauptzellen legt und diese so auch
an der Außenfläche der Drüse deutlich hervortreten läßt. Den
Deckzellen entsprechen im Aufbau die Zellen des Vorderlappens
vollkommen.
Der feinere Aufbau der beiden Zelltypen wird wieder, wie bei
den Magenzellen, nur verständlich, wenn man die Funktionsphasen
in Betracht zieht. Die Angaben, die Z w e i g e l t und W i t l a c z i l
über Färbbarkeit und Sekretionstätigkeit der Speicheldrüsen machen,
sind deshalb unrichtig, weil sie von einem bestimmten Bild ausgehen
und nicht die Veränderungen berücksichtigen, die mit der
Nahrungsaufnahme Zusammenhängen und, wie Abb. 35 zeigt, sehr
erheblich sein können. Nur so konnten die genannten Autoren zu
der Auffassung kommen, daß die „um den Ausführgang gruppierten Zellen“ , also offenbar die Deckzellen,
nicht sekretorische Funktion haben.
Zur Färbung der Speicheldrüsen wurden wie bei den Magenwänden Purpurin-Naphtolgrün und
W e i g e r t s Hämatoxylin-Eosin angewandt.
Text-Abb. 15: Schematischer Längsschnitt
durch die eine Hälfte der Speicheldrüse
von Aphis fdbae. Hauptzellen punktiert
(Kerne gekreuzt schraffiert), Decktellen
und Wandzellen der Gänge senkrecht
schraffiert (Kerne schwarz). Lumina
der Ausfuhrgänge schwarz.
1. D i e H a u p t z e l l e n (Abb. 32, 34 a).
Untersucht man die Speicheldrüsen des Hungertiers, so findet man ihre Zellen nicht wie die
Magenzellen in einem Ruhezustand, sondern sozusagen im Bereitschaftszustand, bereit, jeden Augenblick
Sekret zu ergießen, das ja vom ersten Augenblick des Stichs an unentbehrlich ist (s. p. 50).
Will man also den Ausgangspunkt des Sekretionsvorgangs, den „Ruhezustand“ erhalten, so darf
man nicht das Hungertier wählen. Bei einem Tier, das eine Viertelstunde lang gesogen hat, sind
zahlreiche Hauptzellen bereits entleert und zu neuer Tätigkeit bereit, hier finden wir n e b e n
ä n d e r n S t a d i e n auch das erste Stadium, das R u h e S t a d i u m , das der Sekretbildung
vorausgeht und in Abb. 34 a, 1 dargestellt ist. Die Zelle, deren Form sich im Laufe der Sekretion
nicht merkbar ändert, erscheint im 1. S t a d i u m nach Purp. - Napht. - Färbung fast völlig
rosa, nur am Grund1) kann man einen schmalen grünen Streifen entdecken. Auf Weigert-Eosin-
präparaten haben die Zellen im Stadium 1 ihre natürliche bräunliche Färbung, da sie nicht nennens