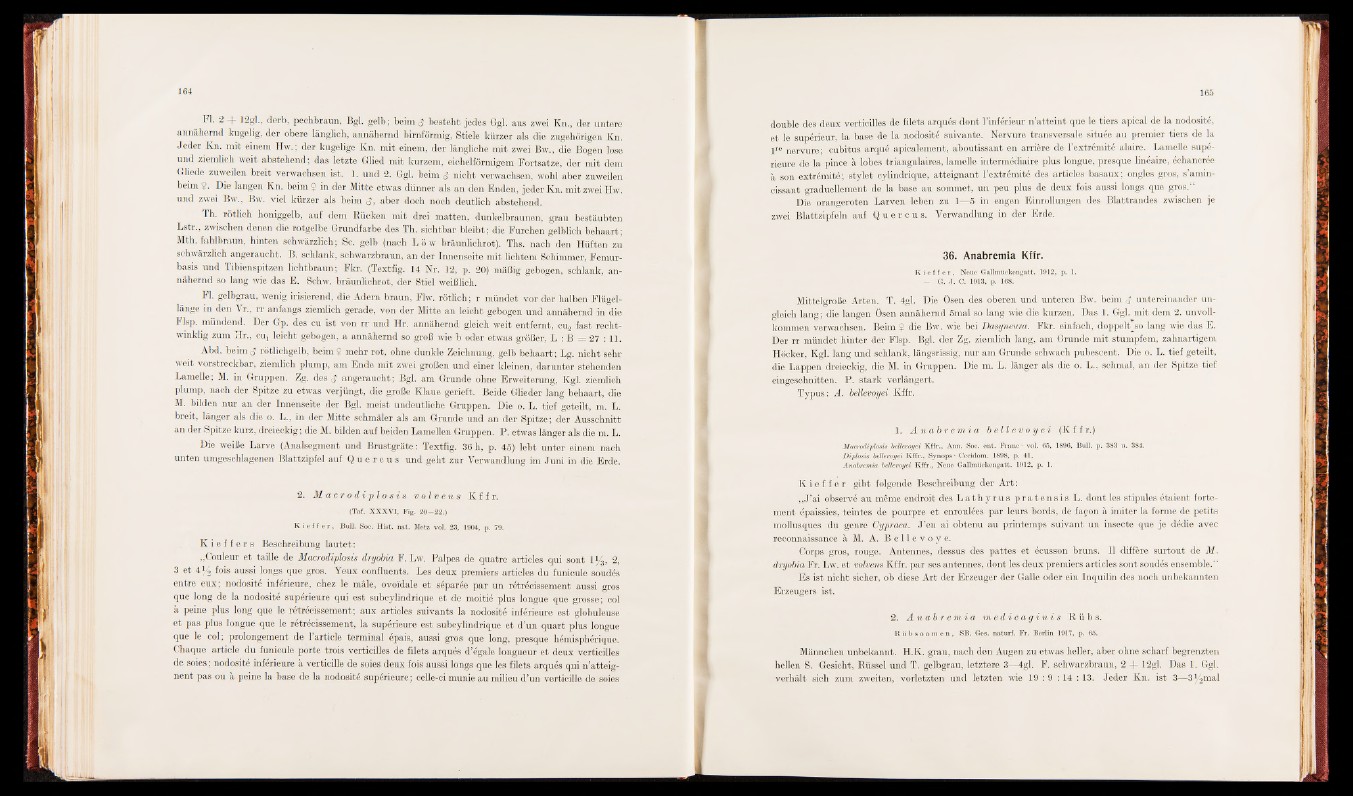
derb, pechbraun, Bgl. gelb; heim ,? bestellt jedes Ggl. aus zwei Kn., der untere
annähernd kugelig, der obere länglich, annähernd bimförmig, Stiele kürzer als die zugehörigen Kn.
Jeder Kn. mit einem Hw.; der kugelige Kn. mit einem, der längliche mit zwei Bw., die Bogen lose
und ziemlich weit abstehend; das letzte Glied mit kurzem, eichelförmigem Fortsatze, der mit dem
Gliede zuweilen breit verwachsen ist. 1. und 2. Ggl. beim £ -nicht verwachsen, wohl aber zuweilen
beim 9. Die langen Kn. beim 9 in der Mitte etwas dünner als an den Enden, jeder Kn. mit zwei Hw.
und zwei Bw., Bw. viel kürzer als beim $, aber doch noch deutlich abstehend.
Th. rötlich honiggelb, auf dem Rücken mit drei matten, dunkelbraunen, grau bestäubten
Lstr., zwischen denen die rotgelbe (Grundfarbe des Th. sichtbar bleibt; die Furchen gelblich behaart;
Mth. fahlbraun, hinten schwärzlich; Sc. gelb (nach L ö w bräunlichrot). Ths. nach den Hüften zu
schwärzlich angeraucht. B. schlank, schwarzbraun, an der Innenseite mit lichtem Schimmer, Femurbasis
und Tibienspitzen lichtbraun; Fkr. (Textfig. 14 Nr. 12, p. 20) mäßig gebogen, schlank, annähernd
so lang wie das E. Schw. bräunlichrot, der Stiel weißlich.
Fl. gëlbgrau, wenig irisierend, die Adern braun, Flw. rötlich; r mündet vor der halben Flügellänge
in den Vr., rr anfangs ziemlich gerade, von der Mitte an leicht gebogen und annähernd in die
Flsp. mündend. Der Gp. des cu ist von rr und Hr. annähernd gleich weit entfernt; ßü3 fast rechtwinklig
zum Hr., cuj leicht gebogen, a annähernd so groß wiefjjiocter etwas größer, L 11.
Abd. beim,? rötlichgelb, beimlBmehr rot, ohne dunkle Zeichnung, gelb behaart; Lg. nicht'sehr
weit vorstreckbar, ziemlich plump, am Ende mit zwei großen und einer kleinen, darunter stehenden
Lamelle, M. in Gruppen. Zg. des <? angeraucht; Bgl. am Grunde ohne Erweiterung, Kgl. ziemlich
plump, nach der Spitze zu etwas verjüngt, die große Klaue gerieft. Beide Glieder lang' behaart, die
M. bilden nur an der Innenseite der Bgl. meist undeutliche Gruppen. Die ö. S f tief geteilt, m. L.
breit, länger als die o. L., in der Mitte schmäler als am Grunde und an der Spitze; der Ausschnitt
an der Spitze kurz, dreieckig; die M. bilden auf beiden Lamellen Gruppen. P. etwas länger als die m. L.
Die weiße. Larve (Analsegment und Brustgräte: Textfig. p. 45) lebt unter einem nach
unten umgeschlagenen Blattzipfel auf Q u e r# äb $ und geht zur Verwandlung im Juni in die Erde.
2. M a c r o d i p l o s i s v o l v e n s Kf f r .
- (Taf. XXXVI, Kg. 20—22;):
K i e f f e r , Bull. Soc. Hist. nat. Metz vol. 23, 1904, p. 79.
K i e f f e r s Beschreibung lautet :
„Couleur et taille de Macrodiplosis dryobia F. Lw. Palpes dé quatre articles qui sont 1%, 2,
3 et 414 fois aussi longs que gros. Yeux confluents. Les deux premiers articles du funicule soudés,
entre eux; nodosité inférieure, chez le mâle, ovoïdale et séparée par un rétrécissement aussi gros
que long de la nodosité supérieure qui est subcylindrique et de moitié plus longue que grosse ; %1
à peine plus long que le rétrécissement; aux articles suivants la nodosité inférieure est globuleuse
et pas plus longue que le rétrécissement, la supérieure est subcylindrique et d’un quart plus longue
que le col; prolongement de l’article terminal épais, aussi gros que long, presque hémisphérique.
Chaque article du funicule porte trois verticilles de filets arqués d’égale longueur et deux verticilles
de soies ; nodosité inférieure à verticille de soies deux fois aussi longs que les filets arqués qui n’atteignent
pas ou a peine la base de la nodosité supérieure ; celle-ci munie au milieu d’un verticille de soies
doublé des deux vertiâBea der|ft#ts arqués dont l’inférieur n’atteint que le tiers apical de la nodosité,
et le supérieur, la basé; âé la nodösÄ suivante. Nervure transversale située au premier tiers de la
l r0 nervureI cubitus arqué apicalement, aboutissant en arrière de l’extrémité alaire. Lamelle supérieure
de la pince à lobés triangulaires, lamelle intermédiaire plus longue, presque linéaire, échancrée
à son extrémité; stylet cylindrique, atteignant l’extrémité des articles basaux; ongles gros, s’amincissant
graduellement de. la base au sommet, un peu plus de deux fois aussi longs que gros.“
Die orangeroten Larveltilsben zu 1—5 in engen Einrollungen des Blattrandes zwischen je
zwei Blattzipfeln auf Q u e S u s . Verwandlung in der Erde.
36. Anabremia Kffr.
Ki e f f e r , Neue Gallmückengatt. 1912, p. 1.
— G. J . G. 1913, p. 168.
Mittelgroße Arten. T. 4gl. Die Ösen des oberen und unteren Bw. beim $ untereinander ungleich
lang; die langen Ösen annähernd 5mal so lang wie die kurzen. Das 1. Ggl. mit dem 2. unvollkommen
verwachsen. Beim ? die Bw. wie bei Dasyneura. Fkr. einfach, doppelt_so lang wie das E.
Der rr mündet hinter der Flsp. Bgl. der Zg. ziemlich lang, am Grunde mit stumpfem, zahnartigem
Höcker, Kgl. lang und schlank, längsrissig, nur am Grunde schwach pubescent. Die o. L. tief geteilt,
die Lappen dreieckig, die M. in Gruppen. Die m. L. länger als die o. L., schmal, an. der Spitze tief
eingeschnitten. P. stark verlängert.
Typus: A. bellevoyei Kffr.
1. A n a b r e m i a b e l l e v o y e i (Kf f r . )
Macrodi-plosis bdlevoyei Kffr., Ann. Soc. ent. Franc ' vol. 65, 1896, Bull. p. 383 u. 384.
Diplosis bdlevoyei Kffr., Synops? Cccidom. 1898, p. 41.
Anabremia bdlevoyei Kffr., Neue GaJlmückengatt. 1912, p. 1.
K i e f f e r gibt folgende Beschreibung der Art :
„ J ’ai observé au même endroit des L a t h y r u s p r a t e n s i s L. dont les stipules étaient fortement
épaissies, teintes de pourpre et enroulées par leurs bords, de façon à imiter la forme de petits
mollusques du genre Cypraea. J ’en ai obtenu au printemps suivant un insecte que je dédie avec
reconnaissance à M. A. B e l l e v o y e .
Corps gros, rouge. Antennes, dessus des pattes et écusson bruns. Il diffère surtout de M.
dryobia Fr. Lw. et volvens Kffr. par ses antennes, dont les deux premiers articles sont soudés ensemble.“
Es ist nicht sicher, ob diese Art der Erzeuger der Galle oder ein Inquilin des noch unbekannten
Erzeugers ist.
2. A n a b r e m i a m e d i c a g i n i s Rü b s .
R ü b s a a m e n , SB. Ges. naturf. Fr. Berlin 1917, p. 65.
Männchen unbekannt. H.K. grau, nach den Augen zu etwas heller, aber ohne scharf begrenzten
hellen S. Gesicht, Rüssel und T. gelbgrau, letztere 3—4gl. F. sehwarzbraun, 2 12gl. Das 1. Ggl.
verhält sich zum zweiten, vorletzten und letzten wie 19 :9 :14 : 13. Jeder Kn. ist 3—3 ^m a l