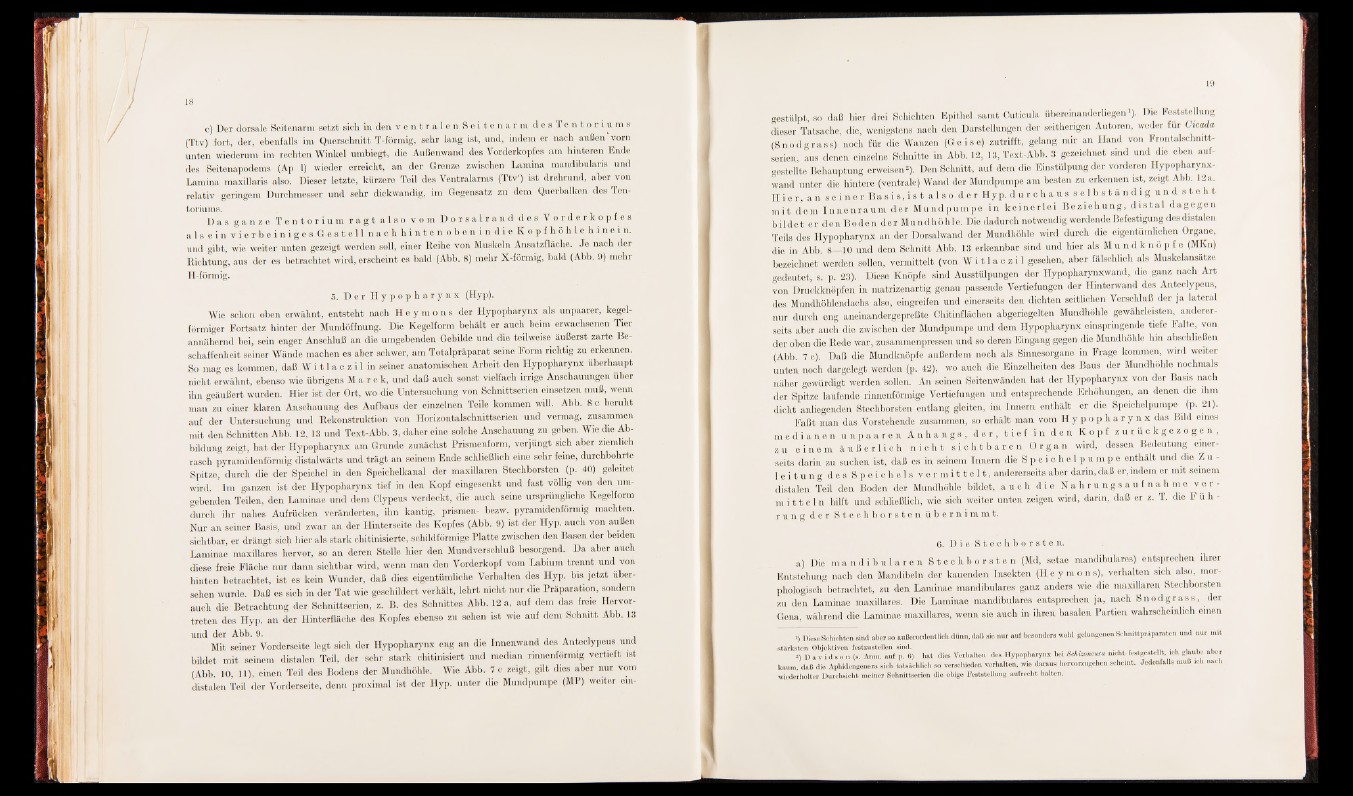
o) Der dorsale Seitenarm setzt sie l in den v e n t r a l e n S e i t e n a r m d e s T e n t o r i u m s
(Ttv) fort, der, ebenfalls im Querschnitt T-förmig, sehr lang ist, und, indem er nach außen‘vom
unten wiederum im rechten Winkel umbiegt, die Außenwand des Vorderkopfes am hinteren Ende
des Seitenapodems (Ap 1) wieder erreicht, an der Grenze zwischen Lamina mandibularis und
T.amina maxillaris also. Dieser letzte, kürzere Teil des Ventralarms (Ttv') ist drehrund, aber von
relativ geringem Durchmesser und sehr dickwandig, im Gegensatz zu dem Querbalken des Ten-
toriums.
D a s g a n z e T e n t o r i u m r a g t a l s o v om D o r s a l r a n d d e s V o r d e r k o p f e s
a l s e i n v i e r b e i n i g e s G e s t e l l n a c h h i n t e n o b e n i n d i e K o p f h ö h l e h i n e i n .
und gibt, wie weiter unten gezeigt werden soll, einer Reihe von Muskeln Ansatzfläche. Je nach der
Richtung, aus der es betrachtet wird, erscheint es bald (Abb. 8) mehr X-förmig, bald (Abb. 9) mehr
H-förmig.
5. D e r H y p o p h a r y n x (Hyp).
Wie schon oben erwähnt, entsteht nach H e y m o n s der Hypopharynx als unpaarer, kegelförmiger
Fortsatz hinter der Mundöffnung. Die Kegelform behält er auch beim erwachsenen Tier
annähernd bei, sein enger Anschluß an die umgebenden Gebilde und die teilweise äußerst zarte Beschaffenheit
seiner Wände machen es aber schwer, am Totalpräparat seine Form richtig zu erkennen.
So mag es kommen, daß W i 1 1 a c z i 1 in seiner anatomischen Arbeit den Hypopharynx überhaupt
nicht erwähnt, ebenso wie übrigens M a r c k, und daß auch sonst vielfach irrige Anschauungen über
ihn geäußert wurden. Hier ist der Ort, wo die Untersuchung von Schnittserien einsetzen muß, wenn
man zu einer klaren Anschauung des Aufhaus der einzelnen Teile kommen will. Abb. 8 c beruht
auf der Untersuchung und Rekonstruktion von Horizontalschnittserien und vermag, zusammen
mit den Schnitten Abb. 12,13 und Text-Abb. 3, daher eine solche Anschauung zu geben. Wie die Abbildung
zeigt, hat der Hypopharynx am Grunde zunächst Prismenform, verjüngt sich aber ziemlich
rasch pyramidenförmig distalwärts und trägt an seinem Ende schließlich eine sehr feine, durchbohrte
Spitze, durch die der Speichel in den Speichelkanal der maxillaren Stechborsten (p. 40) geleitet
wird. ’ Im ganzen ist der Hypopharynx tief in den Kopf eingesenkt und fast völlig von den umgebenden
Teilen, den Laminae und dem Clypeus verdeckt, die auch seine ursprüngliche Kegelform
durch ihr nahes Aufrücken veränderten, ihn kantig, prismen- bezw. pyramidenförmig machten.
Nur an seiner Basis, und zwar an der Hinterseite des Kopfes (Abb. 9) ist der Hyp. auch von außen
sichtbar, er drängt sich hier als stark chitinisierte, schildförmige Platte zwischen den Basen der beiden
Laminae maxillares hervor, so an deren Stelle hier den Mundverschluß besorgend. Da aber auch
diese freie Fläche nur dann sichtbar wird, wenn man den Vorderkopf vom Labium trennt und von
hinten betrachtet, ist es kein Wunder, daß dies eigentümliche Verhalten des Hyp. bis jetzt übersehen
wurde. Daß es sich in der Tat wie geschildert verhält, lehrt nicht nur die Präparation, sondern
auch die Betrachtung der Schnittserien, z. B. des Schnittes Abb. 12 a, auf dem das freie Hervortreten
des Hyp. an der Hinterfläche des Kopfes ebenso zu sehen ist wie auf dem Schnitt Abb. 13
und der Abb. 9.
Mit seiner Vorderseite legt sich der Hypopharynx eng an die Innenwand des Anteclypeus und
bildet mit seinem distalen Teil, der sehr stark chitinisiert und median rinnenförmig vertieft ist
(Abb. 10, 11), einen Teil des Bodens der Mundhöhle. Wie Abb. 7 c zeigt, gilt dies aber nur vom
distalen Teil der Vorderseite, denn proximal ist der Hyp. unter die Mundpumpe (MP) weiter eingestülpt,
so daß hier drei Schichten Epithel samt Cuticula übereinanderliegen1). Die Feststellung
dieser Tatsache, die, wenigstens nach den Darstellungen der seitherigen Autoren, weder für Cwada
(Snodgr as s ) noch für die Wanzen (Gei se) zutrifft, gelang mir an Hand von Frontalschnittserien,
aus denen einzelne Schnitte in Abb. 12, 13, Text-Abb. 3 gezeichnet sind und die eben aufgestellte
Behauptung erweisen2). Den Schnitt, auf dem'die Einstülpung der vorderen Hypopharynxwand
unter die hintere (ventrale) Wand der Mundpumpe am besten zu erkennen ist, zeigt Abb. 12 a.
H i e r , a n s e i n e r B a s i s , i s t a l s o d e r Hy p . d u r c h a u s s e l b s t ä n d i g u n d s t e h t
mi t d em I n n e n r a um de r M u n d p u m p e in k e i n e r l e i Be z i eh u n g , d i s t a l d a g e g e n
bi ldet er d enBo d e n der Mu n d h ö h l e . D ie dadurch notwendig werdende Befestigung des distalen
Teils des Hypopharynx an der Dorsalwand der Mundhöhle wird durch die eigentümlichen Organe,
die in Abb. 8-- 10 und dem Schnitt Abb. 13 erkennbar sind und hier als M u n d lc n ö p f e (MKn)
bezeichnet werden sollen, vermittelt (von W i t l a c z i l gesehen, aber fälschlich als Muskelansätze
gedeutet, s. p. 23). Diese Knöpfe sind Ausstülpungen der Hypopharynxwand, die ganz nach Art
von Druckknöpfen in matrizenartig genau passende Vertiefungen der Hinterwand des Anteclypeus,
des Mundhöhlendachs also, eingreifen und einerseits den dichten seitlichen Verschluß der ja lateral
nur durch eng aneinandergepreßte Chitinflächen abgeriegelten Mundhöhle gewährleisten, andererseits
aber auch die zwischen der Mundpumpe und dem Hypopharynx einspringende tiefe Falte, von
der oben die Rede war, zusammenpressen und so deren Eingang gegen die Mundhöhle hin abschließen
(Abb. 7 c). Daß die Mundknöpfe außerdem noch als Sinnesorgane in Frage kommen, wird weiter
unten noch dargelegt werden (p. 42), wo auch die Einzelheiten des Baus der Mundhohle nochmals
näher gewürdigt werden sollen. An seinen Seitenwänden hat der Hypopharynx von der Basis nach
der Spitze laufende rinnenförmige Vertiefungen und entsprechende Erhöhungen, an denen die ihm
dicht anliegenden Stechborsten entlang gleiten, im Innern enthält er die Speichelpumpe (p. 21).
Faßt man das Vorstehende zusammen, so erhält man vom H y p o p h a r y n x das Bild eines
m e d i a n e n u n p a a r e n A n h a n g s , d e r , t i e f i n d e n K o p f z u r ü e k g e i ' o g e n ,
zu e i n e m ä u ß e r l i c h n i c h t s i c h t b a r e n O r g a n wird, dessen Bedeutung einerseits
darin zu suchen ist, daß es in seinem Innern die S p e i c h e l p u m p e enthält und die Z u -
l e i t u n g d e s S p e i c h e l s v e r m i t t e l t , andererseits aber darin, daß er, indem er mit seinem
distalen Teil den Boden der Mundhöhle bildet, a u c h d i e N a k r u a g s a u f n ä h m e v e r m
i t t e l n hilft und schließlich, wie sich weiter unten zeigen wird, darin, daß er z. T. die F u h -
r u n g d e r S t e c h b o r s t e n ü b e r n i m m t .
6. D i e S t e c h b o r s t e n ,
a) Die m a n d i b u l a r e n S t e c h b o r s t e n (Md, setae mandibulares), entsprechen ihrer
Entstehung nach den Mandibeln der kauenden Insekten (H e y m o n s), verhalten sich also, morphologisch
betrachtet, zu den Laminae mandibulares ganz anders wie die maxillaren Stechborsten
zu den Laminae maxillares. Die Laminae mandibulares entsprechen ja, nach S n o d g r a s s , der
Gena, während die Laminae maxillares, wenn sie auch in ihren basalen Partien wahrscheinlich einen
1111 Diese Sohiohten sind aber so außerordentlich dünn, daß sie nur auf besonders wohl gelungenen Sohnittpräparaten und nur mit
stärksten Objektiven festzustellen sind. . I I
>) D a v i d s o n (s. Anm. auf p. 6) hat dies Verhalten des Hypopharynx bei Schuomum moht festgestellt, ich glaubB aber
kaum, daß die Aphidengenera sich tatsächlich so verschieden verhalten, wie daraus hervorzugehen scheint. Jedenfalls muß ich nach
wiederholter Durchsicht meiner Sohnittserien die obige Feststellung aufrecht halten.