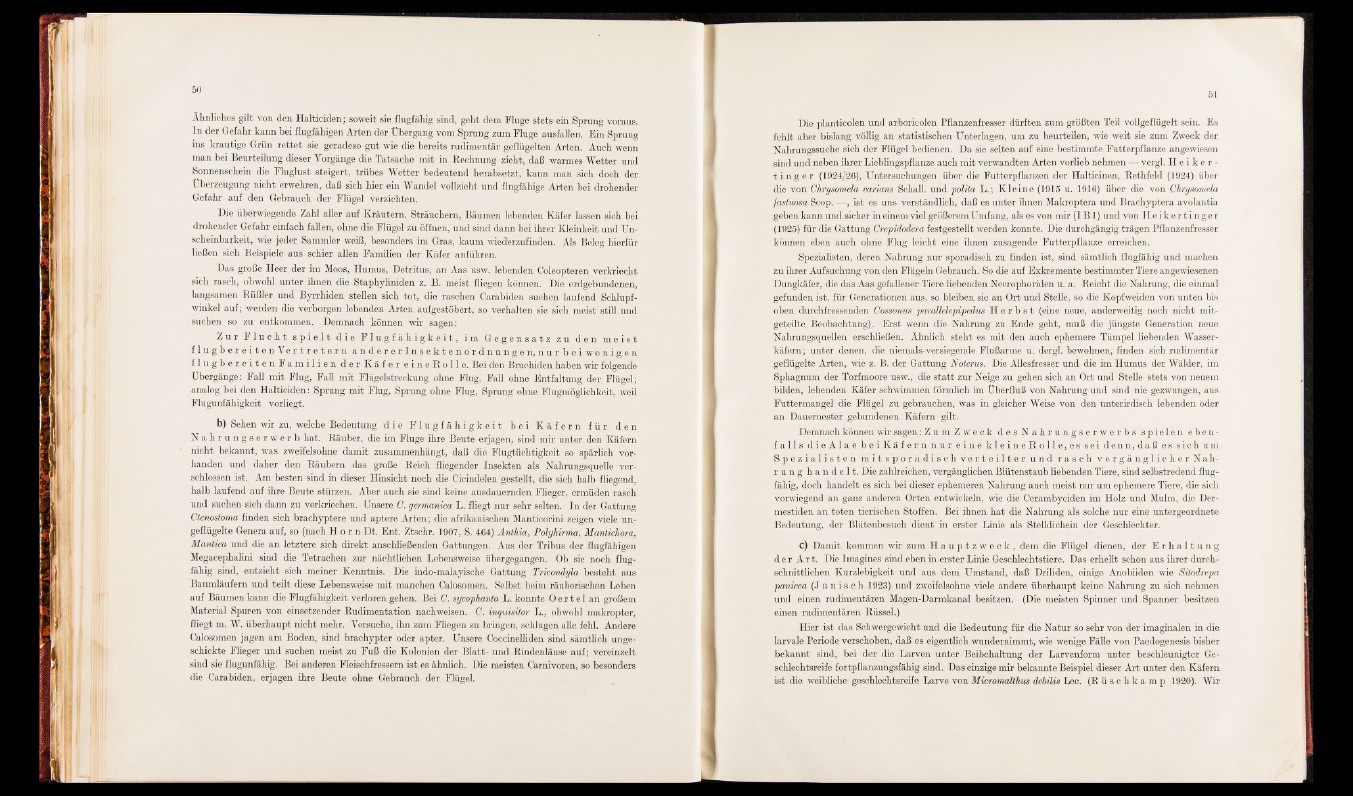
Ähnliches gilt von den Halticiden; soweit sie flugfähig sind, geht dem Eluge stets ein Sprang voraus.
In der Gefahr kann bei flugfähigen Arten der Übergang vom Sprung zum Fluge ausfallen. Ein Sprung
ins krautige Grün rettet sie geradeso gut wie die bereits rudimentär geflügelten Arten. Auch wenn
man bei Beurteilung dieser Vorgänge die Tatsache mit in Rechnung zieht, daß warmes Wetter und
Sonnenschein die Fluglust steigert, trübes Wetter bedeutend herabsetzt, kann man sich doch der
Überzeugung nicht erwehren, daß sich hier ein Wandel vollzieht und flugfähige Arten bei drohender
Gefahr auf den Gebrauch der Flügel verzichten.
Die überwiegende Zahl aller auf Kräutern, Sträuchern, Bäumen lebenden Käfer lassen sich bei
drohender Gefahr einfach fallen, ohne die Flügel zu öffnen, und sind dann bei ihrer Kleinheit und Un-
scheinbarkeit, wie jeder Sammler weiß, besonders im Gras, kaum wiederzufinden. Als Beleg hierfür
ließen sich Beispiele aus schier allen Familien der Käfer anführen.
Das große Heer der im Moos, Humus, Detritus, an Aas usw. lebenden Coleopteren verkriecht
sich rasch, obwohl unter ihnen die Staphyliniden z. B. meist fliegen können. Die erdgebundenen,
langsamen Rüßler und Byrrhiden stellen sich tot, die raschen Carabiden suchen laufend Schlupfwinkel
auf; werden die verborgen lebenden Arten aufgestöbert, so verhalten sie sich meist still und
suchen so zu entkommen. Demnach können wir sagen:
Z u r F l u c h t s p i e l t d i e F l u g f ä h i g k e i t , i m G e g e n s a t z z u d e n m e i s t
f l u g b e r e i t e n V e r t r e t e r n a n d e r e r l n s e k t e n o r d n u n g e n , n u r b e i w e n i g e n
f l u g b e r e i t e n F a m i l i e n d e r K ä f e r e i n e R o l l e . Bei den Bruchiden haben wir folgende
Übergänge: Fall mit Flug, Fall mit Flügelstreckung ohne Flug, Fall ohne Entfaltung der Flügel;
analog bei den Halticiden: Sprung mit Flug, Sprung ohne Flug, Sprung ohne Flugmöglichkeit, weil
Flugunfähigkeit vorliegt.
b) Sehen wir zu, welche Bedeutung d i e F l u g f ä h i g k e i t b e i K ä f e r n f ü r d e n
N a h r u n g s e r w e r b hat. Räuber, die im Fluge ihre Beute erjagen, sind mir unter den Käfern
nicht bekannt, was zweifelsohne damit zusammenhängt, daß die Flugtüchtigkeit so spärlich vorhanden
und daher den Räubern das große Reich fliegender Insekten als Nahrungsquelle verschlossen
ist. Am besten sind in dieser Hinsicht noch die Cicindelen gestellt, die sich halb fliegend,
halb laufend auf ihre Beute stürzen. Aber auch sie sind keine ausdauernden Flieger, ermüden rasch
und suchen sich dann zu verkriechen. Unsere G. germanica L. fliegt nur sehr selten. In der Gattung
Ctenostoma finden sich brachyptere und aptere Arten; die afrikanischen Manticorini zeigen viele ungeflügelte
Genera auf, so (nach H o r n Dt. Ent. Ztschr. 1907, S. 464) Anthia, PolyHrma, Mantichora,
Mantica und die an letztere sich direkt anschließenden Gattungen. Aus der Tribus der flugfähigen
Megacephalini sind die Tetrachen zur nächtlichen Lebensweise übergegangen. Ob sie noch flugfähig
sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Die indo-malayische Gattung Tricondyla besteht aus
Baumläufern und teilt diese Lebensweise mit manchen Calosomen. Selbst beim räuberischen Leben
auf Bäumen kann die Flugfähigkeit verloren gehen. Bei C. sycophanta L. konnte 0 e r t e 1 an großem
Material Spuren von einsetzender Rudimentation nachweisen. C. Inquisitor L., obwohl makropter,
fliegt m. W. überhaupt nicht mehr. Versuche, ihn zum Fliegen zu bringen, schlugen alle fehl. Andere
Calosomen jagen am Boden, sind brachypter oder apter. Unsere Coccinelliden sind sämtlich ungeschickte
Flieger und suchen meist zu Fuß die Kolonien der Blatt- und Rindenläuse auf; vereinzelt
sind sie flugunfähig. Bei anderen Fleischfressern ist es ähnlich. Die meisten Carnivoren, so besonders
die Carabiden, erjagen ihre Beute ohne Gebrauch der Flügel.
Die planticolen und arboricolen Pflanzenfresser dürften zum größten Teil vollgeflügelt sein. Es
fehlt aber bislang völlig an statistischen Unterlagen, um zu beurteilen, wie weit sie zum Zweck der
Nahrungssuche sich der Flügel bedienen. Da sie selten auf eine bestimmte Futterpflanze angewiesen
sind und neben ihrer Lieblingspflanze auch mit verwandten Arten vorlieb nehmen —- vergl. H e i k e r -
t i n g e r (1924/26), Untersuchungen über die Futterpflanzen der Halticinen, Rethfeld (1924) über
die von Ghrysomela varians Schall, und polita L.; Kl eine (1915 u. 1916) über die von Chrysomela
fastuosa Scop. — ist es uns verständlich, daß es unter ihnen Makroptera und Brachyptera avolantia
geben kann und sicher in einem viel größerem Umfang, als es von mir ( IB 1) und von H e i k e r t i n g e r
(1925) für die Gattung Crepidodera festgestellt werden konnte. Die durchgängig trägen Pflanzenfresser
können eben auch ohne Flug leicht eine ihnen zusagende Futterpflanze erreichen.
Spezialisten, deren Nahrung nur sporadisch zu finden ist, sind sämtlich flugfähig und machen
zu ihrer Aufsuchung von den Flügeln Gebrauch. So die auf Exkremente bestimmter Tiere angewiesenen
Dungkäfer, die das Aas gefallener Tiere liebenden Necrophoriden u. a. Reicht die Nahrung, die einmal
gefunden ist, für Generationen aus, so bleiben sie an Ort und Stelle, so die Kopfweiden von unten bis
oben durchfressenden Cossonus parallelepipedus H e r b s t (eine neue, anderweitig noch nicht mitgeteilte
Beobachtung). Erst wenn die Nahrung zu Ende geht, muß die jüngste Generation neue
Nahrungsquellen erschließen. Ähnlich steht es mit den auch ephemere Tümpel liebenden Wasserkäfern;
unter denen, die niemals-versiegende Flußarme u. dergl. bewohnen, finden sich rudimentär
geflügelte Arten, wie z. B. der Gattung Noterus. Die Allesfresser und die im Humus der Wälder, im
Sphagnum der Torfmoore usw., die sta tt zur Neige zu gehen sich an Ort und Stelle stets von neuem
bilden, lebenden Käfer schwimmen förmlich im Überfluß von Nahrung und sind nie gezwungen, aus
Futtermangel die Flügel zu gebrauchen, was in gleicher Weise von den unterirdisch lebenden oder
an Dauernester gebundenen Käfern gilt.
Demnach können wir sagen: Z u m Zw e c k d e s N a h r u n g s e r w e r b s s p i e l e n e b e n f
a l l s d i e A l a e b e i K ä f e r n n u r e i n e k l e i n e R o l l e , e s sei d e n n , d a ß es s i ch um
S p e z i a l i s t e n m i t s p o r a d i s c h v e r t e i l t e r u n d r a s c h v e r g ä n g l i c h e r Na h r
u n g h a n d e l t . Die zahlreichen, vergänglichen Blütenstaub liebenden Tiere, sind selbstredend flugfähig,
doch handelt es sich bei dieser ephemeren Nahrung auch meist nur um ephemere Tiere, die sich
vorwiegend an ganz anderen Orten entwickeln, wie die Cerambyciden im Holz und Mulm, die Der-
mestiden an toten tierischen Stoffen. Bei ihnen hat die Nahrung als solche nur eine untergeordnete
Bedeutung, der Blütenbesuch dient in erster Linie als Stelldichein der Geschlechter.
c) Damit kommen wir zum H a u p t z w e c k , dem die Flügel dienen, der E r h a l t u n g
d e r Ar t . Die Imagines sind eben in erster Linie Geschlechtstiere. Das erhellt schon aus ihrer durchschnittlichen
Kurzlebigkeit und aus dem Umstand, daß Driliden, einige Anobiiden wie Sitodrepa
panicea (J a n i s c h 1923) und zweifelsohne viele andere überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen
und einen rudimentären Magen-Darmkanal besitzen. (Die meisten Spinner und Spanner besitzen
einen rudimentären Rüssel.)
Hier ist das Schwergewicht und die Bedeutung für die Natur so sehr von der imaginalen in die
larvale Periode verschoben, daß es eigentlich wundernimmt, wie wenige Fälle von Paedogenesis bisher
bekannt sind, bei der die Larven unter Beibehaltung der Larvenform unter beschleunigter Geschlechtsreife
fortpflanzungsfähig sind. Das einzige mir bekannte Beispiel dieser Art unter den Käfern
ist die weibliche geschlechtsreife Larve v o nMicromaUTius debilis Lee. ( R ü s c h k a m p 1920). Wir