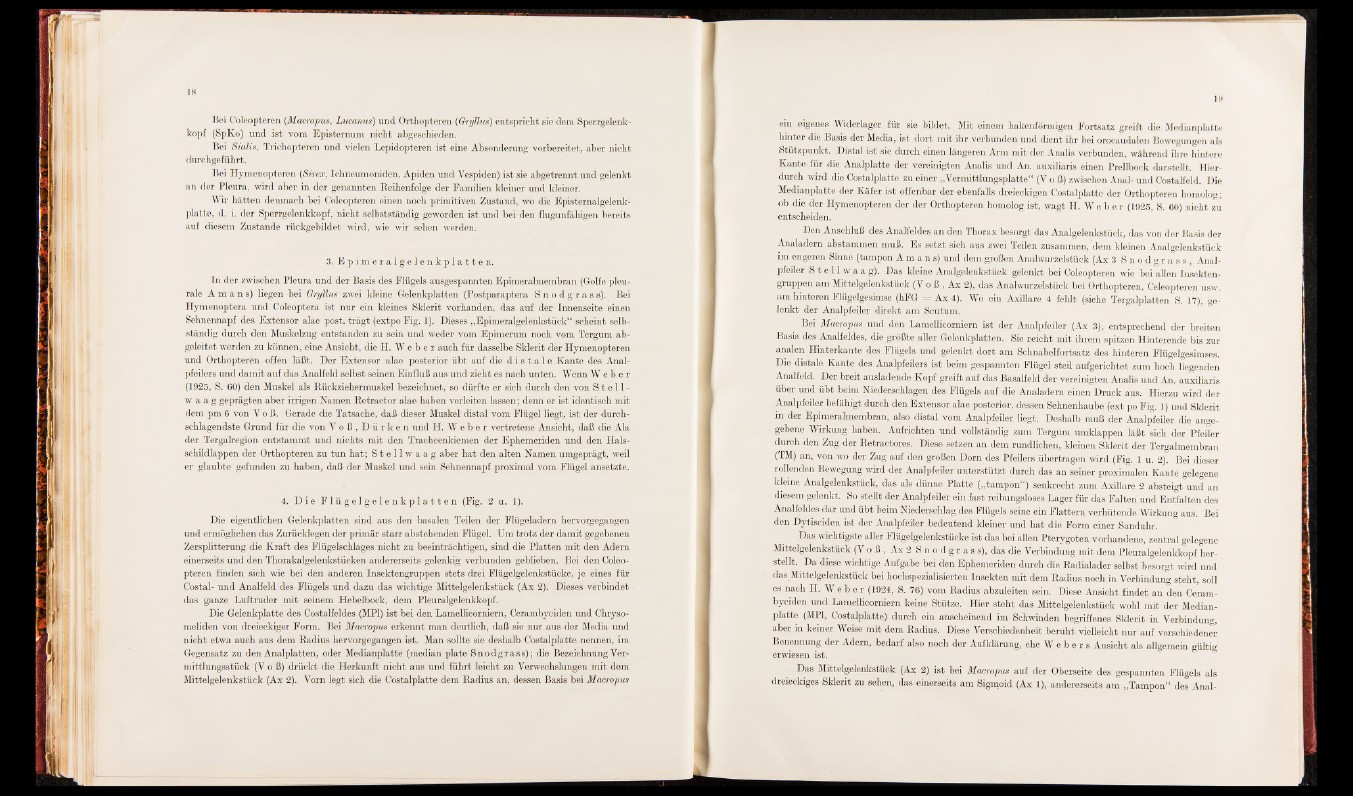
Bei Coleopteren {Macropus, Lucanus) und Orthopteren (Gryllus) entspricht sie dem Sperrgelenk-
kopf (SpKo) und ist vom Episternum nicht abgeschieden.
Bei Sialis, Trichopteren und vielen Lepidopteren ist eine Absonderung vorbereitet, aber nicht
durchgeführt.
Bei Hymenopteren (Sirex, Ichneumoniden, Apiden und Vespiden) ist sie abgetrennt und gelenkt
an der Pleura, wird aber in der genannten Reihenfolge der Familien kleiner und ldeiner.
Wir hätten demnach bei Coleopteren einen noch primitiven Zustand, wo die Episternalgelenk-
platte, d. i. der Sperrgelenkkopf, nicht selbstständig geworden ist und bei den flugunfähigen bereits
auf diesem Zustande rückgebildet wird, wie wir sehen werden.
3. E p i m e r a l g e l e n k p l a t t e n .
In der zwischen Pleura und der Basis des Flügels ausgespannten Epimeralmembran (Golfe pleurale
A m a n s) liegen bei Gryllus zwei Meine Gelenkplatten (Postparaptera S n o d g r a s s ) . Bei
Hymenoptera und Coleoptera ist nur ein Meines SMerit vorhanden, das auf der Innenseite einen
Sehnennapf des Extensor alae post, trägt (extpo Fig. 1). Dieses „Epimeralgelenkstück“ scheint selbständig
durch den Muskelzug entstanden zu sein und weder vom Epimerum noch vom Tergum abgeleitet
werden zu können, eine Ansicht, die H. W e b e r auch für dasselbe SMerit der Hymenopteren
und Orthopteren offen läßt. Der Extensor alae posterior übt auf die d i s t a l e Kante des Analpfeilers
und damit auf das Analfeld selbst seinen Einfluß aus und zieht es nach unten. Wenn W e b e r
(1925, S. 60) den Muskel als Rückziehermuskel bezeichnet, so dürfte er sich durch den von S t e l l -
w a a g geprägten aber irrigen Namen Retractor alae haben verleiten lassen; denn er ist identisch mit
dem pm 6 von Y o ß. Gerade die Tatsache, daß dieser Muskel distal vom Flügel liegt, ist der durchschlagendste
Grund für die von Y o ß , D ü r k e n und H. W e b e r vertretene Ansicht, daß die Ala
der Tergalregion entstammt und nichts mit den TracheenMemen der Ephemeriden und den Halsschildlappen
der Orthopteren zu tun hat; S t e l l w a a g aber hat den alten Namen umgeprägt, weil
er glaubte gefunden zu haben, daß der Muskel und sein Sehnennapf proximal vom Flügel ansetzte.
4. D i e F l ü g e l g e l e n k p l a t t e n (Fig. 2 u. 1).
Die eigentlichen Gelenkplatten sind aus den basalen Teilen der Flügeladern hervorgegangen
und ermöglichen das ZurücMegen der primär starr abstehenden Flügel. Um trotz der damit gegebenen
Zersplitterung die Kraft des Flügelschlages nicht zu beeinträchtigen, sind die Platten mit den Adern
einerseits und den Thorakalgelenkstücken andererseits gelenMg verbunden geblieben. Bei den Coleopteren
finden sich wie bei den anderen Insektengruppen stets drei Flügelgelenkstücke, je eines für
Costal- und Analfeld des Flügels und dazu das wichtige Mittelgelenkstück (Ax 2). Dieses verbindet
das ganze Luftruder mit seinem Hebelbock, dem Pleuralgelenkkopf.
Die Gelenkplatte des Costalfeldes (MP1) ist bei den Lamellicorniern, Cerambyciden und Chryso-
meliden von dreieckiger Form. Bei Macropus erkennt man deutlich, daß sie nur aus der Media und
nicht etwa auch aus dem Radius hervorgegangen ist. Man sollte sie deshalb Costalplatte nennen, im
Gegensatz zu den Analplatten, oder Medianplatte (median plate S n o d g ra s s ); die Bezeichnung Vermittlungsstück
(V o ß) drückt die Herkunft nicht aus und führt leicht zu Verwechslungen mit dem
Mittelgelenk stück (Ax 2). Vorn legt sich die Costalplatte dem Radius an, dessen Basis bei Macropus
ein eigenes Widerlager für sie bildet. Mit einem hakenförmigen Fortsatz greift die Medianplatte
hinter die Basis der Media, ist dort mit ihr verbunden und dient ihr bei orooaudalen Bewegungen als
Stützpunkt. Distal ist sie durch einen längeren Arm mit der Analis verbunden, während ihre hintere
Kante-für die Analplatte der vereinigten Analis und An. auxiliaris einen Prellbock darstellt. Hierdurch
wird die Costalplatte zu einer „Vermittlungsplatte“ (V o 13) zwischen Anal- und Costalfeld. Die
Medianplatte der Käfer ist offenbar der ebenfalls dreieckigen Costalplatte der Orthopteren homolog;
; eptdie der Hymenopteren der der Orthopteren homolog ist, wagt H. W e b e r (1 9 2 5 , S. 60) nicht zu
entscheiden.
Den Anschluß des Analfeldes an den Thorax besorgt das Analgelenkstück, das von der Basis der
Analadern abstammen muß. Es setzt sich aus zwei Teilen zusammen, dem Meinen Analgelenkstück
im engeren Sinne (tampon A m a u s ) und dem großen Analwurzelstück (Ax 3 S n o d g r a s s , Analpfeiler
S t e l lw a a g ) . Das kleine Analgelenkstück gelenkt bei Coleopteren wie bei allen Insektengruppen
am Mittelgelenkstück (V o ß , Ax 2), das Analwurzelstück bei Orthopteren, Celeopteren usw.
am hinteren Flügelgesimse (h FG H A x 4 ). W o ein Axillare 4 fehlt (siehe Tergalplatten S. 17), gelenkt
der Analpfeiler direkt am Scutum.
Bei Macropus und den Lamellicorniern ist der Analpfeiler (Ax 3), entsprechend der breiten
Basis des Analfeldes, die größte aller GelenkplatJen. Sie reicht mit ihrem spitzen Hinterende bis zur
analen Hinterkante des Flügels und gelenkt dort am Schnabelfortsatz des hinteren Flügelgesimses.
Die distale Kante des Analpfeilers ist beim gespannten Flügel steil aufgerichtet zum hoch liegenden
Analfeld. Der breit ausladende Kopf greift auf das Basalfeld der vereinigten Analis und An. auxiliaris
über und übt beirrt Niederschlagen des Flügels auf die Analadem einen Druck aus. Hierzu wird der
Analpfeiler befähigt durch den Extensor alae posterior, dessen Sehnenhau|||(ext po Fig. 1) und Sklerit
in der Epimeralmembran, also distal vom Analpfeiler liegt. Deshalb muß der Analpfeiler die angegebene
Wirkung haben. Aufrichten und vollständig zum Tergum umklappen läßt sich der Pfeiler
durch den Zug der Retractores. Diese setzen an dem rundlichen, kleinen Sklerit der Tergalmembran
(TM) an, von wo der Zug auf den großen Dotn des Pfeilers übertragen wird (Fig. 1 u. 2). Bei dieser
rollenden Bewegung wird der Analpfeiler unterstützt durch das an seiner proximalen Kante gelegene
kleine Analgelenkstüek, das als dünne Platte („tampon“ ) senkrecht zum Axillare 2 absteigt und an
diesem gelenkt. So stellt der Analpfeiler ein fast reibungsloses Lager für das Falten und Entfalten des
Analfeldes dar und übt beim Niederschlag „des Flügels seine ein Flattern verhütende Wirkung aus. Bei
den Dytisciden ist der Analpfeiler bedeutend kleiner und hat die Form einer Sanduhr.
Das wichtigste aller Flügelgelenkstücke ist das bei allen Pterygoten vorhandene, zentral gelegene
Mittelgelenkstück (V o ß , Ax 2 S n-o d g r a s sjj das die Verbindung mit dem Pleuralgelenkkopf herstellt.
Da diese wichtige Aufgafflbei den Ephemeriden durch die Radialader selbst besorgt wird und
das_ Mittelgelenkstück bei hochspezialisierten Insekten mit dem Radius noch in Verbindung steht, soll
es nach H. W e b e r (1924, S. 76) vom Radius abzuleiten sein. Diese Ansicht findet an den Cerambyciden
und Lamellicorniern keine Stütze. Hier steht das Mittelgelenkstück wohl mit der Medianplatte
(MP1, Costalplatte) durch ein anscheinend im Schwinden begriffenes Sklerit in Verbindung,
aber in keiner Weise mit dem Radius;, Diese Verschiedenheit beruht vielleicht nur auf verschiedener
Benennung der Adern, bedarf also noch der Aufklärung, ehe W e b e r s Ansicht als allgemein gültig
erwiesen ist.
Das Mittelgelenkstück (Ax 2) ist bei Macropus auf der Oberseite des gespannten Flügels als
dreieckiges Sklerit zu sehen, das einerseits am Sigmoid (Ax 1), andererseits am „Tampon“ des Anal