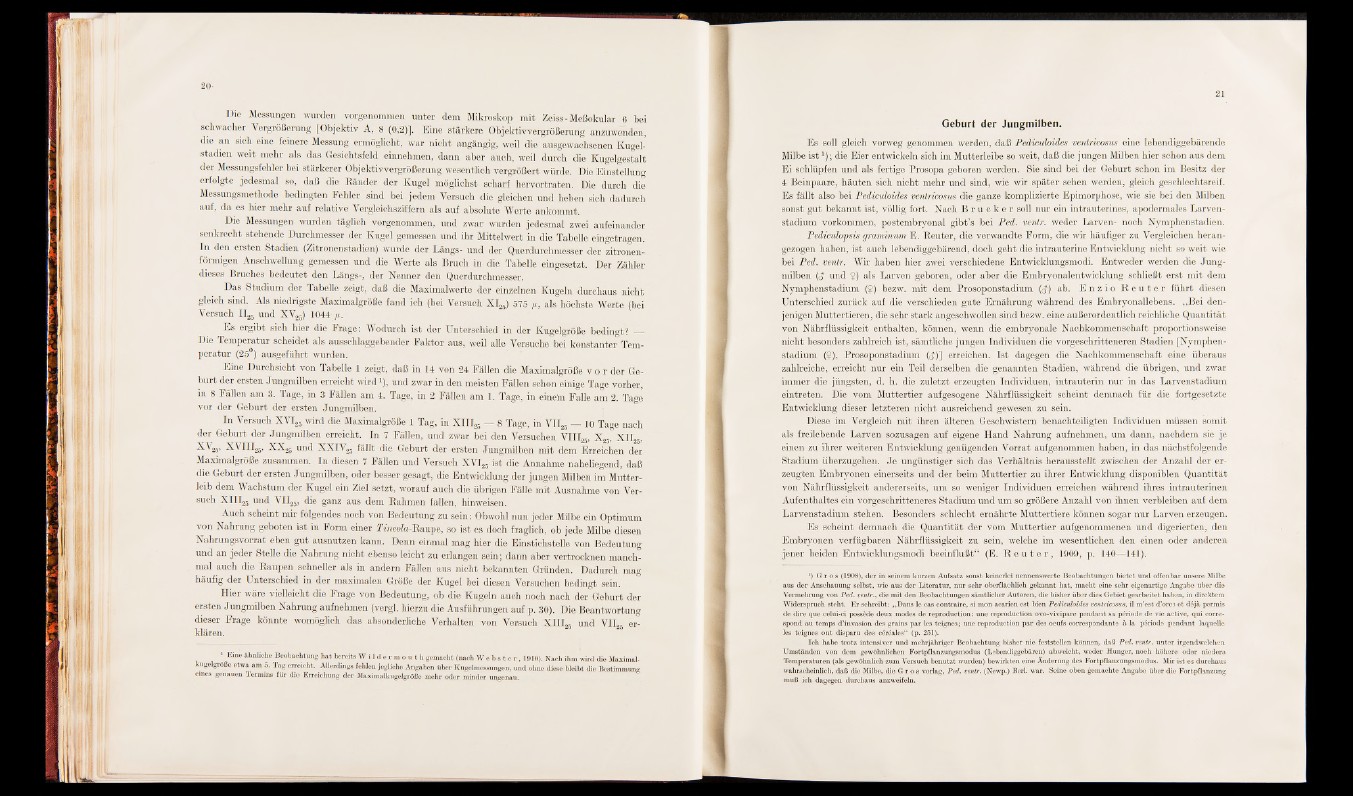
Die Messungen wurden vorgenommen unter dem Mikroskop mit Zeiss-Meßokular 6 bei
schwacher Vergrößerung [Objektiv A, 8 (0,2)]. Eine stärkere Objektivvergrößerung anzuwenden,
die an sich eme fernere Messung ermöglicht, war nicht angängig, weil die ausgewachsenen Kugelstadien
weit mehr als das Gesichtsfeld einnehmte, dann aber auch, weil durch die Kugelgestalt
der Messungsfehler bei stärkerer Objektivvergrößerung wesentlich vergrößert würde. Die; Einstellung
erfolgte jedesmal so, daß die Ränder der Kugel möglichst scharf hervortraten. Die durch die
Messungsmethode bedingten Fehler sind bei jedem Versuch die gleichen und heben sich dadurch
auf, da es hier mehr auf relative Vergleichsziffern als: auf absolute Werte ankommt.
Die Messungen wurden täglich vorgenommen, und zwar wurden jedesmal zwei auf einander
senkrecht stehende Durchmesser der Kugel gemessen und ihr Mittelwert in die Tabelle eingetragen.
In den ersten Stadien (Zitronenstadien) wurde der Längs- und der Querdurchmesser ä® zitronenförmigen
Anschwellung gemessen und die Werte als Bruch in die Tabelle eingesetzt. Der Zähler
dieses Bruches bedeutet den Längs-, der Kenner den Querdurchmesser.
Das Studium der Tabelle zeigt, daß die Maximalwerte der einzelnen Kugeln durchaus nicht
gleich sind. Als niedrigste Maximalgröße fand ich (bpi Versuch XI25) 575 als höchste Werte S e i
Versuch 11^ und XV25) 1044■ p.
Es ergibt sich hier die Frage: Wodurch ist der Unterschied in der Kugelgröße b e d ih g i^ H
Die Temperatur scheidet als ausschlaggebender Faktor aus, weil alle Versuche bei konstanter Temperatur
(25°) auSgeführt wurden.
Eine Durchsicht von Tabelle 1 zeigt, daß in 14 von 24 Fällen die Maximalgröße t o r der Geburt
der ersten Jungmilben erreicht wird1), und zwar in den meisten Fällen schon einige Tage vorher,
in 8 Fällen am 3. Tage, in 3 Fällen am 4. Tage, in 2 Fällen am 1. Tage, in einein Falle am 2. Tage
vor der Geburt der ersten Jungmilben.
In Versuch XVI25 wird die Maximalgröße 1 Tag, in X III25 — 8 Tage, in VII25 -BlO Tage nach
der Geburt der Jungmilben erreicht. In 7 Fällen, und zwar bei den Versuchen VIII25, X25, XII25,
XV25, XVIII^, XX ^ und XXIV25 fällt die Geburt der ersten Jungmilben mit dem Erreichen der
Maximalgröße zusammen. In diesen 7 Fällen und Versuch XVI^-ist die Annahme naheliegend, daß
die Geburt der ersten Jungmilben,.oder besser gesagt, die Entwicklung der jungen Milben im Mutte-
leib dem Wachstum der Kugel ein Ziel setzt, worauf auch die übrigen Fälle mit Ausnahme f | i Versuch
iXTTI26 und VII25, die ganz* aus dem Rahmen fallen, hin weisen.
Auch scheint mir fölgendes noch von Bedeutung zu sein: Obwohl nun jeder Milbe ein Optimum
von Nahrung geboten ist in Form einer Twteola-Raupe, so ist es do.eh fraglich, ob jede Milbe diesen
Nahrungsvorrat eben gut ausnutzen kann. Denn einmal mag hier die Einstichstelle von Bedeutung
und an jeder Stelle die Nahrung nicht ebenso leicht ,zu erlangen sein; dann aber vertrocknen manchmal
auch die Raupen schneller als in ändern Fällen aus nicht bekannten Gründen. Dadurch ¡mag
häufig der Unterschied in der maximalen Größe der Kugel bei diesen Versuchen bedingt sein.
Hier wäre vielleicht die Frage von Bedeutung, ob die Kugeln auch noch nach der Geburt der
ersten Jungmilben Nahrung aufnehmen (vergl. hierzu die Ausführungen auf p. 30). Die Beantwortung
dieser Frage könnte womöglich das absonderliche Verhalten von Versuch XIH,, und VII« erklären.
1()Eirlc atnli,he Beobachtung hat bereits Wi l d e rm o T i t h gemacht (nach W e h a t e r , 1910). Nach ihm wird die Maximal-
InigelgröBe etwa am 5. Tag erreicht. Allerdings fehlen jegliche Angaben über Kugelmessungen, und ohne diese bleibt die Bestimmung
eines genauen Termins für die Erreichung der Maximalkugelgröße mehr oder minder ungenau.
Geburt der Jungmilben.
Es soll gleich, vorweg genommen werden, daß Pediculoides ventricosus eine lebendiggebärende
Milbe i s t1 j ; die Eier entwickeln sich im Mutterleibe so weit, daß die jungen Milben Mer schon aus dem
Ei scMüpfen und als fertige Prosopa geboren werden. Sie sind bei der Geburt schon im Besitz der
4 Beinpaare, häuten sieb nicht mehr und sind, wie wir später sehen werden, gleich geschlechtsreif.
Es fällt also bei Pediculoides ventricosus die ganze komplizierte Epimorphose, wie sie bei den Milben
sonst gut bekannt ist, völlig fort. Nach B r ü c k e r soll nur ein intrauterines, apodermales Larvenstadium
Vorkommen, postembryonal gibt’s bei Ped. venir, weder Larven- noch Nymphenstadien.
Pediculopsis graminum E. Reuter, die verwandte Form, die wir häufiger zu Vergleichen herangezogen
haben, ist auch lebendiggebärend, doch geht die intrauterine Entwicklung nicht so weit wie
bei Ped. ventr. Wir haben hier zwei verschiedene Entwicklungsmodi. Entweder werden die Jungmilben
(c? und $) als Larven geboren, oder aber die Embryonalentwicklung schließt erst mit dem
Nymphenstadium ($) bezw. mit dem Prosoponstadium (<?) ab. E n z i o R e u t e r führt diesen
Unterschied zurück auf die verschieden gute Ernährung während des Embryonallebens. ,,Bei denjenigen
Muttertieren, die sehr stark angeschwollen sind bezw. eine außerordentlich reichliche Quantität
von Nährflüssigkeit enthalten, können, wenn die embryonale Nachkommenschaft proportionsweise
nicht besonders zahlreich ist, sämtliche jungen Individuen die vorgeschritteneren Stadien [Nymphenstadium
($), Prosoponstadium (<£).] erreichen. Ist dagegen die Nachkommenschaft eine überaus
zahlreiche, erreicht nur ein Teil derselben die genannten Stadien, während die übrigen, und zwar
immer die jüngsten, d. h. die zuletzt erzeugten Individuen, intrauterin nur in das Larvenstadium
eintreten. Die vom Muttertier aufgesogene Nährflüssigkeit scheint demnach für die fortgesetzte
Entwicklung dieser letzteren nicht ausreichend gewesen zu sein.
Diese im Vergleich mit ihren älteren Geschwistern benachteiligten Individuen müssen somit
als freilebende Larven sozusagen auf eigene Hand Nahrung auf nehmen, um dann, nachdem sie je
einen zu ihrer weiteren Entwicklung genügenden Vorrat aufgenommen haben, in das nächstfolgende
Stadium überzugehen. Je ungünstiger sich das Verhältnis herausstellt zwischen der Anzahl der erzeugten
Embryonen einerseits und der beim Muttertier zu ihrer Entwicklung disponiblen Quantität
von Nährflüssigkeit andererseits, um so weniger Individuen erreichen während ihres intrauterinen
Aufenthaltes ein vorgeschritteneres Stadium und um so größere Anzahl von ihnen verbleiben auf dem
Larvenstadium stehen. Besonders schlecht ernährte Muttertiere können sogar nur Larven erzeugen.
Es scheint demnach die Quantität der vom Muttertier auf genommenen und digerierten, den
Embryonen verfügbaren Nährflüssigkeit zu sein, welche im wesentlichen den einen oder anderen
jener beiden Entwicklungsmodi beeinflußt“ (E. R e u t e r , 1909, p. 140—141).
*) G r o s (1908), der in seinem kurzen Aufsatz sonst keinerlei neimenswerte Beobachtungen bietet und offenbar unsere Milbe
aus der Anschauung selbst, wie aus der Literatur, nur sehr oberflächlich gekannt hat, macht eine sehr eigenartige Angabe über die
Vermehrung von Ped. ventr., die mit den Beobachtungen sämtlicher Autoren, die bisher über dies Gebiet gearbeitet haben, in direktem
Widerspruch steht. Er schreibt: „Dans le cas contraire, si mon acarien est bien Pediculoides ventricosus, il m’est d ’ores et déjà permis
de dire que celui-ci possède deux modes de reproduction: une reproduction ovo-vivipare pendant sa période de vio active, qui correspond
au temps d’invasion des grains par les teignes; une reproduction par des oeufs correspondante à la période pendant laquelle
les teignes ont disparu des céréales“ (p. 251).
Ich habe trotz intensiver und mehrjähriger Beobachtung bisher nie feststellen können, daß Ped. ventr. unter irgendwelchen
Umständen von dem gewöhnlichen Fortpflanzungsmodus (Lebendiggebären) ahweicht, weder Hunger, noch höhere oder niedere
Temperaturen (als gewöhnlich zum Versuch benutzt wurden) bewirkten eine Änderung des Fortpflanzungsmodus. Mir ist es durchaus
wahrscheinlich, daß die Milbe, die Gr o s vorlag, Ped. ventr. (Newp.) Berl. war. Seine oben gemachte Angabe über die Fortpflanzung
muß ich dagegen durchaus anzweifeln.