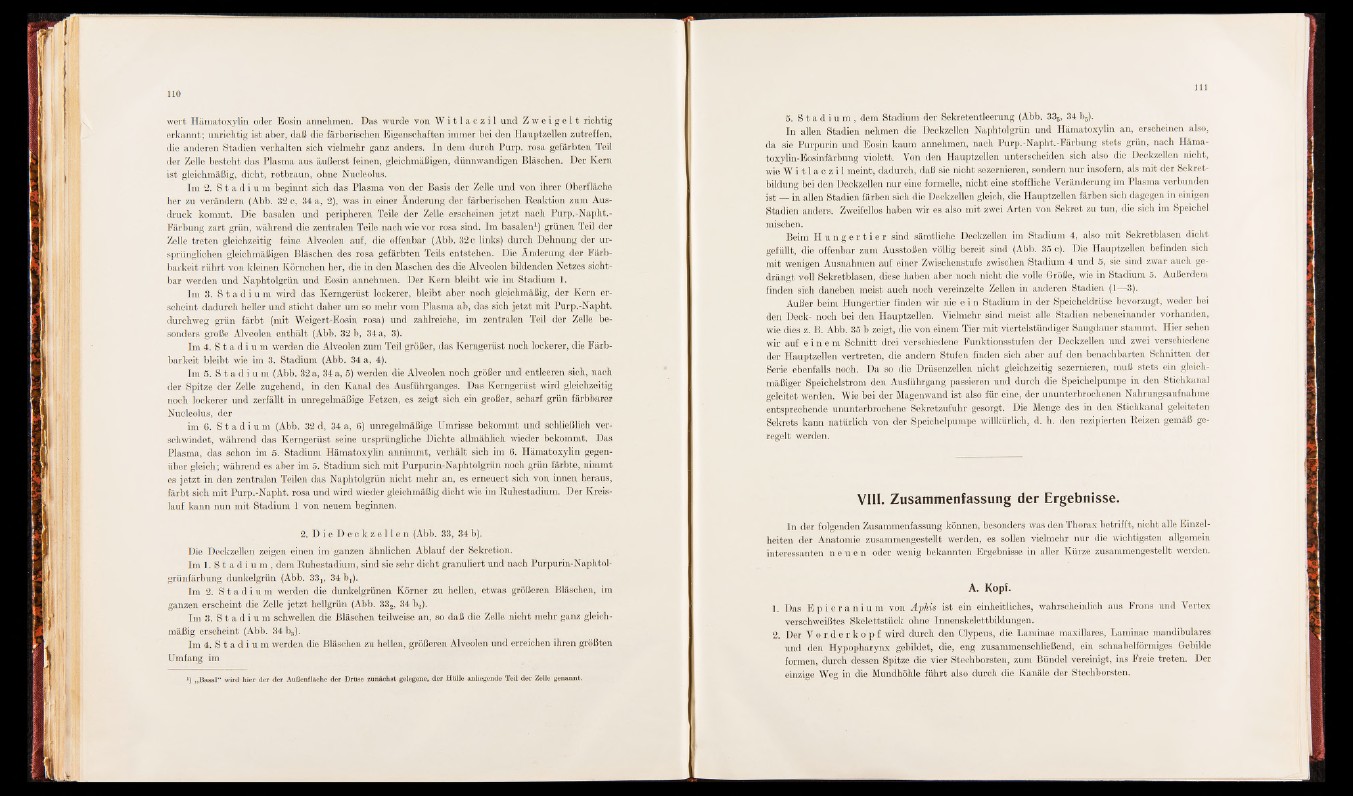
wert Hämatoxylin oder Eosin annehmen. Das wurde von W i t 1 a c z i 1 und Z w e i g e l t richtig
erkannt; unrichtig ist aber, daß die färberischen Eigenschaften immer bei den Hauptzellen zutreffen,
die anderen Stadien verhalten sich vielmehr ganz anders. In dem durch Purp, rosa gefärbten Teil
der Zelle besteht das Plasma aus äußerst feinen, gleichmäßigen, dünnwandigen Bläschen. Der Kern
ist gleichmäßig, dicht, rotbraun, ohne Nucleolus.
Im 2. S t a d i u m beginnt sich das Plasma von der Basis der Zelle und von ihrer Oberfläche
her zu verändern (Abb. 32 c, 34 a, 2), was in einer Änderung der färberischen Reaktion zum Ausdruck
kommt. Die basalen und peripheren Teile der Zelle erscheinen jetzt nach Purp.-Napht. -
Färbung zart grün, während die zentralen Teile nach wie vor rosa sind. Im basalen1) grünen Teil der
Zelle treten gleichzeitig feine Alveolen auf, die offenbar (Abb. 32 c links) durch Dehnung der ursprünglichen
gleichmäßigen Bläschen des rosa gefärbten Teils entstehen. Die Änderung der Färbbarkeit
rührt von kleinen Körnchen her, die in den Maschen des die Alveolen bildenden Netzes sichtbar
werden und Naphtolgrün und Eosin annehmen. Der Kern bleibt wie im Stadium 1.
Im 3. S t a d i u m wird das Kerngerüst lockerer, bleibt aber noch gleichmäßig, der Kern erscheint
dadurch heller und sticht daher um so mehr vom Plasma ab, das sich jetzt mit Purp.-Napht.
durchweg grün färbt (mit Weigert-Eosin rosa) und zahlreiche, im zentralen Teil der Zelle besonders
große Alveolen enthält (Abb. 32 b, 34 a, 3).
Im 4. S t a d i u m werden die Alveolen zum Teil größer, das Kerngerüst noch lockerer, die Färbbarkeit
bleibt wie im 3. Stadium (Abb. 34 a, 4).
Im 5. S t a d i u m (Abb. 32 a, 34 a, 5) werden die Alveolen noch größer und entleeren sich, nach
der Spitze der Zelle zugehend, in den Kanal des Ausführganges. Das Kerngerüst wird gleichzeitig
noch lockerer und zerfällt in unregelmäßige Fetzen, es zeigt sich ein großer, scharf grün färbbarer
Nucleolus, der
im 6. S t a d i u m (Abb. 32 d, 34 a, 6) unregelmäßige Umrisse bekommt und schließlich verschwindet,
während das Kerngerüst seine ursprüngliche Dichte allmählich wieder bekommt. Das
Plasma, das schon im 5. Stadium Hämatoxylin annimmt, verhält sich im 6. Hämatoxylin gegenüber
gleich; während es aber im 5. Stadium sich mit Purpurin-Naphtolgrün noch grün färbte, nimmt
es jetzt in den zentralen Teilen das Naphtolgrün nicht mehr an, es erneuert sich von innen heraus,
färbt sich mit Purp.-Napht. rosa und wird wieder gleichmäßig dicht wie im Ruhestadium. Der Kreislauf
kann nun mit Stadium 1 von neuem beginnen.
2. D i e D e c k z e l l e n (Abb. 33, 3 4 b).
Die Deckzellen zeigen einen im ganzen ähnlichen Ablauf der Sekretion.
Im 1.S t a d i u m , dem Ruhestadium, sind sie sehr dicht granuliert und nach Purpurin-Naphtol-
grünfärbung dunkelgrün (Abb. 331} 34 bj).
Im 2. S t a d i u m werden die dunkelgrünen Körner zu hellen, etwas größeren Bläschen, im
ganzen erscheint die Zelle jetzt hellgrün (Abb. 332, 34 b2).
Im 3. S t a d i u m schwellen die Bläschen teilweise an, so daß die Zelle nicht mehr ganz gleichmäßig
erscheint (Abb. 34 b3).
Im 4. S t a d i u m werden die Bläschen zu hellen, größeren Alveolen und erreichen ihren größten
Umfang im
i) „Basal“ wird hier der der Außenfläche der Drüse zunächst gelegene, der Hülle anliegende Teil der Zelle genannt.
5. S t a d i u m , dem Stadium der Sekretentleerung (Abb. 335, 34 b5).
In allen Stadien nehmen die Deckzellen Naphtolgrün und Hämatoxylin an, erscheinen also,
da sie Purpurin und Eosin kaum annehmen, nach Purp.-Napht.-Färbung stets grün, nach Häma-
toxylin-Eosinfärbung violett. Von den Hauptzellen unterscheiden sich also die Deckzellen nicht,
wie W i 1 1 a c z i 1 meint, dadurch, daß sie nicht sezernieren, sondern nur insofern, als mit der Sekretbildung
bei den Deckzellen nur eine formelle, nicht eine stoffliche Veränderung im Plasma verbunden
ist — in allen Stadien färben sich die Deckzellen gleich, die Hauptzellen färben sich dagegen in einigen
Stadien anders. Zweifellos haben wir es also mit zwei Arten von Sekret zu tun, die sich im Speichel
mischen.
Beim H u n g e r t i e r sind sämtliche Deckzellen im Stadium 4, also mit Sekretblasen dicht
gefüllt, die offenbar zum Ausstößen völlig bereit sind (Abb. 35 c). Die Hauptzellen befinden sich
mit wenigen Ausnahmen auf einer Zwischenstufe zwischen Stadium 4 und 5, sie sind zwar auch gedrängt
voll Sekretblasen, diese haben aber noch nicht die volle Größe, wie in Stadium 5. Außerdem
finden sich daneben meist auch noch vereinzelte Zellen in anderen Stadien (1—3).
Außer beim Hungertier finden wir nie e i n Stadium in der Speicheldrüse bevorzugt, weder bei
den Deck- noch bei den Hauptzellen. Vielmehr sind meist alle Stadien nebeneinander vorhanden,
wie dies z. B. Abb. 35 b zeigt, die von einem Tier mit viertelstündiger Saugdauer stammt. Hier sehen
wir auf e i n e m Schnitt drei verschiedene Funktionsstufen der Deckzellen und zwei verschiedene
der Hauptzellen vertreten, die ändern Stufen finden sich aber auf den benachbarten Schnitten der
Serie ebenfalls noch. Da so die Drüsenzellen nicht gleichzeitig sezernieren, muß stets ein gleichmäßiger
Speichelstrom den Ausführgang passieren und durch die Speichelpumpe in den Stichkanal
geleitet werden. Wie bei der Magenwand ist also für eine, der ununterbrochenen Nahrungsaufnahme
entsprechende ununterbrochene Sekretzufuhr gesorgt. Die Menge des in den Stichkanal geleiteten
Sekrets kann natürlich von der Speichelpumpe willkürlich, d. h. den rezipierten Reizen gemäß geregelt
werden.
VIII. Zusammenfassung der Ergebnisse.
In der folgenden Zusammenfassung können, besonders was den Thorax betrifft, nicht alle Einzelheiten
der Anatomie zusammengestellt werden, es sollen vielmehr nur die wichtigsten allgemein
interessanten n e u e n oder wenig bekannten Ergebnisse in aller Kürze zusammengestellt werden.
A. Kopf.
1. Das E p i c r a n i u m von Aphis ist ein einheitliches, wahrscheinlich aus Frons und Vertex
verschweißtes Skelettstück ohne Innenskelettbildungen.
2. Der V o r d e r k o p f wird durch den Clypeus, die Laminae maxillares, Laminae mandibulares
und den Hypopharynx gebildet, die, eng zusammenschließend, ein schnabelförmiges Gebilde
formen, durch dessen Spitze die vier Stechborsten, zum Bündel vereinigt, ins Freie treten. Der
einzige Weg in die Mundhöhle führt also durch die Kanäle der Stechborsten.