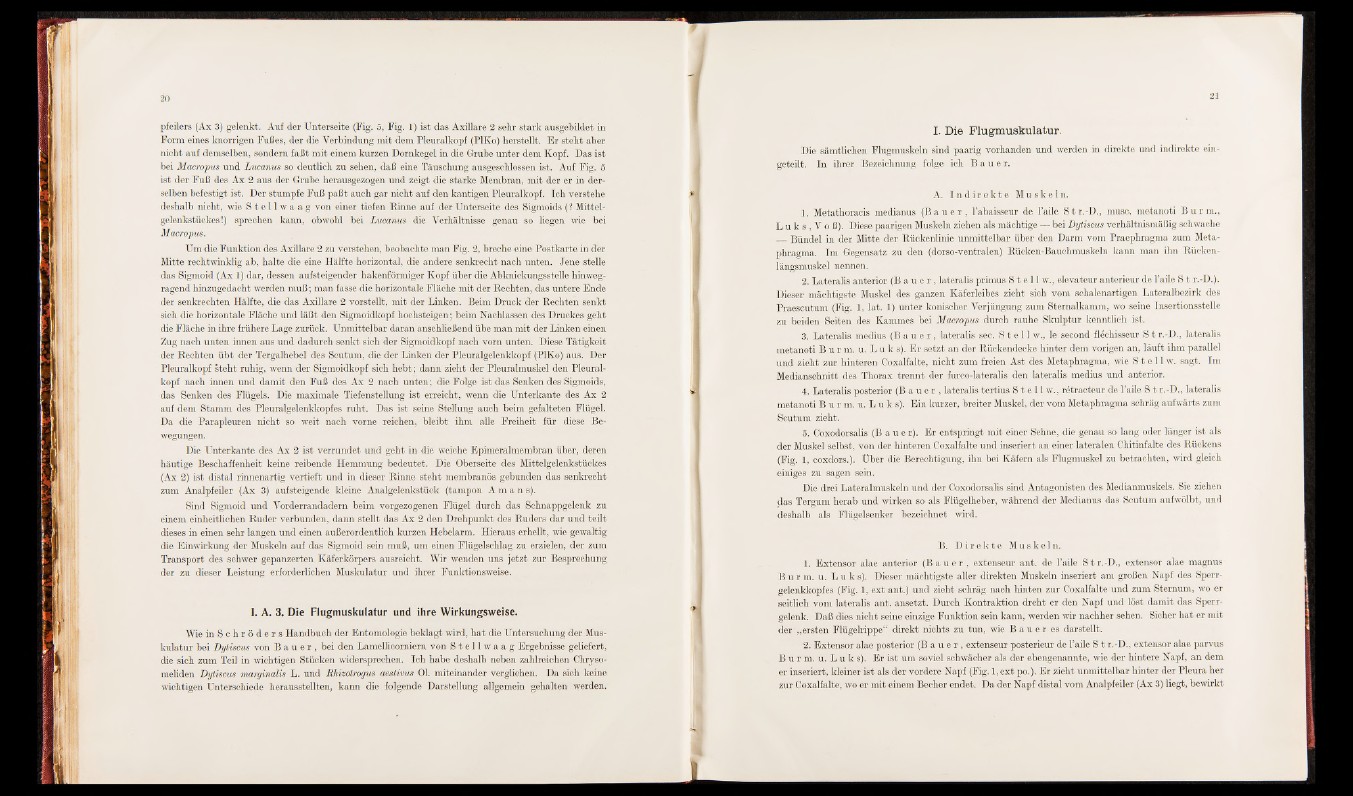
pfeilers (Ax 3) gelenkt. Auf der Unterseite (Fig. 5, Fig. 1) ist das Axillare 2 sehr stark ausgebildet in
Form eines knorrigen Fußes, der die Verbindung mit dem Pleuralkopf (PIKo) herstellt. Er steht aber
nicht auf demselben, sondern faßt mit einem kurzen Dornkegel in die Grube unter dem Kopf. Das ist
bei Macropus und Lucanus so deutlich zu sehen, daß eine Täuschung ausgeschlossen ist. Auf Fig. 5
ist der Fuß des Ax 2 aus der Grube herausgezogen und zeigt die starke Membran, mit der er in derselben
befestigt ist. Der stumpfe Fuß paßt auch gar nicht auf den kantigen Pleuralkopf. Ich verstehe
deshalb nicht, wie S t e l l w a a g von einer tiefen Rinne auf der Unterseite des Sigmoids (? Mittelgelenkstückes!)
sprechen kann, obwohl bei Lucanus die Verhältnisse genau so liegen wie bei
Macro'pus.
Um die Funktion des Axillare 2 zu verstehen, beobachte man Fig. 2, breche eine Postkarte in der
Mitte rechtwinklig ab, halte die eine Hälfte horizontal, die andere senkrecht nach unten. Jene stelle
das Sigmoid (Ax 1) dar, dessen auf steigender hakenförmiger Kopf über die Abknickungsstelle hinwegragend
hinzugedacht werden muß; man fasse die horizontale Fläche mit der Rechten, das untere Ende
der senkrechten Hälfte, die das Axillare 2 vorstellt, mit der Linken. Beim Druck der Rechten senkt
sich die horizontale Fläche und läßt den Sigmoidkopf hochsteigen; beim Nachlassen des Druckes geht
die Fläche in ihre frühere Lage zurück. Unmittelbar daran anschließend übe man mit der Linken einen
Zug nach unten innen aus und dadurch senkt sich der Sigmoidkopf nach vorn unten. Diese Tätigkeit
der Rechten übt der Tergalhebel des Scutum, die der Linken der Pleuralgelenkkopf (PIKo) aus. Der
Pleuralkopf steht ruhig, wenn der Sigmoidkopf sich hebt; dann zieht der Pleuralmuskel den Pleuralkopf
nach innen und damit den Fuß des Ax 2 nach unten; die Folge ist das Senken des Sigmoids,
das Senken des Flügels. Die maximale Tiefenstellung ist erreicht, wenn die Unterkante des Ax 2
auf dem Stamm des Pleuralgelenkkopfes ruht. Das ist seine Stellung auch beim gefalteten Flügel.
Da die Parapleuren nicht so weit nach vorne reichen, bleibt ihm alle Freiheit für diese Bewegungen.
Die Unterkante des Ax 2 ist verrundet und geht in die weiche Epimeralmembran über, deren
häutige Beschaffenheit keine reibende Hemmung bedeutet. Die Oberseite des Mittelgelenkstückes
(Ax 2) ist distal rinnenartig vertieft und in dieser Rinne steht membranös gebunden das senkrecht
zum Analpfeiler (Ax 3) aufsteigende kleine Analgelenkstück (tampon A m a n s).
Sind Sigmoid und Vorderrandadern beim vorgezogenen Flügel durch das Schnappgelenk zu
einem einheitlichen Ruder verbunden, dann stellt das Ax 2 den Drehpunkt des Ruders dar und teilt
dieses in einen sehr langen und einen außerordentlich kurzen Hebelarm. Hieraus erhellt, wie gewaltig
die Einwirkung der Muskeln auf das Sigmoid sein muß, um einen Flügelschlag zu erzielen, der zum
Transport des schwer gepanzerten Käferkörpers ausreicht. Wir wenden uns jetzt zur Besprechung
der zu dieser Leistung erforderlichen Muskulatur und ihrer Funktionsweise.
I. A. 3. Die Flugmuskulatur und ihre Wirkungsweise.
Wie i n S c h r ö d e r s Handbuch der Entomologie beklagt wird, hat die Untersuchung der Muskulatur
bei Dytiscus von B a u e r , bei den Lamellicorniern von S t e l l w a a g Ergebnisse geliefert,
die sich zum Teil in wichtigen Stücken widersprechen. Ich habe deshalb neben zahlreichen Chryso-
meliden Dytiscus marginalis L. und Rhizotrogus aestivus 01. miteinander verglichen. Da sich keine
wichtigen Unterschiede herausstellten, kann die. folgende Darstellung allgemein gehalten werden.
I. D ie F lu gm u sku la tu r.
Die sämtlichen Flugmuskeln sind paarig vorhanden und werden in direkte und indirekte eingeteilt.
In ihrer Bezeichnung folge ich B a u e r .
A. I n d i r e k t e Mu s k e l n .
1. Metathoracis medianus ( B a u e r , l’abaisseur de l’aile S t r.-D., musc, metanoti B u r m.,
L u k s , V o ß). Diese paarigen Muskeln ziehen als mächtige — bei Dytiscus verhältnismäßig schwache
§§ Bündel in der Mitte der Rückenlinie unmittelbar über den Darm vom Praephragma zum Meta-
phragma. Im Gegensatz zu den (dorso-ventralen) Rücken-Bauchmuskeln kann man ihn Rückenlängsmuskel
nennen.
2. Lateralis anterior ( B a u e r , lateralis primus S t e 11 w., elevateur antérieur de l’aile S t r.-D.).
Dieser mächtigste Muskel des ganzen Käferleibes zieht sich vom schalenartigen Lateralbezirk des
Praescutum (Fig. 1, lat. 1) unter konischer Verjüngung zum Sternalkamm, wo seine Insertionsstelle
zu beiden Seiten des Kammes bei Macropus durch rauhe Skulptur kenntlich ist.
3. Lateralis medius ( B a u e r , lateralis sec. S t e 11 w., le second fléchisseur S t r.-D., lateralis
metanoti B u r m . u. L u k s). Er setzt an der Rückendecke hinter dem vorigen an, läuft ihm parallel
und zieht zur hinteren Coxalfalte, nicht zum freien Ast des Metaphragma, wie S t e 11 w. sagt. Im
Medianschnitt des Thorax trennt der furco-lateralis den lateralis medius und anterior.
4. Lateralis posterior ( B a u e r , lateralis tertius S t e 11 w., rétracteur de l’aile S t r.-D., lateralis
metanoti B u r m. u. L u k s). Ein kurzer, breiter Muskel, der vom Metaphragma schräg aufwärts zum
Scutum zieht.
5. Coxodorsalis ( B a u e r). Er entspringt mit einer Sehne, die genau so lang oder länger ist als
der Muskel selbst, von der hinteren Coxalfalte und inseriert an einer lateralen Chitinfalte des Rückens
(Fig. 1, Coxdors.). Über die Berechtigung, ihn bei Käfern als Flugmuskel zu betrachten, wird gleich
einiges zu sagen sein.
Die drei Lateralmuskeln und der Coxodorsalis sind Antagonisten des Medianmuskels. Sie ziehen
das Tergum herab und wirken so als Flügelheber, während der Medianus das Scutum aufwölbt, und
deshalb als Flügelsenker bezeichnet wird.
B. D i r e k t e Mu s k e l n .
1. Extensor alae anterior ( B a u e r , extenseur ant. de l’aile S t r.-D., extensor alae magnus
B u r m . u. Luks ) . Dieser mächtigste aller direkten Muskeln inseriert am großen Napf des Sperr-
gelenkkopfes (Fig. 1, ext ant.) und zieht schräg nach hinten zur Coxalfalte und zum Sternum, wo er
seitlich vom lateralis ant. ansetzt. Durch Kontraktion dreht er den Napf und löst damit das Sperr-
gelenk. Daß dies nicht seine einzige Funktion sein kann, werden wir nachher sehen. Sicher hat er mit
der „ersten Flügelrippe“ direkt nichts zu tun, wie B a u e r es darstellt.
2. Extensor alae posterior ( B a u e r , extenseur postérieur de l’aile S t r.-D., extensor alae parvus
B u r m. u. L u k s). Er ist um soviel schwächer als der ebengenannte, wie der hintere Napf, an dem
er inseriert, kleiner ist als der vordere Napf (Fig. l,e x t po.). Er zieht unmittelbar hinter der Pleura her
zur Coxalfalte, wo er mit einem Becher endet. Da der Napf distal vom Analpfeiler (Ax 3) liegt, bewirkt