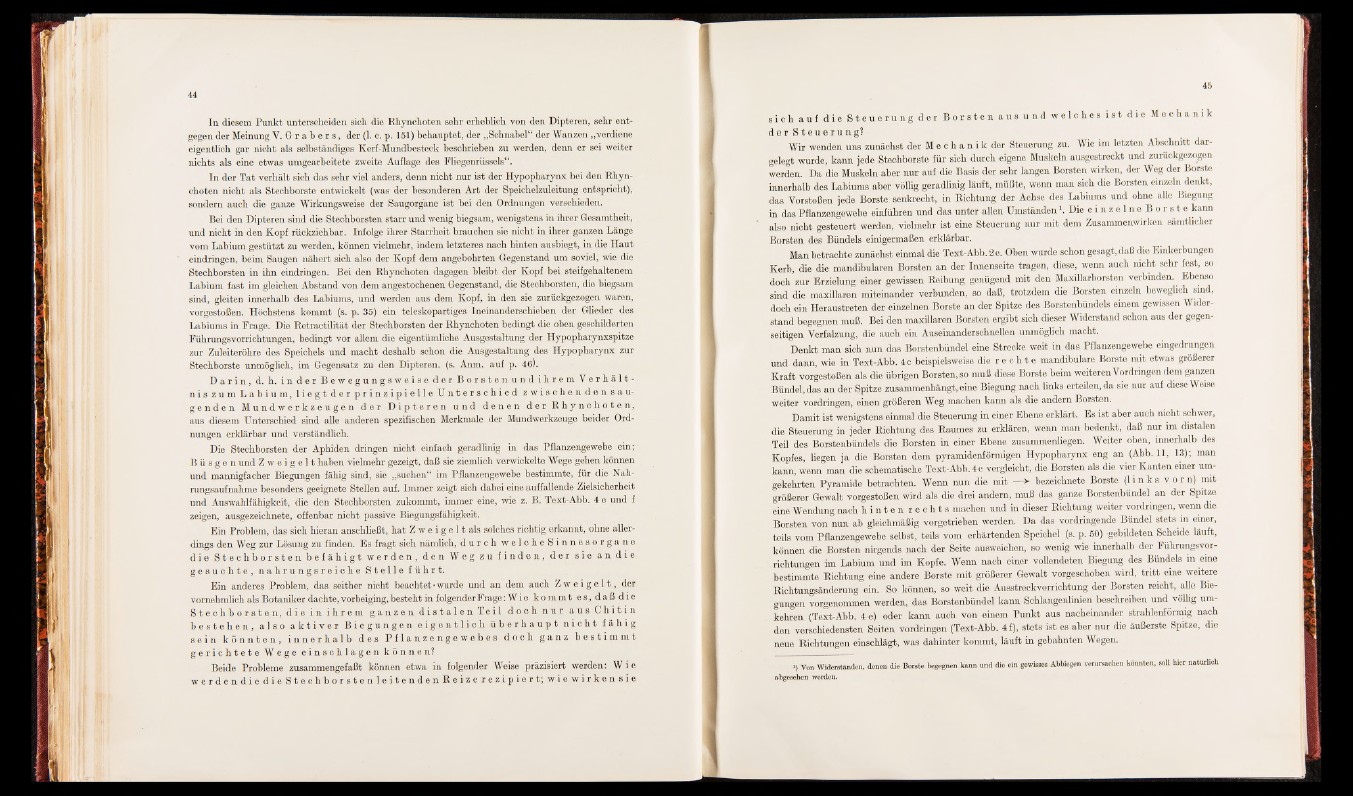
In diesem Punkt unterscheiden sich die Rhynchoten sehr erheblich von den Dipteren, sehr entgegen
der Meinung Y. G r a b e r s , der (1. c. p. 151) behauptet, der „Schnabel“ der Wanzen „verdiene
eigentlich gar nicht als selbständiges Kerf-Mundbesteck beschrieben zu werden, denn er sei weiter
nichts als eine etwas umgearbeitete zweite Auflage des Fliegenrüssels“.
In der Tat verhält sich das sehr viel anders, denn nicht nur ist der Hypopharynx bei den Rhynchoten
nicht als Stechborste entwickelt (was der besonderen Art der Speichelzuleitung entspricht),
sondern auch die ganze Wirkungsweise der Saugorgane ist bei den Ordnungen verschieden.
Bei den Dipteren sind die Stechborsten starr und wenig biegsam, wenigstens in ihrer Gesamtheit,
und nicht in den Kopf rückziehbar. Infolge ihrer Starrheit brauchen sie nicht in ihrer ganzen Länge
vom Labium gestützt zu werden, können vielmehr, indem letzteres nach hinten ausbiegt, in die Haut
eindringen, beim Saugen nähert sich also der Kopf dem angebohrten Gegenstand um soviel, wie die
Stechborsten in ihn eindringen. Bei den Rhynchoten dagegen bleibt der Kopf bei steif gehaltenem
Labium fast im gleichen Abstand von dem angestochenen Gegenstand, die Stechborsten, die biegsam
sind, gleiten innerhalb des Labiums, und werden aus dem Kopf, in den sie zurückgezogen waren,
vorgestoßen. Höchstens kommt (s. p. 35) ein teleskopartiges Ineinanderschieben der Glieder des
Labiums in Frage. Die Retractilität der Stechborsten der Rhynchoten bedingt die oben geschilderten
Führungsvorrichtungen, bedingt vor allem die eigentümliche Ausgestaltung der Hypopharynxspitze
zur Zuleiteröhre des Speichels und macht deshalb schon die Ausgestaltung des Hypopharynx zur
Stechborste unmöglich, im Gegensatz zu den Dipteren, (s. Anm. auf p. 46).
D a r i n , d. h. i n d e r B e w e g u n g s w e i s e d e r B o r s t e n u n d i h r e m V e r h ä l t n
i s z um L a b i u m , l i e g t d e r p r i n z i p i e l l e U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n s a u g
e n d e n M u n d w e r k z e u g e n d e r D i p t e r e n u n d d e n e n d e r R h y n c h o t e n ,
aus diesem Unterschied sind alle anderen spezifischen Merkmale der Mundwerkzeuge beider Ordnungen
erklärbar und verständlich.
Die Stechborsten der Aphiden dringen nicht einfach geradlinig in das Pflanzengewebe ein;
B ü s g e n und Z w e i g e l t haben vielmehr gezeigt, daß sie ziemlich verwickelte Wege gehen können
und mannigfacher Biegungen fähig sind, sie „suchen“ im Pflanzengewebe bestimmte, für die Nahrungsaufnahme
besonders geeignete Stellen auf. Immer zeigt sich dabei eine auffallende Zielsicherheit
und Auswahlfähigkeit, die den Stechborsten zukommt, immer eine, wie z. B. Text-Abb. 4 e und f
zeigen, ausgezeichnete, offenbar nicht passive Biegungsfähigkeit.
Ein Problem, das sich hieran anschließt, hat Z w e i g e l t als solches richtig erkannt, ohne allerdings
den Weg zur Lösung zu finden. Es fragt sich nämlich, d u r c h w e l c h e S i n n e s o r g a n e
d i e S t e c h b o r s t e n b e f ä h i g t w e r d e n , d e n W e g z u f i n d e n , d e r s i e a n d i e
g e s u c h t e , n a h r u n g s r e i c h e S t e l l e f ü h r t .
Ein anderes Problem, das seither nicht beachtet*wurde und an dem auch Z w e i g e l t , der
vornehmlich als Botaniker dachte, vorbeiging, besteht in folgender Frage :Wie k o mmt es, d a ß die
S t e c h b o r s t e n , d i e i n i h r e m g a n z e n d i s t a l e n T e i l d o c h n u r a u s C h i t i n
b e s t e h e n , a l s o a k t i v e r B i e g u n g e n e i g e n t l i c h ü b e r h a u p t n i c h t f ä h i g
s e i n k ö n n t e n , i n n e r h a l b d e s P f 1 a n z e n g e w e b e s d o c h g a n z b e s t i m m t
g e r i c h t e t e W e g e e i n s c h l a g e n k ö n n e n ?
Beide Probleme zusammengefaßt können etwa in folgender Weise präzisiert werden: W i e
w e r d e n d i e d i e S t e c h b o r s t e n l e i t e n d e n R e i z e r e z i p i e r t ; wi e w i r k e n s i e
s i c h a u f d i e S t e u e r u n g d e r B o r s t e n a u s u n d w e l c h e s i s t d i e M e c h a n i k
d e r S t e u e r u n g ?
Wir wenden uns zunächst der M ecl i a n i k der Steuerung zu. Wie im letzten Abschnitt dargelegt
wurde, kann jede Stechborste für sich durch eigene Muskeln ausgestreckt und zurückgezogen
werden. Da die Muskeln aber nur auf die Basis der sehr langen Borsten wirken, der Weg der Borste
innerhalb des Labiums aber völlig geradlinig läuft, müßte, wenn man sich die Borsten einzeln denkt,
das Vorstoßen jede Borste senkrecht, in Richtung der Achse des Labiums und ohne alle Biegung
in das Pflanzengewebe einführen und das unter allen Umständen'. Die e i n z e l n e B o r s t e kann
also nicht gesteuert werden, vielmehr ist eine Steuerung nur mit dem Zusammenwirken sämtlicher
Borsten des Bündels einigermaßen erklärbar.
Man betrachte zunächst einmal die Text-Abb. 2 e. Oben wurde schon gesagt, daß die Einkerbungen
Kerb, die die mandibularen Borsten an der Innenseite tragen, diese, wenn auch nicht sehr fest, so
doch zur Erzielung einer gewissen Reibung genügend mit den Maxillarborsten verbinden. Ebenso
sind dih maxillaren miteinander verbunden, so daß, trotzdem die Borsten einzeln beweglich sind,
doch ein Heraustreten der einzelnen.Borste an der Spitze des Borstenbündels einem gewissen Widerstand
begegnen muß. Bei den maxillaren Borsten ergibt sich dieser Widerstand schon aus der gegenseitigen
Verfalzung, die auch ein Auseinanderschnellen unmöglich macht.
Denkt man sich nun das Borstenbündel eine Strecke weit in das Pflanzengewebe eingedrungen
und dann, wie in Text-Abb. 4 c beispielsweise die r e c h t e mandibulare Borste mit etwas größerer
Kraft vorgestoßen als die übrigen Borsten, so muß diese Borste beim weiteren Vordringen dem ganzen
Bündel, das an der Spitze zusammenhängt, eine Biegung nach links erteilen, da sie nur auf diese Weise
weiter Vordringen, einen größeren Weg machen kann als die ändern Borsten.
Damit ist wenigstens einmal die Steuerung in einer Ebene erklärt. Es ist aber auch nicht schwer,
die Steuerung in jeder Richtung des Raumes zu erklären, wenn man bedenkt, daß nur im distalen
Teil des Borstenbündels die Borsten in einer Ebene zusammenhegen. Weiter oben, innerhalb des
Kopfes, hegen ja die Borsten dem pyramidenförmigen Hypopharynx eng an (Abb. 11, 13); man
kann, wenn man die schematische Text-Abb. 4 c vergleicht, die Borsten als die vier Kanten einer umgekehrten
Pyramide betrachten. Wenn nun die mit — >- bezeichnete Borste (1 i n k s v o r n) mit
größerer Gewalt vorgestoßen wird als die drei ändern, muß das ganze Borstenbündel an der Spitze
eine Wendung nach h i n t e n r | | h t s machen und in dieser Richtung weiter Vordringen, wenn die
Borsten von nun ab gleichmäßig vorgetrieben werden. Da das vordringende Bündel stets in einer,
teils vom Pflanzengewebe selbst, teils vom erhärtenden Speichel (s. p. 50) gebildeten Scheide lauft,
können die Borsten nirgends nach der Seite ausweichen, so wenig wie innerhalb der hührungsvor-
..richtungen im Labium und im Kopfe. Wenn nach einer vollendeten Biegung des Bündels in eine
bestimmte Richtung eine andere Borste mit größerer Gewalt vorgeschoben wird, tr itt eine weitere
Richtungsänderung ein. So können, so weit die Ausstreckvorrichtung der Borsten reicht, alle Biegungen
vorgenommen werden, das Borstenbündel kann Schlangenlinien beschreiben und völlig umkehren
(Text-Abb. 4e) oder kann auch von einem Punkt aus nacheinander strahlenförmig nach
den verschiedensten Seiten Vordringen (Text-Abb. 4 f), stets ist es aber nur die äußerste Spitze, die
neue Richtungen einschlägt, was dahinter kommt, läuft in gebahnten Wegen.
¿ Ö j ,V o n Widerständen, denen die Borste begegnen kann n nd die ein gewisses Abbiegen verursachen könnten, soll hier natürlich
abgesehen werden.