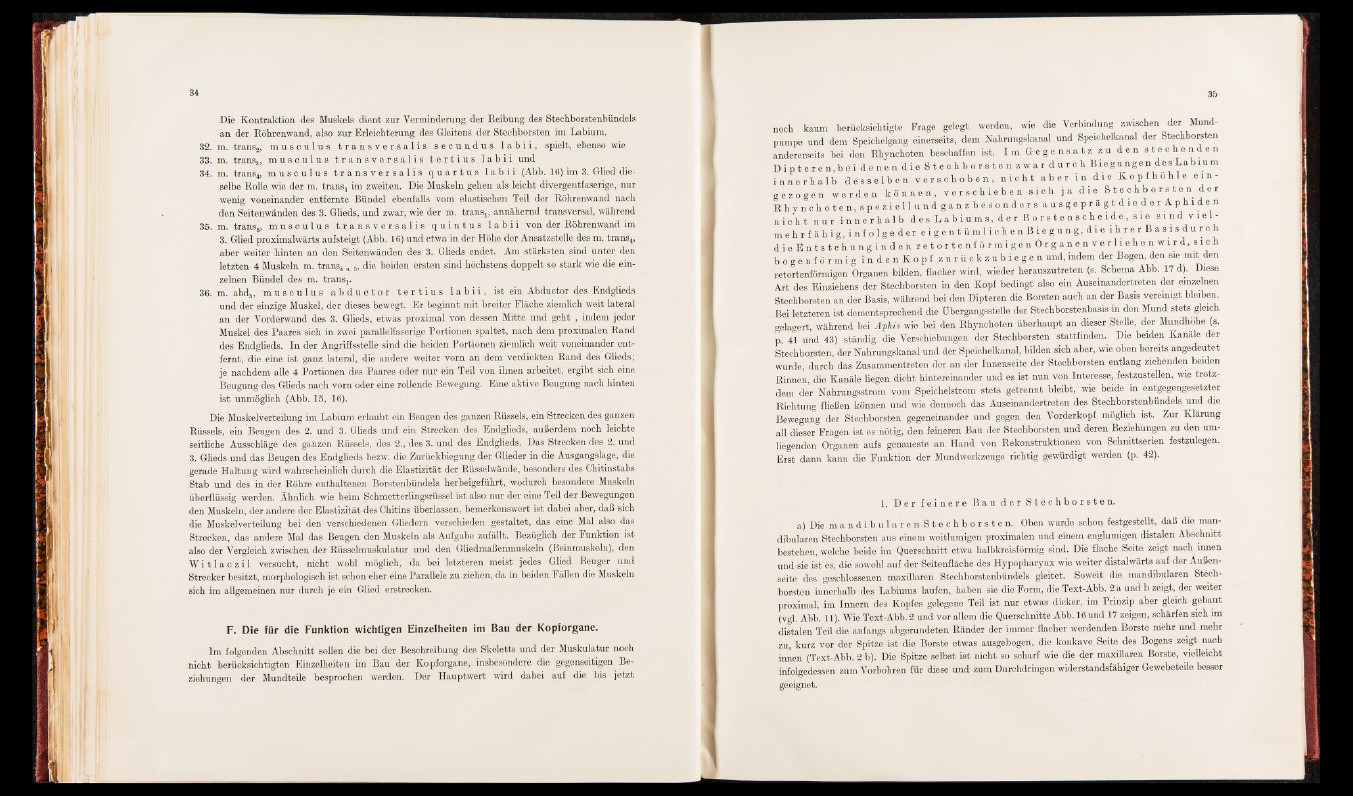
Die Kontraktion des Muskels dient zur Verminderung der Reibung des Stecbborstenbündels
an der Röhrenwand, also zur Erleichterung des Gleitens der Stecbborsten im Labium.
32. m. trans2, m u s c u l u s t r a n s v e r s a l i s s e c u n d u s l a b i i , spielt, ebenso wie
33. m. trans3, m u s c u l u s t r a n s v e r s ä l i s t e r t i u s l a b i i und
34. m. trans4, m u s c u l u s t r a n s v e r s a l i s q u a r t t i s l a b i i (Abb. 16) im 3. Glied dieselbe
Rolle wie der m. transj im zweiten. Die Muskeln geben als leicbt divergentfaserige, nur
wenig voneinander entfernte Bündel ebenfalls vom elastischen Teil der Röbrenwand nach
den Seitenwänden des 3. Glieds, und zwar, wie der m. transl5 annähernd transversal, während
35. m. trans5, m u s c u l u s t r a n s v e r s a l i s q u i n t u s l a b i i von der Röhrenwand im
3. Glied proximalwärts auf steigt (Abb. 16) und etwa in der Höhe der Ansatzstelle des m. trans4,
aber weiter hinten an den Seitenwänden des 3. Glieds endet. Am stärksten sind unter den
letzten 4 Muskeln m. trans4 u 5, die beiden ersten sind höchstens doppelt so stark wie die einzelnen
Bündel des m. transj.
36. m. abd3, m u s c u l u s a b d u c t o r t e r t i u s l a b i i , ist ein Abductor des Endglieds
und der einzige Muskel, der dieses bewegt. Er beginnt mit breiter Fläche ziemlich weit lateral
an der Vorderwand des 3. Glieds, etwas proximal von dessen Mitte und geht , indem jeder
Muskel des Paares sich in zwei parallelfaserige Portionen spaltet, nach dem proximalen Rand
des Endglieds. In der Angriffsstelle sind die beiden Portionen ziemlich weit voneinander entfernt,
die eine ist ganz lateral, die andere weiter vorn an dem verdickten Rand des Glieds;
je nachdem alle 4 Portionen des Paares oder nur ein Teil von ihnen arbeitet, ergibt sich eine
Beugung des Glieds nach vorn oder eine rollende Bewegung. Eine aktive. Beugung nach hinten
ist unmöglich (Abb. 15, 16).
Die Muskelverteilung im Labium erlaubt ein Beugen des ganzen Rüssels, ein Strecken des ganzen
Rüssels, ein Beugen des 2. und 3. Glieds und ein Strecken des Endglieds, außerdem noch leichte
seitliche Ausschläge des ganzen Rüssels, des 2., des 3. und des Endglieds. Das Strecken des 2. und
3. Glieds und das Beugen des Endglieds bezw. die Zurückbiegung der Glieder in die Ausgangslage, die
gerade Haltung wird wahrscheinlich durch die Elastizität der Rüsselwände, besonders des Chitinstabs
Stab und des in der Röhre enthaltenen Borstenbündels herbeigeführt, wodurch besondere Muskeln
überflüssig werden. Ähnlich wie beim Schmetterlingsrüssel ist also nur der eine Teil der Bewegungen
den Muskeln, der andere der Elastizität des Chitins überlassen, bemerkenswert ist dabei aber, daß sich
die Muskelverteilung bei den verschiedenen Gliedern verschieden gestaltet, das eine Mal also das
Strecken, das andere Mal das Beugen den Muskeln als Aufgabe zufällt. Bezüglich der Funktion ist
also der Vergleich zwischen der Rüsselmuskulatur und den Gliedmaßenmuskeln (Beinmuskeln), den
W i t l a c z i l versucht, nicht wohl möglich, da bei letzteren meist jedes Glied Beuger und
Strecker besitzt, morphologisch ist schon eher eine Parallele zu ziehen, da in beiden Fällen die Muskeln
sich im allgemeinen nur durch je ein Glied erstrecken.
F. Die für die Funktion wichtigen Einzelheiten im Bau der Kopforgane.
Im folgenden Abschnitt sollen die bei der Beschreibung des Skeletts und der Muskulatur noch
nicht berücksichtigten Einzelheiten im Bau der Kopforgane, insbesondere die gegenseitigen Beziehungen
der Mundteile besprochen werden. Der Hauptwert wird dabei auf die bis jetzt
noch kaum berücksichtigte Frage gelegt werden, wie die Verbindung zwischen der Mund-
pumpe und dem Speichelgang einerseits, dem Nahrungskanal und Speichelkanal der Stechborsten
andererseits bei den Rhynchoten beschaffen ist. Im G e g e n s a t z z u d e n s t e c h e n d e n
D i p t e r e n , b e i - d e n e n d i e S t e c. h l> o r s t e 11 z W a r d u r c h Bi e g u n g e n d e s L a b i um
i n n e r h a l b d e s s e l b e n v e r s c h o b e n , n i c h t . a b e r i n d i e K o p f h o h l e e i n -
g é z o g e n w e r d e n k ö n n e n , v e r s c h i e b e n s i c h j a d i e S t e c h b ö r s t e n d e r
R h y n c h 0 t e 11, s p ez i - e l l u n d g a n z b es o n d e r z a u s g e p r ä g t d i e d e r A. p h i d e n
n i c h t n u r i n n e r h a l b d es: L a b i u m s> d e r B o r s t e n s c h e i d e , s i e s i n d v i e l -
me h r f ä h ig, i nf o l.ge d e r e i g e n t ü m l B h e n B i e g u n g . d i e i h r e r B a s i s d u r c h
d i e E n t s t e h u n g i n d e n r e t o r t e n f ö r m i g e n O r g a n e n v e r l i e h e n w i r d , s i c h
b o g e ;n f Ö r m i g i n d e n K o p f z u r ü c k z ' u h i e g e n und, indem der Bogen, den sie mit den
retortenförmigen Organen bilden, flacher wird, wieder herauszutreten (s. Schema Abb. 17 d). Diese
Art des t w -h e r ,* der gteehborsten in den Kopf bedingt also ein Auseinandertreten der einzelnen
s f ih b o rs te n aii der Basis, während bei den Dipteren die Borsten auch an der Basis vereinigt bleiben.
. Bei letzteren ist dementsprechend die Übergangsstelle der Stechborstenbasis in den Mund stets gleich
gelagert, während bei AvMs wie bei den Rhynchoten überhaupt an dieser Stelle, der Mundhöhe (s.
| t , 41 und 43) ständig die Verschiebungen der Stechborsten stattfinden. Die beiden Kanäle der
Htediborsten, der Nahrungskanal und der Speichelkanal, bilden sich aber, wie oben bereits angedeutet
wurde, durch das Zusammentreten der an der Innenseite der Stechhorsten entlang ziehenden beiden
Rinnen, die Kanäle liegen dicht hintereinander und es ist nun von Interesse, festzustellen, wie trotzdem
der Nahrungsstrom vom Speichelstrom stets getrennt bleibt, wie beide in entgegengesetzter
Richtung fließen können und wie dennoch das Auseinandertreten des Stechborstenbündels und die
Bewegung der Stecbborsten gegeneinander und gegen den Vorderkopf möglich ist. Zur Klärung
all dieser Fragen ist cs nötig, den feineren Bau der gteehborsten und deren Beziehungen zu den umliegenden
Organen aufs genaueste äh Hand von Rekonstruktionen von Schnittserien festzulegen.
1. D e r f e i n e r e B a u d e r S t e c h b o r s t e n .
a) Die m a n d i b u 1 a r e n S t e .c h b o r s t e n. Oben wurde schon festgestellt, daß die mandibularen
Stechborsten aus einem weitlumigen proximalen und einem englumigen distalen Abschnitt
bestehen, welche beide im Querschnitt etwa halbkreisförmig sind. Die flache Seite zeigt nach innen
und sie ist es, die sowohl auf der Seitenfläche des Hypopharynx, wie weiter distalwärts auf der Außenseite
des geschlossenen maxillaren Stechborstenbündels gleitet. Soweit die mandibularen Stechborsten
innerhalb des Labiums laufen, haben sie die Form, die Text-Abb. 2 a und b zeigt, der weiter
proximal, im Innern des Kopfes gelegene. Teil ist nur etwas dicket, im Prinzip aber gleich, gebaut
(vgl. Abb. 11). Wie Text-Abb. 2 und vor allem die Querschnitte Abb. 16 und 17 zeigen, schärfen sieh im
distalen Teil die anfangs abgerundeten Ränder der immer flacher werdenden Borste mehr und mehr
zu, kurz vor der Spitze ist die Borste’ etwas ausgebogen, die konkave Seite des Bogens zeigt nach
innen (Text-Abb. 2b). Die Spitze selbst ist nicht sö: scharf wie die der maxillaren Borste, vielleicht
infolgedessen zum Vorbohren für diese und zum Durchdringen widerstandsfähiger Gewebeteile besser
geeignet.