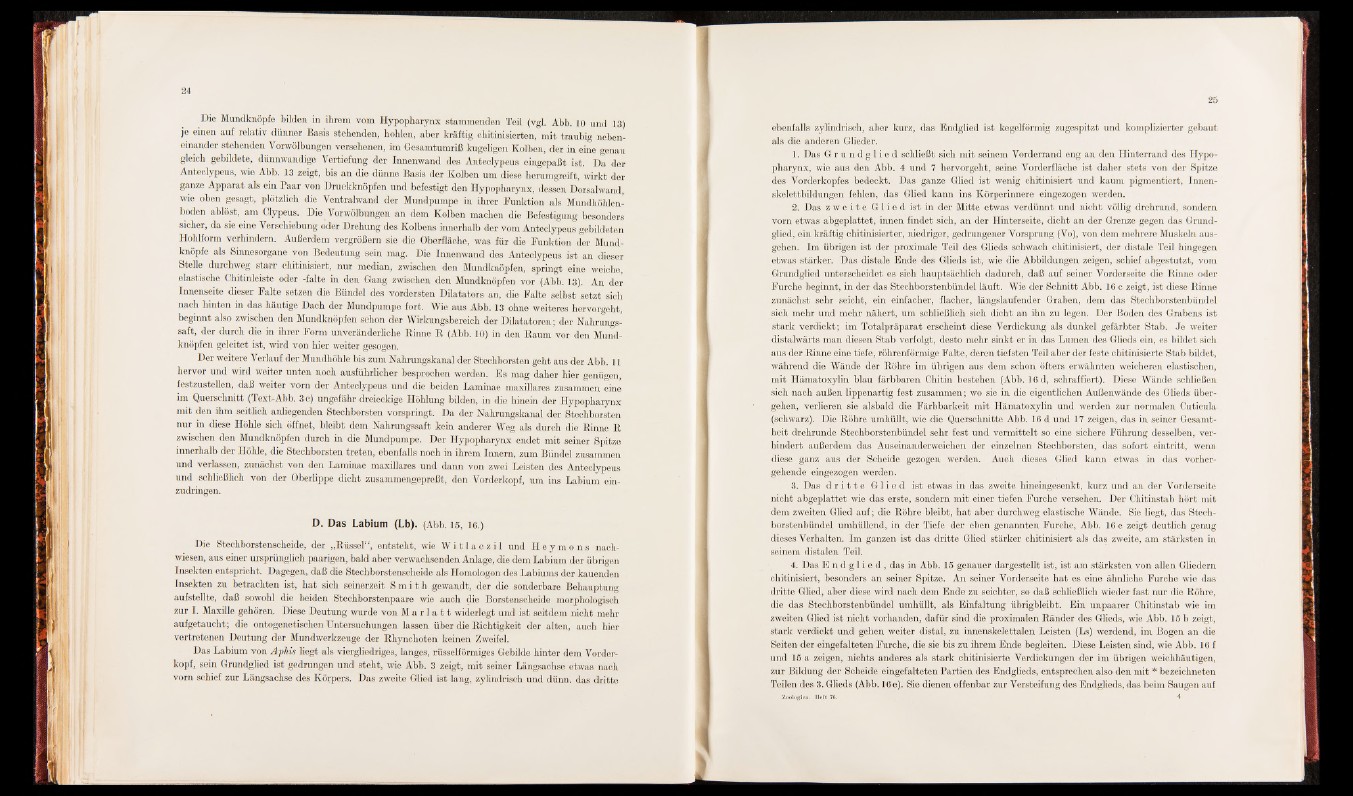
Die Mundknöpfe bilden in ihrem vom Hypopharynx stammenden Teil (vgl. Abb. 10 und 13)
je einen auf relativ dünner Basis stehenden, hohlen, aber kräftig chitinisierten, mit traubig nebeneinander
stehenden Vorwölbungen versehenen, im Gesamtumriß kugeligen Kolben, der in eine genau
gleich gebildete, dünnwandige Vertiefung der Innenwand des Anteclypeus eingepaßt ist. Da der
Anteclypeus, wie Abb. 13 zeigt, bis an die dünne Basis der Kolben um diese herumgreift, wirkt der
ganze Apparat als ein Paar von Druckknöpfen und befestigt den Hypopharynx, dessen Dorsalwand,
wie oben gesagt, plötzlich die Ventralwand der Mundpumpe in ihrer Funktion als Mundhöhlenboden
ablöst, am Clypeus. Die Vorwölbungen an dem Kolben machen die Befestigung besonders
sicher, da sie eine Verschiebung oder Drehung des Kolbens innerhalb der vom Anteclypeus gebildeten
Hohlform verhindern. Außerdem vergrößern sie die Oberfläche, was für die Funktion der Mundknöpfe
als Sinnesorgane von Bedeutung sein mag. Die Innenwand des Anteclypeus ist an dieser
Stelle durchweg starr ehitmisiert, nur median, zwischen den Mundknöpfen, springt eine weiche,
elastische Chitinleiste oder -falte in den Gang zwischen den Mundknöpfen vor (Abb. 13). An der
Innenseite dieser Falte setzen die Bündel des vordersten Dilatators an, die Falte selbst setzt sich
nach hinten in das häutige Dach der Mundpumpe fort. Wie aus Abb. 13 ohne weiteres hervorgeht,
beginnt also zwischen den Mundknöpfen schon der Wirkungsbereich der Dilatatoren; der Nahrungssaft,
der durch die in ihrer Form unveränderliche Rinne R (Abb. 10) in den Raum vor den Mundknöpfen
geleitet ist, wird von hier weiter gesogen.
Der weitere Verlauf der Mundhöhle bis zum Nahrungskanal der Stechborsten geht aus der Abb. 11
hervor und wird weiter unten noch ausführlicher besprochen werden. Es mag daher hier genügen,
festzustellen, daß weiter vorn der Anteclypeus und die beiden Laminae maxillares zusammen eine
im Querschnitt (Text-Abb. 3 c) ungefähr dreieckige Höhlung bilden, in die hinein der Hypopharynx
mit den ihm seitlich anliegenden Stechborsten vorspringt. Da der Nahrungskanal der Stechborsten
nur in diese Höhle sich öffnet, bleibt dem Nahrungssaft kein anderer Weg als durch die Rinne R
zwischen den Mundknöpfen durch in die Mundpumpe. Der Hypopharynx endet mit seiner Spitze
innerhalb der Höhle, die Stechborsten treten, ebenfalls noch in ihrem Innern, zum Bündel zusammen
und verlassen, zunächst von den Laminae maxillares und dann von zwei Leisten des Anteclypeus
und schließlich von der Oberlippe dicht zusammengepreßt, den Vorderkopf, um ins Labium ein-
zudringen.
D. Das Labium (Lb). (Abb. 15, 16.)
Die Stechborstenscheide, der „Rüssel“, entsteht, wie W i 1 1 a c z i 1 und H e y m o n s nachwiesen,
aus einer ursprünglich paarigen, bald aber verwachsenden Anlage, die dem Labium der übrigen
Insekten entspricht. Dagegen, daß die Stechborstenscheide als Homologon des Labiums der kauenden
Insekten zu betrachten ist, hat sich seinerzeit S m i t h gewandt, der die sonderbare Behauptung
aufstellte, daß sowohl die beiden Stechborstenpaare wie auch die Borstenscheide morphologisch
zur I. Maxille gehören. Diese Deutung wurde von M a r 1 a 11 widerlegt und ist seitdem nicht mehr
aufgetaucht; die ontogenetischen Untersuchungen lassen über die Richtigkeit der alten, auch hier
vertretenen Deutung der Mundwerkzeuge der Rhynchoten keinen Zweifel.
Das Labium von A'phis liegt als viergliedriges, langes, rüsselförmiges Gebilde hinter dem Vorderkopf,
sein Grundglied ist gedrungen und steht, wie Abb. 3 zeigt, mit seiner Längsachse etwas nach
vorn schief zur Längsachse des Körpers. Das zweite Glied ist lang, zylindrisch und dünn, das dritte
ebenfalls zylindrisch, aber kurz, das Endglied ist kegelförmig zugespitzt und komplizierter gebaut
als die anderen Glieder.
1. Das G r u n d g l i e d schließt sich mit seinem Vorderrand eng an den Hinterrand des Hypopharynx,
wie aus den Abb. 4 und 7 hervorgeht, seine Vorderfläche ist daher stets von der Spitze
des Vorderkopfes bedeckt. Das ganze Glied ist wenig chitinisiert und kaum pigmentiert, Innenskelettbildungen
fehlen, das Glied kann ins Körperinnere eingezogen werden.
2. Das z w e i t e G l i e d ist in der Mitte etwas verdünnt und nicht völlig drehrund, sondern
vorn etwas abgeplattet, innen findet sich, an der Hinterseite, dicht an der Grenze gegen das Grundglied,
ein kräftig chitinisierter, niedriger, gedrungener Vorsprung (Vo), von dem mehrere Muskeln ausgehen.
Im übrigen ist der proximale Teil des Glieds schwach chitinisiert, der distale Teil hingegen
etwas stärker. Das distale Ende des Glieds ist, wie die Abbildungen zeigen, schief abgestutzt, vom
Grundglied unterscheidet es sich hauptsächlich dadurch, daß auf seiner Vorderseite die Rinne oder
Furche beginnt, in der das Stechborstenbündel läuft. Wie der Schnitt Abb. 16c zeigt, ist diese Rinne
zunächst sehr seicht, ein einfacher, flacher, längslaufender Graben, dem das Stechborstenbündel
sich mehr und mehr nähert, um schließlich sich dicht an ihn zu legen. Der Boden des Grabens ist
stark verdickt; im Totalpräparat erscheint diese Verdickung als dunkel gefärbter Stab. Je weiter
distalwärts man diesen Stab verfolgt, desto mehr sinkt er in das Lumen des Glieds ein, es bildet sich
aus der Rinne eine tiefe, röhrenförmige Falte, deren tiefsten Teil aber der feste chitinisierte Stab bildet,
während die Wände der Röhre im übrigen aus dem schon öfters erwähnten weicheren elastischen,
mit Hämatoxylin blau färbbaren Chitin bestehen (Abb. 16 d, schraffiert). Diese Wände schließen
sich nach außen lippenartig fest zusammen; wo sie in die eigentlichen Außenwände des Glieds übergehen,
verlieren sie alsbald die Färbbarkeit mit Hämatoxylin und werden zur normalen Cuticula
(schwarz). Die Röhre umhüllt, wie die Querschnitte Abb. 16 d und 17 zeigen, das in seiner Gesamtheit
drehrunde Stechborstenbündel sehr fest und vermittelt so eine sichere Führung desselben, verhindert
außerdem das Auseinanderweichen der einzelnen Stechborsten, das sofort eintritt, wenn
diese ganz aus der Scheide gezogen werden. Auch dieses Glied kann etwas in das vorhergehende
eingezogen werden.
3. Das d r i t t e G l i e d ist etwas in das zweite hineingesenkt, kurz und an der Vorderseite
nicht abgeplattet wie das erste, sondern mit einer tiefen Furche versehen. Der Chitinstab hört mit
dem zweiten Glied auf; die Röhre bleibt, hat aber durchweg elastische Wände. Sie liegt, das Stechborstenbündel
umhüllend, in der Tiefe der eben genannten Furche, Abb. 16 e zeigt deutlich genug
dieses Verhalten. Im ganzen ist das dritte Glied stärker chitinisiert als das zweite, am stärksten in
seinem distalen Teil.
4. Das E n d g l i e d , das in Abb. 15 genauer dargestellt ist, ist am stärksten von allen Gliedern
chitinisiert, besonders an seiner Spitze. An seiner Vorderseite hat es eine ähnliche Furche wie das
dritte Glied, aber diese wird nach dem Ende zu seichter, so daß schließlich wieder fast nur die Röhre,
die das Stechborstenbündel umhüllt, als Einfaltung übrigbleibt. Ein unpaarer Chitinstab wie im
zweiten Glied ist nicht vorhanden, dafür sind die proximalen Ränder des Glieds, wie Abb. 15 b zeigt,
stark verdickt und gehen weiter distal, zu innenskelettalen Leisten (Ls) werdend, im Bogen an die
Seiten der eingefalteten Furche, die sie bis zu ihrem Ende begleiten. Diese Leisten sind, wie Abb. 16 f
und 15 a zeigen, nichts anderes als stark chitinisierte Verdickungen der im übrigen weichhäutigen,
zur Bildung der Scheide eingefalteten Partien des Endglieds, entsprechen also den m it * bezeichneten
Teilen des 3. Glieds (Abb. 16 e). Sie dienen offenbar zur Versteifung des Endglieds, das beim Saugen auf
Zoologioa. Heft 76. 4