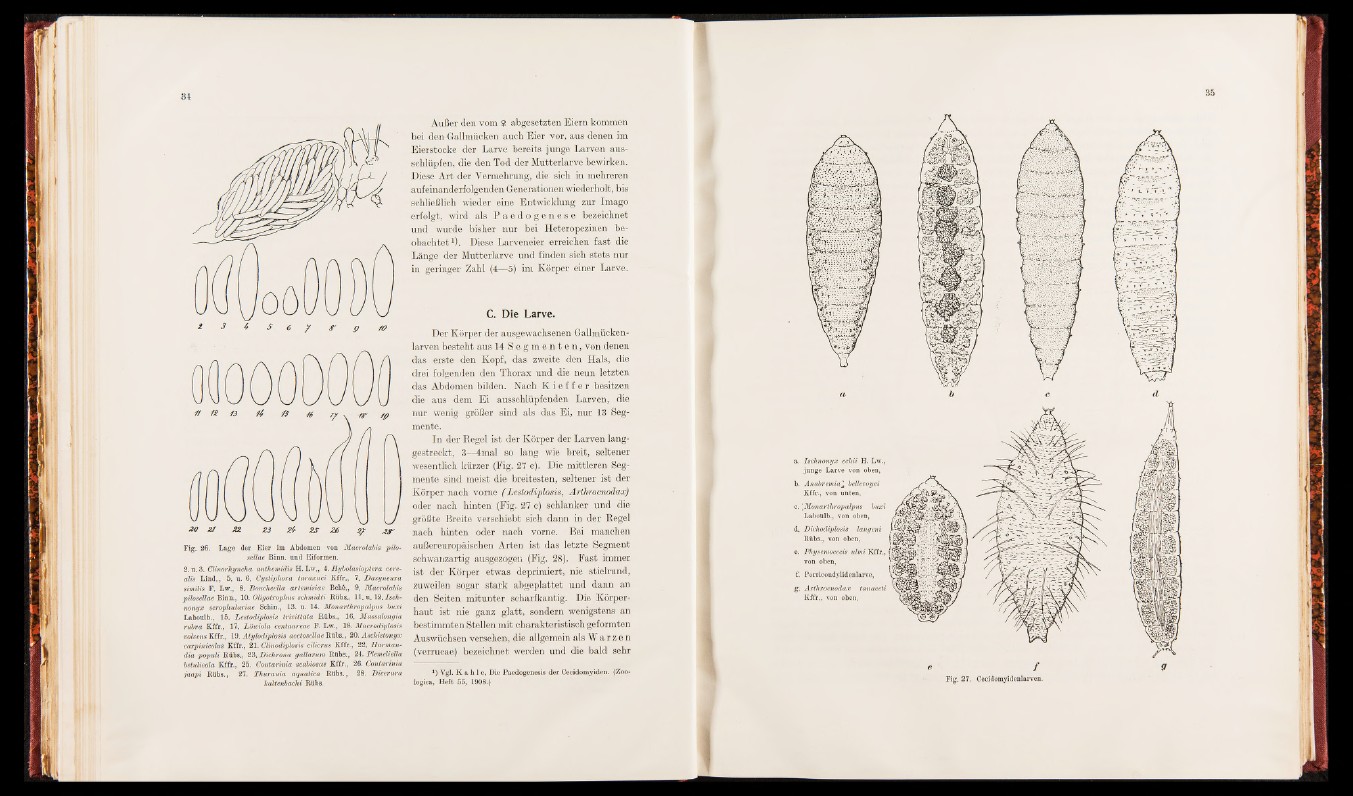
Fig. 26. Lag der Eier im Abdomen von Macrolabis pilo-
seltne Binn. und Eiformen.
2. u. 3. Clinorhyncha anthemidis H. Lw., 4. Hybolasioptera cere-
alis Lind., 6. u. 6. Cystiphora taraxaci Kffr., 7. Dasyneura
si milis F. Lw., 8. Bou che eli a artemisiae Bché., 9. Macrolabis
piloseUae Binn., 10. Oligotrophus schmidti Rübs., 11. u. 12.Isch-
nonyx scrophulariae Sohin., 13. u. 14. Monarthropalpus buxi
Laboulb., 15. Lestodiplosis trivittata Rübs., 16. Massalongia
rubra Kffr., 17. Löioiola centaureae F. Lw., 18. Macrodiplosis
volvens Kffr., 19. Atylodiplosis acetosellae Rübs., 20. Aschistonyx
carpinicolus Kffr., 21. Clinodiplosis cilicrus Kffr., 22. Harman-
dia populi Rübs., 23. Diclvrona galla/rum Rübs., 24. Plemeliella
betulicola Kffr., 25. Contarinia scabiosae Kffr., 26. Contarinia
jaapi Rübs., 27. Thurauia aquatica Rübs., 28. Dicerura
kaltenbachi Rübs.
Außer den vom $ abgesetzten Eiern kommen
bei den Gallmücken aucb Eier vor, aus denen im
Eierstocke der Larve bereits junge Larven ausschlupfen,
die den Tod der Mutterlarve bewirken.
Diese Art der Vermehrung, die sich in mehreren
aufeinanderfolgenden Generationen wiederholt, bis
schließlich wieder eine Entwicklung zur Imago
erfolgt, wird als P a e d o g e n e s e bezeichnet
und wurde bisher nur bei Heteropezinen beobachtet1).
Diese Larveneier erreichen fast die
Länge der Mutterlarve und finden sich stets nur
in geringer Zahl (4—5) im Körper einer Larve.
C. Die Larve.
Der Körper der ausgewachsenen Gallmückenlarven
besteht aus 14 S e g m e n t e n, von denen
das erste den Kopf, das zweite den Hals, die
drei folgenden den Thorax und die neun letzten
das Abdomen bilden. Nach K i e f f e r besitzen
die aus dem Ei ausschlüpfenden Larven, die
nur wenig größer sind als das Ei, nur 13 Segmente.
In der Regel ist der Körper der Larven langgestreckt,
3—4mal so lang wie breit, seltener
wesentlich kürzer (Fig. 27 e). Die mittleren Segmente
sind meist die breitesten, seltener ist der
Körper nach vorne ( Lestodiplosis, Arihrocnodax)
oder nach hinten (Fig. 27 c) schlanker und die
größte Breite verschiebt sich dann in der Regel
nach hinten oder nach vorne. Bei manchen
außereuropäischen Arten ist das letzte Segment
schwanzartig ausgezogen (Fig. 28). Fast immer
ist der Körper etwas deprimiert, nie stielrund,
zuweilen sogar stark abgeplattet und dann an
den Seiten mitunter scharfkantig. Die Körperhaut
ist nie ganz glatt, sondern wenigstens an
bestimmten Stellen mit charakteristisch geformten
Auswüchsen versehen, die allgemein als W a r z e n
(verrucae) bezeichnet werden und die bald sehr
*) Vgl. Ka h l e , Die Paedogenesis der Cecidomyiden. (Zoologica,
Heft 55, 1908.)
a. Ischnonyx echii H. Lw.,
junge Larve von oben,
b. Andbremiaj bellevoyei
Kffr., von unten,
c. [Monarthropalpus buxi
Laboulb., von oben,
d. Dichodiplosis langeni
Rübs., von oben,
e. Physemocecis ulmi Kffr.,
von oben,
f. Porricondylidenlarve,
g. Arthrocnodax tanaceti
Kffr., von oben.
' í