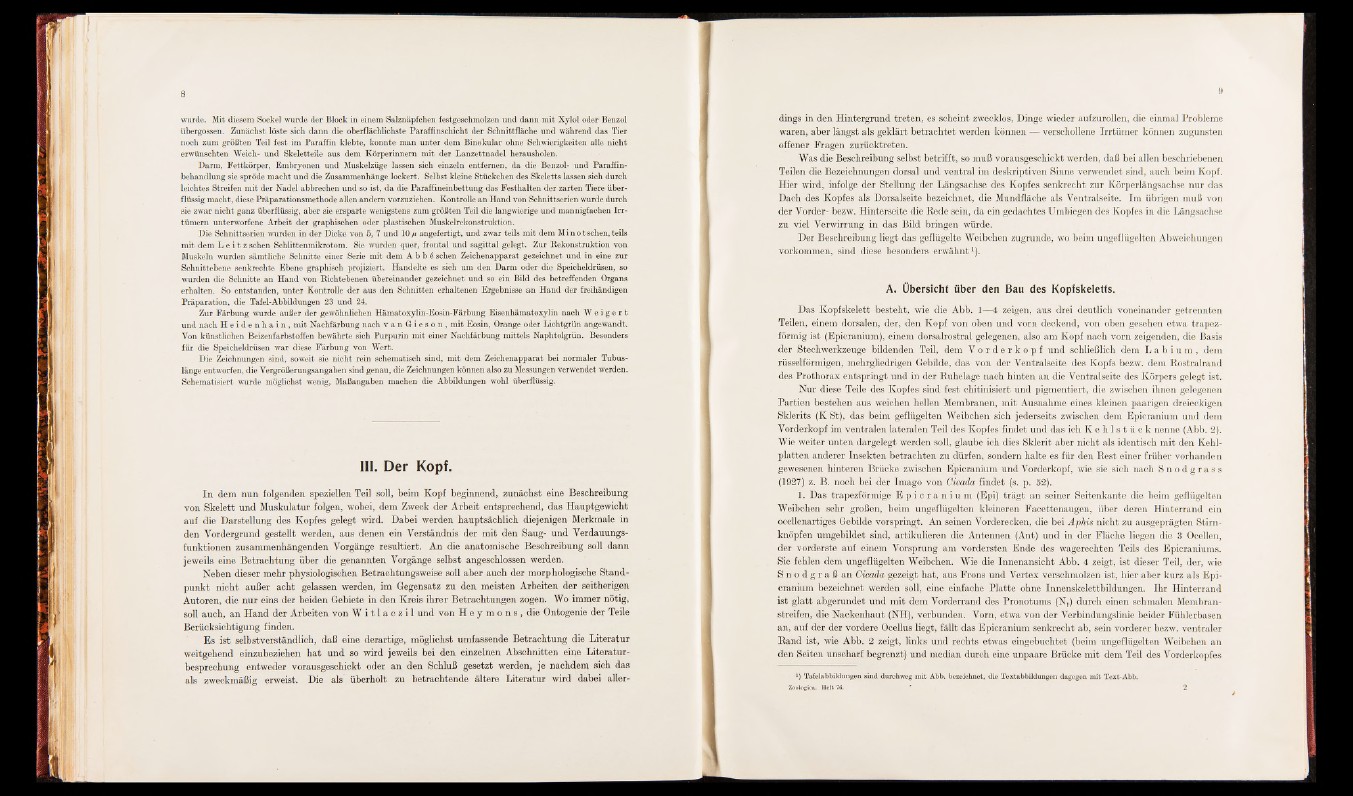
wurde. Mit diesem Sockel wurde der Block in einem Salznäpfchen festgeschmolzen und dann mit Xylol oder Benzol
übergossen. Zunächst löste sich dann die oberflächlichste Paraffinschicht der Schnittfläche und während das Tier
noch zum größten Teil fest im Paraffin klebte, konnte man unter dem Binokular ohne Schwierigkeiten alle nicht
erwünschten Weich- und Skeletteile aus dem Körperinnern mit der Lanzettnadel herausholen.
Darm, Fettkörper, Embryonen und Muskelzüge lassen sich einzeln entfernen, da die Benzol- und Paraffinbehandlung
sie spröde macht und die Zusammenhänge lockert. Selbst kleine Stückchen des Skeletts lassen sich durch
leichtes Streifen mit der Nadel abbrechen und so ist, da die Paraffineinbettung das Festhalten der zarten Tiere überflüssig
macht, diese Präparationsmethode allen ändern vorzuziehen. Kontrolle an Hand von Schnittserien wurde durch
sie zwar nicht ganz überflüssig, aber sie ersparte wenigstens zum größten Teil die langwierige und mannigfachen Irr-
tümern unterworfene Arbeit der graphischen oder plastischen Muskelrekonstruktion.
Die Schnittserien wurden in der Dicke von 5, 7 und 10n angefertigt, und zwar teils mit dem Minotsehen,teils
mit dem L e i t z sehen Schlittenmikrotom. Sie wurden quer, frontal und sagittal gelegt. Zur Rekonstruktion von,
Muskeln wurden sämtliche Schnitte einer Serie mit dem A bb é sehen Zeichenapparat gezeichnet und in eine zur
Schnittebene senkrechte Ebene graphisch projiziert. Handelte es sich um den Darm oder die Speicheldrüsen, so
wurden die Schnitte an Hand von Richtebenen übereinander gezeichnet und so ein Bild des betreffenden Organs
erhalten. So entstanden, unter Kontrolle der aus den Schnitten erhaltenen Ergebnisse an Hand der freihändigen
Präparation, die Tafel-Abbildungen 23 und 24.
Zur Färbung wurde außer der gewöhnlichen Hämatoxylin-Eosin-Färbung Eisenhämatoxylin nach W e i g e r t
und nach H e i d e n h a i n , mit Nachfärbung nach v a n G i e s o n , mit Eosin, Orange oder Lichtgrün angewandt.
Von künstlichen Beizenfarbstoffen bewährte sich Purpurin mit einer Nachfärbung mittels Naphtolgrün. Besonders
für die Speicheldrüsen war diese Färbung von Wert.
Die Zeichnungen sind, soweit sie nicht rein schematisch sind, mit dem Zeichenapparat bei normaler Tubuslänge
entworfen, die Vergrößerungsangaben sind genau, die Zeichnungen können also zu Messungen verwendet werden.
Schematisiert wurde möglichst wenig, Maßangaben machen die Abbildungen wohl überflüssig.
III. Der Kopf.
In dem nun folgenden speziellen Teil soll, beim Kopf beginnend, zunächst eine Beschreibung
von Skelett und Muskulatur folgen, wobei, dem Zweck der Arbeit entsprechend, das Hauptgewicht
auf die Darstellung des Kopfes gelegt wird. Dabei werden hauptsächlich diejenigen Merkmale in
den Vordergrund gestellt werden, aus denen ein Verständnis der mit den Saug- und Verdauungsfunktionen
zusammenhängenden Vorgänge resultiert. An die anatomische Beschreibung soll dann
jeweils eine Betrachtung über die genannten Vorgänge selbst angeschlossen werden.
Neben dieser mehr physiologischen Betrachtungsweise soll aber auch der morphologische Standpunkt
nicht außer acht gelassen werden, im Gegensatz zu den meisten Arbeiten der seitherigen
Autoren, die nur eins der beiden Gebiete in den Kreis ihrer Betrachtungen zogen. Wo immer nötig,
soll auch, an Hand der Arbeiten von W i t l a c z i l und von H e y m o n s , die Ontogenie der Teile
Berücksichtigung finden.
Es ist selbstverständlich, daß eine derartige, möglichst umfassende Betrachtung die Literatur
weitgehend einzubeziehen hat und so wird jeweils bei den einzelnen Abschnitten eine Literaturbesprechung
entweder vorausgeschickt oder an den Schluß gesetzt werden, je nachdem sich das
als zweckmäßig erweist. Die als überholt zu betrachtende ältere Literatur wird dabei allerdings
in den Hintergrund treten, es scheint zwecklos, Dinge wieder aufzurollen, die einmal Probleme
waren, aber längst als geklärt betrachtet werden können — verschollene Irrtümer können zugunsten
offener Fragen zurücktreten.
Was die Beschreibung selbst betrifft, so muß vorausgeschickt werden, daß bei allen beschriebenen
Teilen die Bezeichnungen dorsal und ventral im deskriptiven Sinne verwendet sind, auch beim Kopf.
Hier wird, infolge der Stellung der Längsachse des Kopfes senkrecht zur Körperlängsachse nur das
Dach des Kopfes als Dorsalseite bezeichnet, die Mundfläche als Ventralseite. Im übrigen muß von
der Vorder- bezw. Hinterseite die Rede sein, da ein gedachtes Umbiegen des Kopfes in die Längsachse
zu viel Verwirrung in das Bild bringen würde.
Der Beschreibung liegt das geflügelte Weibchen zugrunde, wo beim ungeflügelten Abweichungen
Vorkommen, sind diese besonders erwähnt1).
A. Übersicht über den Bau des Kopfskeletts.
Das Kopfskelett besteht, wie die Abb. 1—4 zeigen, aus drei deutlich voneinander getrennten
Teilen, einem dorsalen, der, den Kopf von oben und vorn deckend, von oben gesehen etwa trapezförmig
ist (Epicranium), einem dorsalrostral gelegenen, also am Kopf nach vorn zeigenden, die Basis
der Stech Werkzeuge bildenden Teil, dem V o r d e r k o p f und schließlich dem L a b i u m , dem
rüsselförmigen, mehrgliedrigen Gebilde, das von der Ventralseite des Kopfs bezw. dem Rostralrand
des Prothorax entspringt und in der Ruhelage nach hinten an die Ventralseite des Körpers gelegt ist.
Nur diese Teile des Kopfes sind fest chitinisiert und pigmentiert, die zwischen ihnen gelegenen
Partien bestehen aus weichen hellen Membranen, mit Ausnahme eines kleinen paarigen dreieckigen
Sklerits (K St), das beim geflügelten Weibchen sich jederseits zwischen dem Epicranium und dem
Vorderkopf im ventralen lateralen Teü des Kopfes findet und das ich K e h l s t ü c k nenne (Abb. 2).
Wie weiter unten dargelegt werden soll, glaube ich dies Sklerit aber nicht als identisch mit den Kehl-
platten anderer Insekten betrachten zu dürfen, sondern halte es für den Rest einer früher vorhanden
gewesenen hinteren Brücke zwischen Epicranium und Vorderkopf, wie sie sich nach S n o d g r a s s
(1927) z. B. noch bei der Imago von Cicada findet (s. p. 52).
1. Das trapezförmige E p i c r a n i u m (Epi) trägt an seiner Seitenkante die beim geflügelten
Weibchen sehr großen, beim ungeflügelten kleineren Facettenaugen, über deren Hinterrand ein
ocellenartiges Gebilde vorspringt. An seinen Vorderecken, die bei Aphis nicht zu ausgeprägten Stirnknöpfen
umgebildet sind, artikulieren die Antennen (Ant) und in der Fläche liegen die 3 Ocellen,
der vorderste auf einem Vorsprung am vordersten Ende des wagerechten Teils des Epicraniums.
Sie fehlen dem ungeflügelten Weibchen. Wie die Innenansicht Abb. 4 zeigt, ist dieser Teil, der, wie
S n o d g r a ß a n Cicada gezeigt hat, aus Frons und Vertex verschmolzen ist, hier aber kurz als Epicranium
bezeichnet werden soll, eine einfache Platte ohne Innenskelettbildungen. Ihr Hinterrand
ist glatt abgerundet und mit dem Vorderrand des Pronotums (Nj) durch einen schmalen Membranstreifen,
die Nackenhaut (NH), verbunden. Vorn, etwa von der Verbindungslinie beider Fühlerbasen
an, auf der der vordere Ocellus liegt, fällt das Epicranium senkrecht ab, sein vorderer bezw. ventraler
Rand ist, wie Abb. 2 zeigt, links und rechts etwas eingebuchtet (beim ungeflügelten Weibchen an
den Seiten unscharf begrenzt) und median durch eine unpaare Brücke mit dem Teil des Vorderkopfes
l ) Tafelabbildungen sind durchweg mit Abb. bezeichnet, die Textabbildungen dagegen mit Text-Abb.
Zoologica. Hott 76.