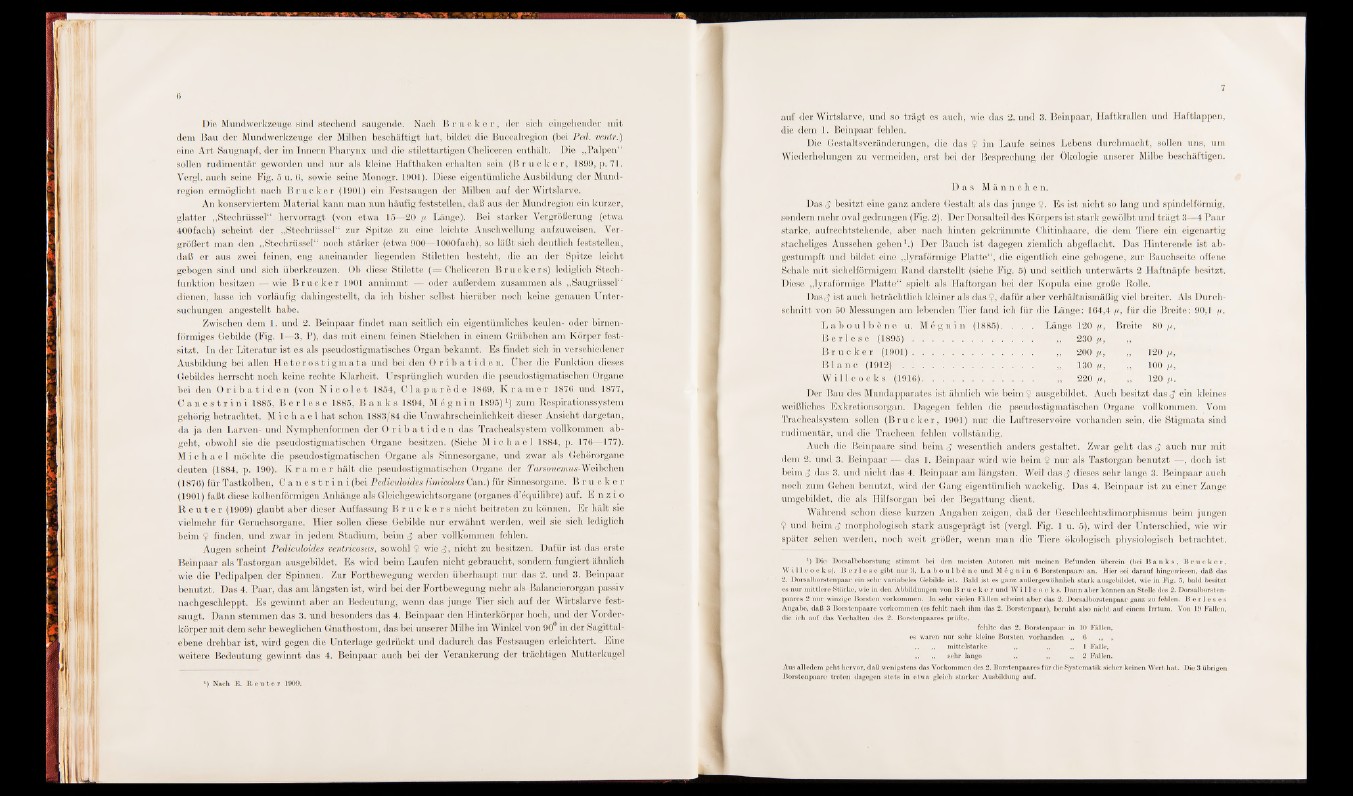
Die Mund Werkzeuge sind steckend saugende. Nack B r ü c k e r , der sick eingekender mit
dem Bau der Mundwerkzeuge der Milben besckäftigt hat, bildet die Buccalregion (bei Ped. ventr.)
eine Art Saugnapf, der im Innern Pharynx und die stilettartigen Ckeliceren enthält. Die „Palpen“
sollen rudimentär geworden und nur als kleine Hafthaken erhalten sein ( B r ü c k e r , 1899, p. 71.
Vergl. auch seine Fig. 5 u. 6, sowie seine Monogr. 1901). Diese eigentümliche Ausbildung der Mundregion
ermöglicht nach B r ü c k e r (1901) ein Festsaugen der Milben auf der Wirtslarve.
An konserviertem Material kann man nun häufig feststellen, daß aus der Mundregion ein kurzer,
glatter „Stechrüssel“ hervorragt (von etwa 15—20 ¡n Länge). Bei starker Vergrößerung (etwa
400fach) scheint der „Stechrüssel“ zur Spitze zu eine leichte Anschwellung aufzuweisen. Vergrößert
man den „Steclirüssel“ noch stärker (etwa 900—lOOOfach), so läßt sich deutlich feststellen,
daß er aus zwei feinen, eng aneinander liegenden Stiletten besteht, die an der Spitze leicht
gebogen sind und sich überkreuzen. Ob diese Stilette ( = Cheliceren Br üc ke r s ) lediglich Stechfunktion
besitzen — wie B r ü c k e r 1901 annimmt — oder außerdem zusammen als „Säugrüssel“
dienen, lasse ich vorläufig dahingestellt, da ich bisher selbst hierüber noch keine genauen Untersuchungen
angestellt habe.
Zwischen dem 1. und 2. Beinpaar findet man seitlich ein eigentümliches keulen- oder birnenförmiges
Gebilde (Fig. 1—3, P), das mit einem feinen Stielchen in einem Grübchen am Körper festsitzt.
In der Literatur ist es als pseudostigmatisches Organ bekannt. Es findet sich in verschiedener
Ausbildung bei allen H e t e r o s t i gm a t a und bei den O r i b a t i d e n . Uber die Funktion dieses
Gebildes herrscht noch keine rechte Klarheit. Ursprünglich wurden die pseudostigmatischen Organe
bei den O r i b a t i d e n (von N i c o l e t 1854, C l a p a r è d e 1869, K r a m e r 1876 und 1877,
C a n e s t r i n i 1885, B e r 1 e s e 1885, B a n k s 1894, M é g n i n 1895) l) zum Bespirationssystem
gehörig betrachtet. M i c h a e l hat schon 1883/84 die Unwahrscheinlichkeit dieser Ansicht dargetan,
da ja den Larven- und Nymphenformen der O r i b a t i d e n das Trachealsystem vollkommen abgeht,
obwohl sie die pseudostigmatischen Organe besitzen. (Siehe M i c h a e l 1884, p. 176—177).
M i c h a e l möchte die pseudostigmatischen Organe als Sinnesorgane, und zwar als Gehörorgane
deuten (1884, p. 190). K r a m e r hält die pseudostigmatischen Organe der Tarsonemus-Weibchen
(1876) für Tastkolben, C a n e s t r i n i (bei Pediculoides fimicolus Can.) für Sinnesorgane. B r ü c k e r
(1901) faßt diese kolbenförmigen Anhänge als Gleichgewichtsorgane (organes d’équilibre) auf. E n z i o
R e u t e r (1909) glaubt aber dieser Auffassung B r ü c k e r s nicht beitreten zu können. Er hält sie
vielmehr für Geruchsorgane. Hier sollen diese Gebilde nur erwähnt werden, weil sie sich lediglich
beim Ç finden, und zwar in jedem Stadium, beim $ aber vollkommen fehlen.
Augen scheint Pediculoides ventricosus, sowohl $ wie <$, nicht zu besitzen. Dafür ist das erste
Beinpaar als Tastorgan ausgebildet. Es wird beim Laufen nicht gebraucht, sondern fungiert ähnlich
wie die Pedipalpen der Spinnen. Zur Fortbewegung werden überhaupt nur das 2. und 3. Beinpaar
benutzt. Das 4. Paar, das am längsten ist, wird bei der Fortbewegung mehr als Balancierorgan passiv
nachgeschleppt. Es gewinnt aber an Bedeutung, wenn das junge Tier sich auf der Wirtslarve festsaugt.
Dami stemmen das 3. und besonders das 4. Beinpaar den Hinterkörper hoch, und der Vorderkörper
mit dem sehr beweglichen Gnathostom, das bei unserer Milbe im Winkel von 90 in der Sagittal-
ebene drehbar ist, wird gegen die Unterlage gedrückt und dadurch das Festsaugen erleichtert. Eine
weitere Bedeutung gewinnt das 4. Beinpaar auch bei der Verankerung der trächtigen Mutterkugel
Nach E. R e u t e r 1909.
auf der Wirtslarve, und so trägt es auch, wie das 2, und 3. Beinpaar, Haftkrallen und Haftlappen,
die dem I. Beinpaar fehlen.
Die Gestaltsveränderungen, die das $ im Laufe seines Lebens durchmacht, sollen uns, um
Wiederholungen zu vermeiden, erst bei der Besprechung der Ökologie unserer Milbe beschäftigen.
D a s Mä n n c h e n .
Das <2 besitzt eine ganz andere Gestalt als das junge $. Es ist nicht so lang und spindelförmig,
sondern mehr oval gedrungen (Fig. 2). Der Dorsalteil des Körpers ist stark gewölbt und trägt 3—4 Paar
starke, aufrechtstehende, aber nach hinten gek rümmte Chitinhaare, die dem Tiere ein eigenartig
stacheliges Aussehen geben1.) Der Bauch ist dagegen ziemlich abgeflacht. Das Hinterende ist abgestumpft
und bildet eine „lyraförmige Platte“ , die eigentlich eine gebogene, zur Bauchseite offene
Schale mit sichelförmigem Rand darstellt (siehe Fig. 5) und seitlich unterwärts 2 Haftnäpfe besitzt.
Diese „lyraförmige Platte“ spielt als Haftorgan bei der Kopula eine große Rolle.
Das<2 ist auch beträchtlich kleiner als das $, dafür aber verhältnismäßig viel breiter. Als Durchschnitt
von 50 Messungen am lebenden Tier fand ich für die Länge: 164,4 ¡x, für die Breite: 90,1 ja;
L a b o u l b è n e u. Mé g n i n (1885). . . . Länge 120 /x, Breite 80 /x.
B e r l e s e (1 8 9 5 ) ........................................ . . „ 230 [x, „
B r ü c k e r (1901)........................................ . . „ 200 ix, 120 ix.
B l a n c ( 1 9 1 2 ) ............................................. . . 1 130 fx, 1 100 /X,
W i l l c o c k s (1916)..................................... . . „ 220 /x, 120 ix
Der Bau des Mundapparates ist ähnlich wie beim $ ausgebildet. Auch besitzt das $ ein kleines
weißliches Exkretionsorgan. Dagegen fehlen die pseudostigmatischen Organe vollkommen. Vom
Trachealsystem sollen (Br ü c k e r , 1901) nur die Luftreservoire vorhanden sein, die Stigmata sind
rudimentär, und die Tracheen fehlen vollständig.
Auch die Beinpaare sind beim $ wesentlich anders gestaltet. Zwar geht das S auch nur mit
dem 2. und 3. Beinpaar — das 1. Beinpaar wird wie beim $ nur als Tastorgan benutzt —, doch ist
beim^ das 3. und nicht das 4. Beinpaar am längsten. Weil das $ dieses sehr lange 3. Beinpaar auch
noch zum Gehen benutzt, wird der Gang eigentümlich wackelig. Das 4. Beinpaar ist zu einer Zange
umgebildet, die als Hilfsorgan bei der Begattung dient.
Während schon diese kurzen Angaben zeigen, daß der Geschlechtsdimorphismus beim jungen
$ und beim $ morphologisch stark ausgeprägt ist (vergl. Fig. 1 u. 5), wird der Unterschied, wie wir
später sehen werden, noch weit größer, wenn man die Tiere ökologisch physiologisch betrachtet.
1) Die Dorsalbeborstung stimmt bei den meisten Autoren mit meinen Befunden überein (bei B a n k s , B r ü c k e r ,
Wi l l c o c k s ) . Be r i e s e gibt n ur 3, L a b o u l b ö n e und M 6 g n i n 6 Borstenpaare an. Hier sei darauf hingewiesen, daß das
2. Dorsal horstenpaar ein sehr variabeles Gebilde ist. Bald ist es ganz außergewöhnlich stark ausgebildet, wie in Fig. 5, bald besitzt
es nur mittlere Stärke, wie in den Abbildungen von B r ü c k e r und Wi l l c o c k s . Dann aber können an Stelle des 2. Dorsalborstenpaares
2 nur winzige Borsten Vorkommen. In sehr vielen Fällen scheint abor das 2. Dorsalborstenpaar ganz zu fehlen. B e r l e s e s
Angabe, daß 3 Borstenpaare Vorkommen (es fehlt nach ihm das 2. Borstenpaar), beruht also nicht auf einem Irrtum. Von 19 Fällen,
die ich auf das Verhalten des 2. Borstenpaares prüfte,
fehlte das 2. Borstenpaar in 10 Fällen,
es waren nur sehr kleine Borsten vorhanden „ 6 „ ,
„ „ mittelstarke „ „ „ 1 Falle,
', - ,, sehr lange „ „ „ 2 Fällen.
Aus alledem geht hervor, daß wenigstens das Vorkommen des 2. Borstenpaares für die Systematik sicher keinen Wert hat. Die 3 übrigen
Borstenpaare treten dagegen stets in etwa gleich starker Ausbildung auf.