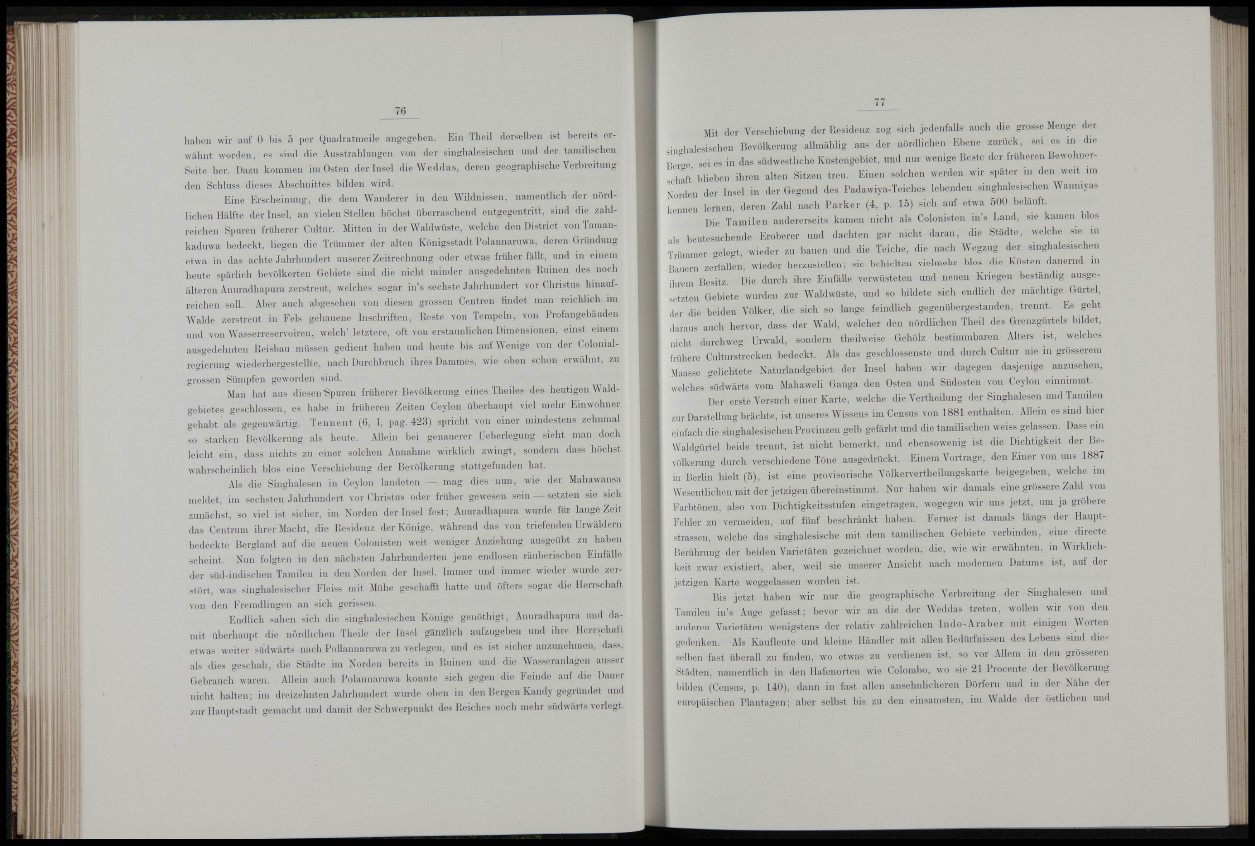
!' t j
' I
liaheii wir auf 0 bis 5 per Qaadratineile angegeben. Ein Theil derselben ist bereits erwähnt
worden, es sind die Ausstrahlungen von der singhalesischen und dei' tarailischen
Seite her. Dazu kommen im Osten der Insel die Weddas, deren geographische Verl)reitung
den Schluss dieses Abschnittes bilden wird.
Eine Erscheinung, die dem Wanderer in den Wildnissen, namentlich der nördlichen
Hälfte der Insel, an vielen Stellen höchst überraschend entgegentritt, sind die zahlreichen
Spuren früherer Cultnr. Mitten in der Waldwüste, welche den District von Tamankadnwa
bedeckt, liegeu die Trümmer der alten Königsstadt Polannaruwa, deren Gründung
etwa in das achte Jahrhundert unserer Zeitrechnung oder etwas früher fällt, und in einem
heute spärlich bevölkerten Gebiete sind die nicht minder ausgedehnten Euinen des noch
älteren Anuradhapura zerstreut, welches sogar in's sechste Jahrhundert vor Christus hinaufreichen
soll. Aber auch abgesehen von diesen grossen Centren findet man reichlich im
Walde zerstreut in Fels gehauene Inschriften, Reste von Tempeln, von Profangebäuden
und von Wasserreservoiren, welch' letztere, oft von erstaunlichen Dimensionen, einst einem
ausgedehnten Reisbau müssen gedient haben und heute bis auf Wenige von der Colonialregierung
wiederhergestellte, nach Durchbruch ihres Dammes, wie oben schon erwähnt, zu
grossen Sümpfen geworden sind.
Man hat aus diesen "Spuren früherer Bevölkerung eines Theiles des heutigen Waldgebietes
geschlossen, es habe in früheren Zeiten Ceylon überhaupt viel mehr Einwohner
gehabt als gegenwärtig. Tennent (6, I, pag. 423) spricht von einer mindestens zehnmal
so starken Bevölkennig als heute. Allein bei genauerer Ueberlegung sieht man doch
leicht ein, dass nichts zu einer solchen Annalime wirklich zwingt, sondern dass höchst
wahrscheinUch blos eine Verschiebung der Bevölkerung stattgefunden hat.
Als die Singhalesen in Ceylon landeten — mag dies nun, wie der Mahawansa
meldet, im sechsten Jahrhundert vor Christus oder früher gewesen sein — setzten sie sich
zunächst, so viel ist sicher, im Norden der Insel fest: Anuradhapura wurde für lange Zeit
das Centrum ihrer Macht, die Residenz der Könige, während das von triefenden Urwäldern
bedeckte Bergland auf die neuen Colonisten weit weniger Anziehung ausgeübt zu haben
scheint. Nun folgten in den nächsten Jahrhunderten jene endlosen räuberischen Einfälle
der süd-indischen Tamilen in den Norden der Insel. Immer und immer wieder wurde zerstört,
was siughalesischer Fleiss mit Mühe geschafft hatte und öfters sogar die Herrschaft
von den Fremdlingen an sich gerissen.
Endlich sahen sich die singhalesischen Könige genötlngt, Anuradhapura und damit
übeihaupt die nördUchen Thcile der Insel gänzlich aufzugeben und ihre Herrschaft
etwas weiter südwärts nach Pollannaruwa zu verlegen, und es ist siclier anzunehmen, dass,
als dies geschah, die Städte im Norden bereits in Ruinen und die Wasseranlagen ausser
Gebrauch waren. Allein auch Polannaruwa konnte sich gegen die Feinde auf die Dauer
nicht halten; im dreizehnten Jahrhundert wurde oben in den Bergen Kandy gegründet und
zur Hauptstadt gemacht und damit der Schwerpunkt des Reiches nocli melir südwärts verlegt.
Mit der Verschiebung der Residenz zog sich jedenfalls auch die grosse Menge der
.halesischen Bevölkerung alhnählig aus der nördlichen Ebene zurück, sei es in die
Bci^-J sei es in das südwestliche Küstengebiet, und nur wenige Reste der früheren Bewohnerschaft
blieben ihren alten Sitzen treu. Einen solchen werden wir später in den weit ,ni
Norden der Insel in der Gegend des Padawiya-Teiches lebenden singhalesischen Wanniyas
1-cunen lernen, deren Zahl nach Parker (4, p. 15) sich auf etwa 500 beläuft.
Die Tamilen andererseits kamen nicht als Colonisten in's Land, sie kamen blos
als bentesuchende Eroberer und dachten gar nicht daran, die Städte, welche sie in
Trümmer gelegt, wieder zu bauen und die Teiche, die nach Wegzug der singhalesischen
Bauern zerfallen, wieder herzustellen; sie l.ehielten vielmehr blos die Küsten dauernd in
ihrem Besitz. Die durch ihre Einfälle verwüsteten und neuen Kriegen beständig ausgesetzten
Gebiete wurden zur Waldwüste, und so bildete sich endhch der mächtige Gürtel,
der die beiden Völker, die sich so lange feindlich gegenübergestanden, trennt. Es geht
daraus auch hervor, dass der Wald, welcher den nördlichen Theil des Grenzgürtels bildet,
nicht durcliweg Urwald, sondern theilweise Gehölz liestimmbaren Alters ist, welchcs
frühere Culturstrecken bedeckt. Als das geschlossenste und durch Cultur nie in grösserem
Maasse geUchtete Naturlandgebiet der Insel haben wir dagegen dasjenige anzusehen,
welches Südwärts vom Mahaweli Ganga den Osten und Südosten von Ceylon einnimmt.
Der erste Versuch einer Karte, welche die Vertheilung der Singhalesen und Tamilen
zur Darstellung brächte, ist unseres Wissens im Census von 1881 enthalten. Allein es sind hier
einfach die singhalesischen Provinzen gelb gefärbt und die tamihschen weiss gelassen. Dass ein
Waldgürtel beide trennt, ist nicht bemerkt, und ebensowenig ist die Dichtigkeit der Bevölkerung
durch verschiedene Töne ausgedrückt. Einem Vortrage, den Einer von uns 1887
in Berhn hielt (5), ist eine provisorische Völkervertheilungskarte beigegeben, welche im
Wesenthchen mit der jetzigen übereinstimmt. Nur haben wir damals eine grössere Zahl von
Farbtönen, also von Dichtigkeitsstufen eingetragen, wogegen wir uns jetzt, um ja gröbere
Fehler zu vermeiden, auf fünf beschränkt haben. Ferner ist damals längs der Hauptstrassen,
welche das singhalesische mit dem tamilischen Gebiete verbinden, eine directe
Berührung der beiden Varietäten gezeichnet worden, die, wie wir erwähnten, in Wirklichkeit
zwar existiert, alier, weil sie unserer Ansicht nach modernen Datums ist, auf der
jetzigen Karte weggelassen worden ist.
Bis jetzt haben wir nur die geographische Verbreitung der Singhalesen und
Tamilen ni's Auge gefasst; bevor wir an die der Weddas treten, wollen wir von den
anderen Varietätmi wenigstens der relativ zahheichen Indo-Araber mit einigen W^orten
gedenken. Als Kaufleute und kleine Händler mit allen Bedürfnissen des Lebens sind dieselben
fast überall zu finden, wo etwas zu verdienen ist, so vor Allem in den grösseren
Städten, namonthch in den Hafenorten wie Coloinbo, wo sie 21 Procente der Bevölkerung
bilden (Census, p. 140), dann in fast allen ansehnhcheren Dörfern und in der Nähe der
europäischen Plantagen; aber selbst bis zu den einsamsten, im Walde der östlichen und
11 I
ItlE -f,
i l ' i ¡iIti!