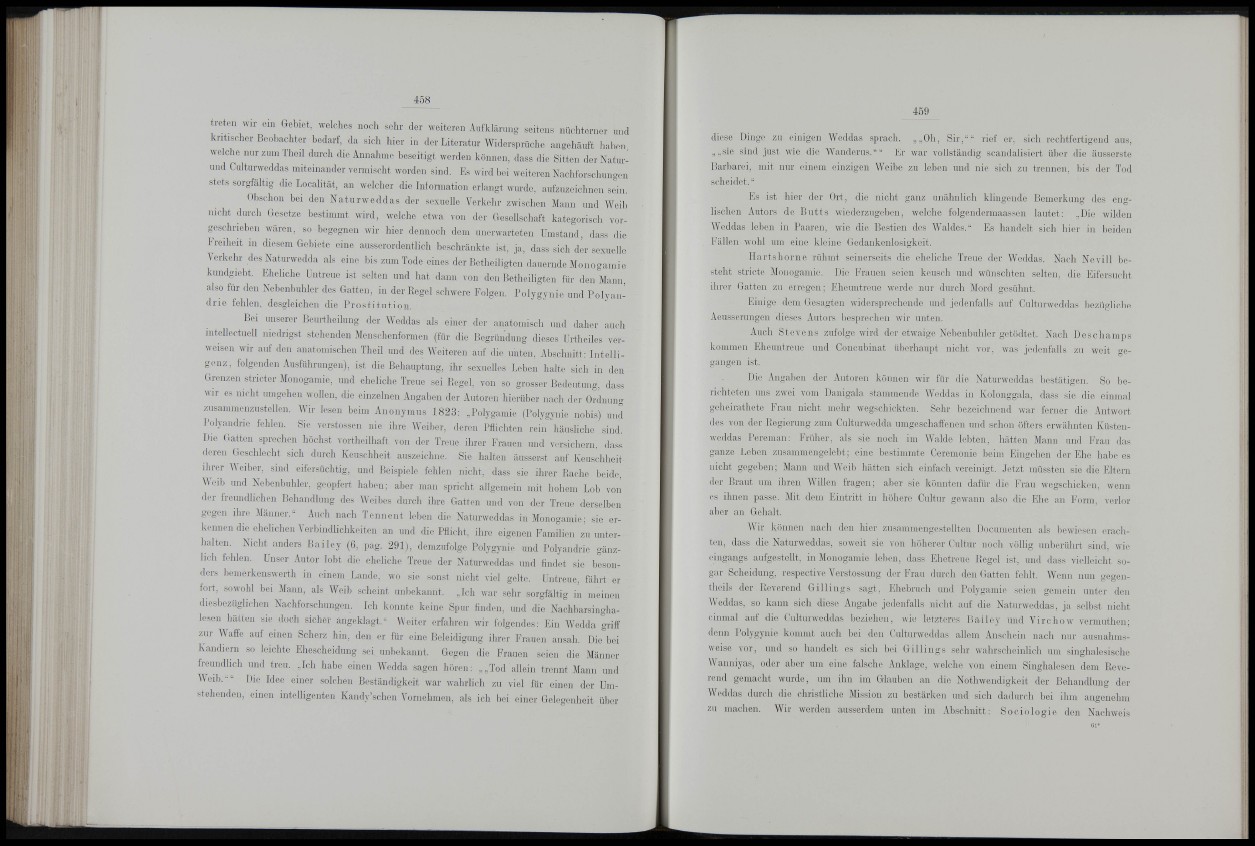
treten wir ein Gebiet, welches nocl, sehr der weiteren Anfkläruug seitens nüchterner nnd
kntiscJier Beobachter l.edarf, da sich liier in der Literatur Widersprüche angehäuft haben
Avelche nur zum Theil durch die Annahme beseitigt werden können. ,lass die Sitten derNatnruu.
l Culturweddas miteinander vermischt worden sind. Es wird bei weiteren Nachforschnn-en
stets sorgfältig die Locahtät, an welcher die Information erlangt wurde, aufzuzeichnen sein
Obschon bei den Naturweddas der sexuelle Verkehr zwischen Mann und AVeib
nicht durch Gesetze bestimmt wird, welche etwa von der GeseUschaft kategorisch vorgeschrieben
wären, so begegnen wir hier dennoch dem uiu'-rwarteten Umstand, dass die
Freiheit in diesem Gebiete eine ausserordentlich beschränkte ist, ja, dass sich der sexuelle
Verkehr des Naturwedda als eine bis zum Tode eines der Retheiligten dauernde Monogamie
kundgiebt. Eheliche Untreue ist selten und hat dann von den Retheiligten für den Mann
al-so für den Nebenbuhler des Gatten, m der Regel schwere Folgen. Polygynie und Polyandrie
fehlen, desgleichen die Prostitution.
Bei unserer Beurtheihmg der Weddas als einer der anatomisch und daher auch
intellectuell nie.lrigst stellenden Menschenformen (für die Begründung dieses Urtheiles verweisen
wir auf den anatomischen Theil und des AVeiteren auf die unten. Abschnitt: Intelligenz,
folgenden Ausführungen), ist die Behauptung, ihr sexuelles Leben halte sich in den
Grenzen stricter Monogamie, und eheliche Treue sei liegel, von so grosser Bedeutung, dass
wir es nicht umgehen wollen, die einzelnen Angaben der Autoren hierüber nach der Ordnunzusammenzustellen.
Wir lesen beim Anonymus 1823: „Polygamie (Polvgvnie nobis) und
Polyandrie fehlen. Sie Verstössen nie ihre Weiber, deren Pflichten rein häuslichc sind.
Die (iatten sprechen höchst vortheilhaft von der Trene ihrer Frauen und versichern, dass
<lereii Geschlecht .sich durch Keuschheit auszeichne, Sie halten äusserst auf Keuschheit
ihrer Weiber, sind eifer.süciitig, und Beispiele fehlen nicht, dass sie ihrer Rache beide
Weib und Nebenbuhler, geopfert haben; aber man spricht allgemein mit hohem Lob von
der freundlichen Behandlung des AVeibes durch ihre Gatten und von der Treue derselben
gegen ihre Männer." Anch nach Tennent leben di,> Naturweddas in Monogamie: sie erkennen
die ehelichen Verbmdlichkeiten an und die Pflicht, ihre eigenen Familien zu unterhalten.
Niclit anders Bai ley (6, pag. 291), demzufolge Polygynie und Polyandrie gänzlich
fehlen. Unser Autor lobt die eheliche Treue der Naturweddas und findet sie besonders
bemerkenswerth in einem Lande, wo sie sonst nicht viel gelte. Untreue, fälni er
fort, sowohl bei Mann, als Weib scheint unbekannt. „Ich war sehr sorgfältig in meinen
diesliezüglicheii Nachforschungen. Ich konnte keine Spur tin.len, un.l die Nachbarsinghalesen
hätten sie doch sicher angeklagt." AVeiter erfnliren wir folgendes: Ein AVedda griff
zur AVaffe auf einen Scherz hm, den er für eine Beleidigung ihrer Frauen ansah. Dic^bei
Kandiern so leichte Ehescheidung sei unbekannt. Gegen die Frauen seien die Männ(.r
fi'emidlich und treu. ..Ich habe einen Wedda sagen hören: „„Tod allein ti'ennt Mann un.l
AVeib.-" Die Idee einer solchen Beständigkeit war wahrlich zu viel für einen der Umstehenden,
einen intelligenten Kandy'schen Vornehmen, als icli bei einer Gelegenheit über
. ( '.Iidiese
Dinge zu einigen Weddas sprach. „„Oh, Sir,"" rief er, sicli rechtfertigend aus,
„..sie sind just wie die AVanderus."" Er war vollständig scandalisiert über die äusserste
Barbarei, mit nur einem einzigen Weibe zu leben und nie sich zu trennen, bis der Tod
schei<let."
Iis ist hier der Ort, die nicht ganz unähnlich klingende Remerkung des englischen
Autors de Butts wiederzugcl)on, welche folgendcrmaassen lautet: „Die wilden
Weddas leben in l'aai'en, wie die Bestien des AA'aldes." Es handelt sich liier in beiden
b'älleii wohl um eine kleine Gedankenlosigkeit.
Harts II o rno rühmt seinerseits die eheliche Treue der Weddas. Nach Nevill besteht
stricte Monogamie. Die Frauen seien keusch und wünschten selten, die Eifersucht
ihrer Gatten zu erregen; Eheuntreue werde nur durch Alord gesülint.
Einige dem (jesagten widersprechende und jedenfalls auf Culturweddas liezügliche
Acusserungen dieses Autors besprechen wir unten.
Auch Stevens zufolge wird der etwaige Nebenbuhler getödtet. Nach Deschamps
kommen Eheuntreue und Concubinat überhaupt nicht vor, was jedenfalls zu weit gegangen
ist.
Die Angalien der Autoren können wir für die Naturweddas bestätigen. So berichteten
uns zwei vom Danigala stammende AA^eddas in Kolonggala, dass sie die einmal
geheirathete Frau nicht mehr wegschickten. Sehr bezeichnend war ferner die Antwort
des von der Regierung zum Culturwedda umgeschaffenen und schon öfters erwähnten Küstenweddas
l'ereman: Fridier, als .sie noch im AA'alde leliten, hätten Mann und Frau das
ganze Leben zusammengelebt; eine bestimmte Ceremonie beun Eingehen der Ehe habe es
nicht gegeben; Mann und AVeib hätten sich einfach vereinigt. Jetzt müssten sie die Ehern
der Braut um ihren AVillen fragen; aber sie könnten dafür die Frau wegschicken, wenn
es ihnen passe. Mit dem Eintritt in höhere Cultnr gewann also die Ehe an Form, verlor
aber an Gehalt.
Wir können nach den hier zusammengestellten Documenten als bewiesen erachten,
dass die Naturweddas, soweit sie von höherer Cultur noch völlig unberührt sind, wie
eingangs aufgestellt, in Monogamie leben, dass Ehetreue Regel ist, und dass vielleicht sogar
Scheidung, respective Verstossung der Frau durch den Gatten feldt. AVenn nun gegentheils
der R,(^verenll Gillings sagt. Ehebruch und Polygamie seien gemein unter den
\Veddas, so kann sich diese Angabe jedenfalls nicht auf die Naturweddas, ja selbst nicht
einmal auf die Ciihurweddas beziehen, wie letzteres Railey und Virchow vermuthen;
denn l'olygynie koimnt audi bei den Culturweddas allem Anschein nach nur ausnahmsweise
vor, und so handelt es sich bei Gillings sehr wahrscheinlich um singhalesische
Wanniyas, oder aber um eine falsche Anklage, welche von einem Singhalesen dem Reverend
gemacht wurde, um ihn im Glauben au die Nothwendigkeit der Behandlung der
Weddas durch die christliche Mission zu bestärken und sich dadurch bei ihm angenehm
zu uiachen. Wir werden ausserdem unten im Abschnitt: Sociologie den Nacliweis
61«