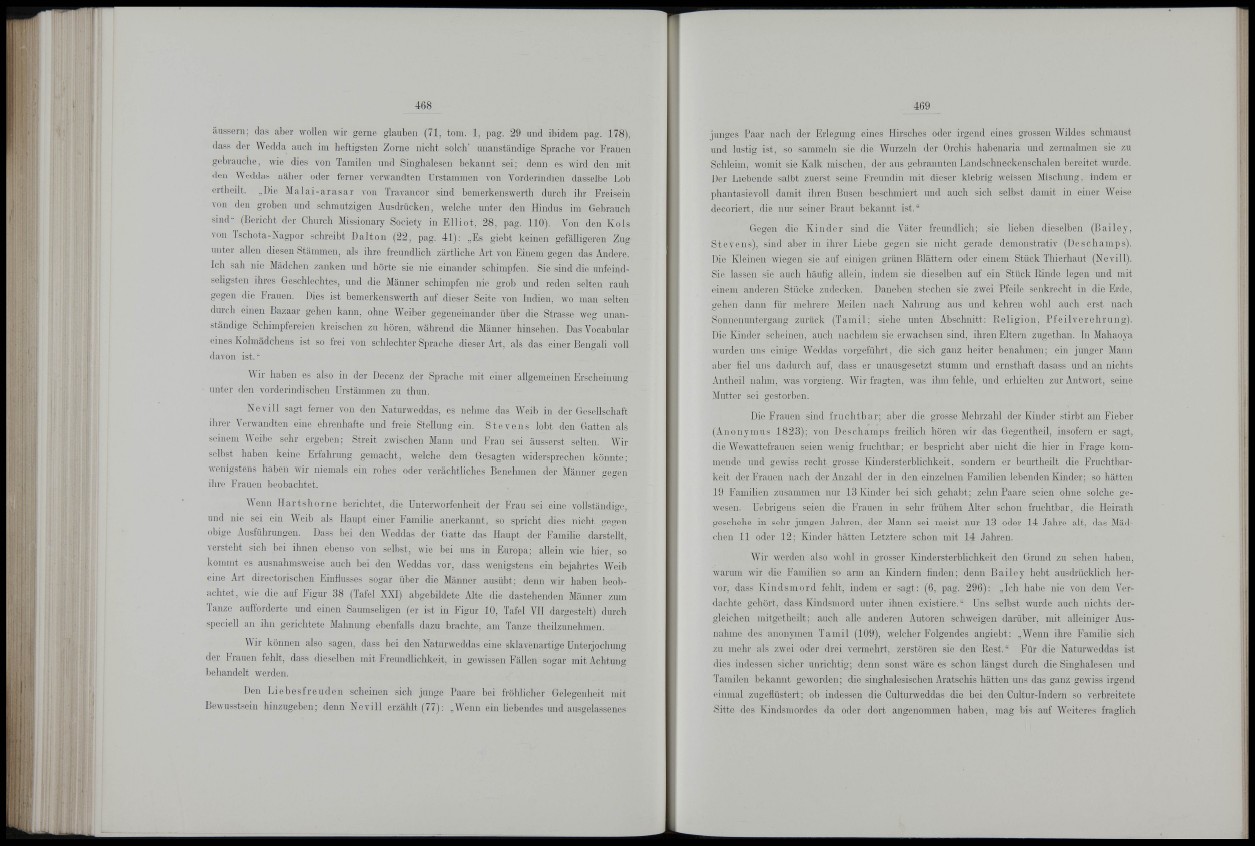
! i;:
! •'
468
äussern: das al)er wollen wir gerne glauben (71, tom. 1, pag. 29 inid ibidem pag. 178),
dass der Werlda aucli im heftigsten Zorne nicht solch' unanständige Sprachc vor Frauen
gi'bvanclie, wie dies von Tamilen und Singhalesen bekannt sei; denn es wird den mit
den Weddas nälier oder ferner verwandten Urstämmcn von Vorderindien dasselbe Lob
ortheilt. „Die Malai-arasar von Travancor sind bemerkenswerth durch ihr Freisein
von ilon groben und schmutzigen Ausdrücken, welche unter den Hindus im Gebrauch
sind" (Bericht der Church Missionary Society in Elliot. 28. pag. 110). Von den Kols
von Tschota-Nagpor schreibt Dalton (22, pag. 41): „Es giebt keinen gefälligeren Zug
unter allen diesen Stämmen, als ihre freundlich zärtHcho Art von Einem gegen das Andere.
Ich sali nie Mädclien zanken und hörte sie nie einander schimpfen. Sie sind die unfeindseligsten
ihres Gesclilechtes, und die Männer schimpfen nie grob und reden selten rauh
gegen die Frauen. Dies ist bemerkenswerth auf dieser Seite von Indien, wo man selten
durch einen Bazaar gehen kann, ohne Weiber gegeneinander über die Strasse weg unanständige
Schimpfereien kreischen zu hören, während die Männer hinsehen. Das Vocabular
eines ivolmädchens ist so frei von schlechter Sprache dieser Art, als das einer Bengali voll
davon ist."
AMr haben es also in der Decenz der Sprache mit einer allgemeinen Ersclieinung
unter den vorderindischen Urstämmen zu thun.
Nevill sagt ferner von den Katurweddas, es nehme das Weib in der Gesellscliaft
ihrer Verwandten eine ehrenhafte und freie Stellung ein. Stevens lobt den Gatten als
seinem Weibe sehr ergeben; Streit zwischen Mann und Frau sei äusserst selten. Wir
selbst haben keine Erfahrung gemacht, welche dem Gesagten widersprechen könnte;
\venig.stens haben wir niemals ein rohes oder verächtliches Benehmen der Männer gegen
ilirr Frauen beobachtet.
AVenn l lartshorne berichtet, die Unterworfenheit der Frau sei eine vollständige,
und nie sei ein Weib als Hanpt einer Famihe anerkannt, so spricht dies nicht gegen
obige Ausführungen. Dass bei den Weddas der Gatte das Haupt der Familie darstellt,
verstellt sich bei ihnen ebenso von selbst, wie liei uns in Europa; allein wie hier, so
kommt es ausnahmsweise auch bei den Weddas vor, dass Avenigstens ein bejahrtes Weib
eine Art directorisdien Einflus.ses sogar über die Männer ausübt: denn wir halien beol)-
achtet, wie die auf Figur 38 (Tafel XXI) abgebildete Alte die dastelienden Männer zum
Tanze aufforderte und einen Saumseligen (er ist in Figur 10, Tafel VH dargestelt) diircli
speciell an ihn gerichtete Mahnung ebenfalls dazu braclite, am Tanze theilzunehmen.
Wir können also sagen, dass bei den Naturweddas eine sklavenartige ünterjocliung
der Frauen felüt, dass dieselben mit Freundlichkeit, in gewissen Fällen sogar mit Achtung
behandelt werden.
Den Liebesfreuden sclieinen sich jinige Paare hei fVöliliclier Gelegenheit mit
Bewusst^ein hinzugeben; denn Nevill erzählt (77): „Wenn ein liebendes und ausgelassenes
469
junges Paar nach der Erlegung eines Hirsches oder irgend eines grossen Wildes schmaust
und lastig ist, so sammeln sie die Wurzeln der Orchis habenaria und zermalmen sie zu
Sclileim, womit sie Kalk mischen, der aus gelirannten Landschneckenschalen bereitet wurde.
Der Liebende salbt zuerst seine Freundin mit dieser klebrig weissen Mischung, iudem er
phantasievoll damit ihren Busen hesclimiert und auch sicli selbst damit in einer Weise
decoriert, die nur seiner Braut bekannt ist."
Gegen die Kinder sind die Väter freundlich; sie lielien dieselben (Bailey,
Stevens), sind aber in ihrer Liebe gegen sie niclit gerade demonstrativ (Deschamps).
Die Kleinen wiegen sie auf einigen grlinen Blättern oder einem Stück Thierhaut (Nevill).
Sie lassen sie auch häutig allein, indem sie dieselben auf ein Stück Rinde legen und mit
einem anderen Stücke zudecken. Daneben stechen sie zwei Pfeile senkrecht in die Erde,
gehen dann für mehrere Meilen nach Nahrung aus und keliren wohl auch erst nach
Sonnenuntergang zurück (Tamil : siehe unten Abschnitt: Religion, Pfeilverelirung).
Die Kinder sclieinen. auch nachdem sie erwachsen sind, ihren Eltern zugethan. In Mahaoya
wurden uns einige Weddas vorgefahrt, die sich ganz heiter benahmen; ein junger Mann
aber fiel uns dadurch auf, dass er unausgesetzt stumm und ernsthaft dasass und an nichts
Antheil nahm, was vorgieng. Wir fragten, was ihm fehle, und erhielten zur Antwort, seine
Mutter sei gestorben.
Die Frauen sind fruchtbar; aber die grosse Mehrzahl der Kinder stirbt am Fieber
(Anonymus 1823); von Deschamps freilich hören wir das Gegentheil, insofern er sagt,
die Wewattefrauen seien wenig fruchtbar; er bespricht aber nicht die hier in Frage kommende
und gewiss recht grosse Kindersterblichkeit, sondern er beurtheilt die Fruchtbarkeit
der Frauen nach der Anzahl der in den einzelnen Familien lebenden Kinder; so hätten
19 i-'amilien zusammen nur 13 Kinder bei sich gehabt; zehn Paare seien ohne solche gewesen.
Üebrigens seien die Frauen in sehr frühem Alter schon fruchtbar, die Heirath
geschehe in selir jungen Jaliren. der Mann sei meist nur 13 oder 14 Jalire alt. das Mädchen
11 oder 12: Kinder hätten Letztere schon mit 14 Jahren.
Wir werden also wohl in grosser Kindersterblichkeit den Grund zu sehen haljen,
warum wir die Familien so arm an Kindern finden; denn Bailey hebt ausdrücklich hervor,
dass Kindsmord fehlt, indem er sagt: (6, pag. 296): „Ich habe nie von dem Verdadite
gehört, dass Kindsmord unter ihnen existiere." Uns selbst wurde auch nichts dergleichen
mitgetheilt; auch alle anderen Autoren schweigen darüber, mit alleiniger Ausnahme
dos anonymen Tamil (109), Avelcher Folgendes angiebt: „Wenn ihre Familie sich
zu mehr als zwei oder drei vermehrt, zerstören sie den Rest." Für die Naturweddas ist
dies indessen sicher unrichtig; denn sonst wäre es schon längst durch die Singhalesen und
TamiKm bekannt geworden; die singlialesischen Aratschis hätten uns das ganz gewiss irgend
einmal zugettüstert; ob indessen die Cidturweddas die bei den Cultur-Indern so verbreitete
Sitte des Kindsmordes da oder dort angenommen haben, mag bis auf Weiteres fraglich