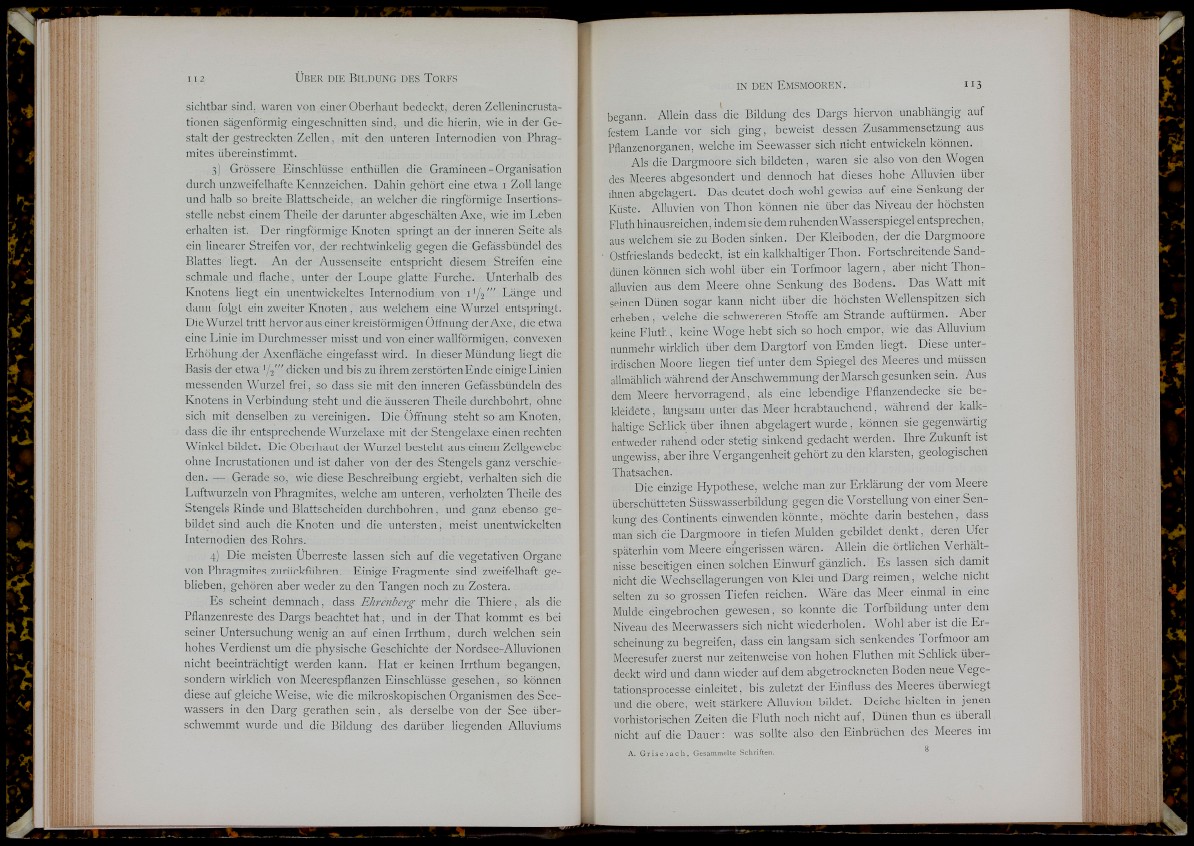
jr^,i • iiJ
i n . t l i j
; 1'
Ii ' f.. II
h . .. •• •ij
1 I 2 UBER DIE RIT.DUNG DES TORFS
sichtbar sind, waren von einer Oberhaut bedeckt^ deren Zellenincrustationen
sägenförmig- eingeschnitten sind, und die hierin, wie in der Gestalt
der gestreckten Zellen, mit den unteren Internodien von Phragmites
i.ib er einstimmt.
3) Grössere Einschlüsse enthüllen die Gramineen-Organisation
durch unzweifelhafte Kennzeichen. Dahin gehört eine etwa i Zoll lange
und halb so breite Blattscheide, an welcher die ringförmige Insertionsstelle
nebst einem Theile der darunter abgeschälten Axe^ wie im Leben
erhalten ist. Der ringförmige Knoten springt an der inneren Seite als
ein Hnearer Streifen vor, der rechtwinkelig gegen die Gefässbündel des
Blattes liegt. An der Aussenseite entspricht diesem Streifen eine
schmale und flache, unter der Loupe glatte Furche. Unterhalb des
Knotens Hegt ein unentwickeltes Internodium von 1V2'" Länge und
dann fol,gt ein zweiter Knoten, aus welchem eine Wurzel entspringt.
Die Wurzel tritt hervor aus einer kreisförmigen Öffnung der Axe, die etwa
eine Linie im Durchmesser misst und von einer wallförmigen, convexen
Erhöhung der Axenfläche eingefasst wird. In dieser Mündung hegt die
Basis der etwa '/V" dicken und bis zu ihrem zerstörten Ende einige Linien
messenden Wurzel frei, so dass sie mit den inneren Gefässbündeln des
Knotens in Verbindung steht und die äusseren Theile durchbohrt, ohne
sich mit denselben zu vereinigen. Die Öffnung steht so am Knoten,
dass die ihr entsprechende Wurzelaxe mit der Stengelaxe einen rechten
Winkel bildet. Die Oberhaut der Wurzel besteht aus einem Zellgewebe
ohne Incrustationen und ist daher von der des Stengels ganz verschieden.
— Gerade so, wie diese Beschreibung ergiebt, verhalten sich die
Luftwurzeln von Phragmites^ welche am unteren, verholzten Theile des
Stengels Rinde und Blattscheiden durchbohren, und ganz ebenso gebildet
sind auch die Knoten und die untersten, meist unentwickelten
Internodien des Rohrs.
4) Die meisten Überreste lassen sich auf die vegetativen Organe
von Phragmites zurückführen. Einige Fragmente sind zweifelhaft gebheben,
gehören aber weder zu den Tangen noch zu Zostera.
Es scheint demnach, dass Ehrenberg mehr die Thiere, als die
Pflanzenreste des Dargs beachtet hat, und in der That kommt es bei
seiner Untersuchung wenig an auf einen Irrthum, durch welchen sein
hohes Verdienst um die physische Geschichte der Nordsee-Alluvionen
nicht beeinträchtigt werden kann. Hat er keinen Irrthum begangen,
sondern wirkHch von Meerespflanzen Einschlüsse gesehen, so können
diese auf gleiche Weise, wie die mikroskopischen Organismen des Seewassers
in den Darg gerathen sein, als derselbe von der See überschwemmt
wurde und die Bildung des darüber liegenden Alluviums
IN DEN EMSMOOREN. 113
begann. Allein dass die Bildung des Dargs hiervon unabhängig auf
festem Lande vor sich ging, beweist dessen Zusammensetzung aus
Pflanzenorganen, welche im Seewasser sich nicht entwickeln können.
Als die Dargmoore sich bildeten , waren sie also von den Wogen
des Meeres abgesondert und dennoch hat dieses hohe Alluvien über
ihnen abgelagert. Das deutet doch wohl gewiss auf eine Senkung der
Küste. Alluvien von Thon können nie über das Niveau der höchsten
F l u t h hinausreichen, indemsie dem ruhenden Wasserspiegel entsprechen,
aus welchem sie zu Boden sinken. Der Kleiboden, der die Dargmoore
Ostfrieslands bedeckt, ist ein kalkhaltiger Thon. Fortschreitende Sanddünen
können sich wohl über ein Torfmoor lagern, aber nicht Thonalluvien
aus dem Meere ohne Senkung des Bodens. Das Watt mit
seinen Dünen sogar kann nicht über die höchsten WeUenspitzen sich
erheben, welche die schwereren Stofl'e am Strande auftürmen. Aber
keine Fluth, keine Woge hebt sich so hoch empor, wie das Alluvium
nunmehr wirklich über dem Dargtorf von Emden liegt. Diese unterirdischen
Moore hegen tief unter dem Spiegel des Meeres und müssen
allmähhch während der Anschwemmung der Marsch gesunken sein. Aus
dem Meere hervorragend, als eine lebendige Pflanzendecke sie bekleidete,
langsam unter das Meer herabtauchend, während der kalkhaltige
Schlick über ihnen abgelagert wurde, können sie gegenwärtig
entweder ruhend oder stetig sinkend gedacht werden. Ihre Zukunft ist
ungewiss, aber ihre Vergangenheit gehört zu den klarsten, geologischen
Thatsachen.
Die einzige Hypothese, welche man zur Erklärung der vom Meere
überschütteten Süsswasserbildung gegen die Vorstellung von einer Senkung
des Continents einwenden könnte, möchte darin bestehen, dass
man sich die Dargmoore in tiefen Mulden gebildet denkt, deren Ufer
späterhin vom Meere eingerissen wären. Allein die örthchen Verhältnisse
beseitigen einen solchen Einwurf gänzhch. Es lassen sich damit
nicht die Wechsellagerungen von Klei und Darg reimen, welche nicht
selten zu so grossen Tiefen reichen. Wäre das Meer einmal in eine
Mulde eingebrochen gewesen, so konnte die Torfbildung unter dem
Niveau des Meerwassers sich nicht wiederholen. Wohl aber ist die Erscheinung
zu begreifen, dass ein langsam sich senkendes Torfmoor am
Meeresufer zuerst nur zeitenweise von hohen Finthen mit Schhck überdeckt
wird und dann wieder auf dem abgetrockneten Boden neue Vegetationsprocesse
einleitet, bis zuletzt der Einfluss des Meeres überwiegt
und die obere, weit stärkere Alluvion bildet. Deiche hielten in jenen
vorhistorischen Zeiten die Fluth noch nicht auf, Dünen thun es überall
nicht auf die Dauer: was sollte also den Einbrüchen des Meeres im
o
A. G r i s e b a c h , Gesammelte Schriften.
mt
iii
lll
fertig.«;!!
m
i»
iilt
iii
"A Iii