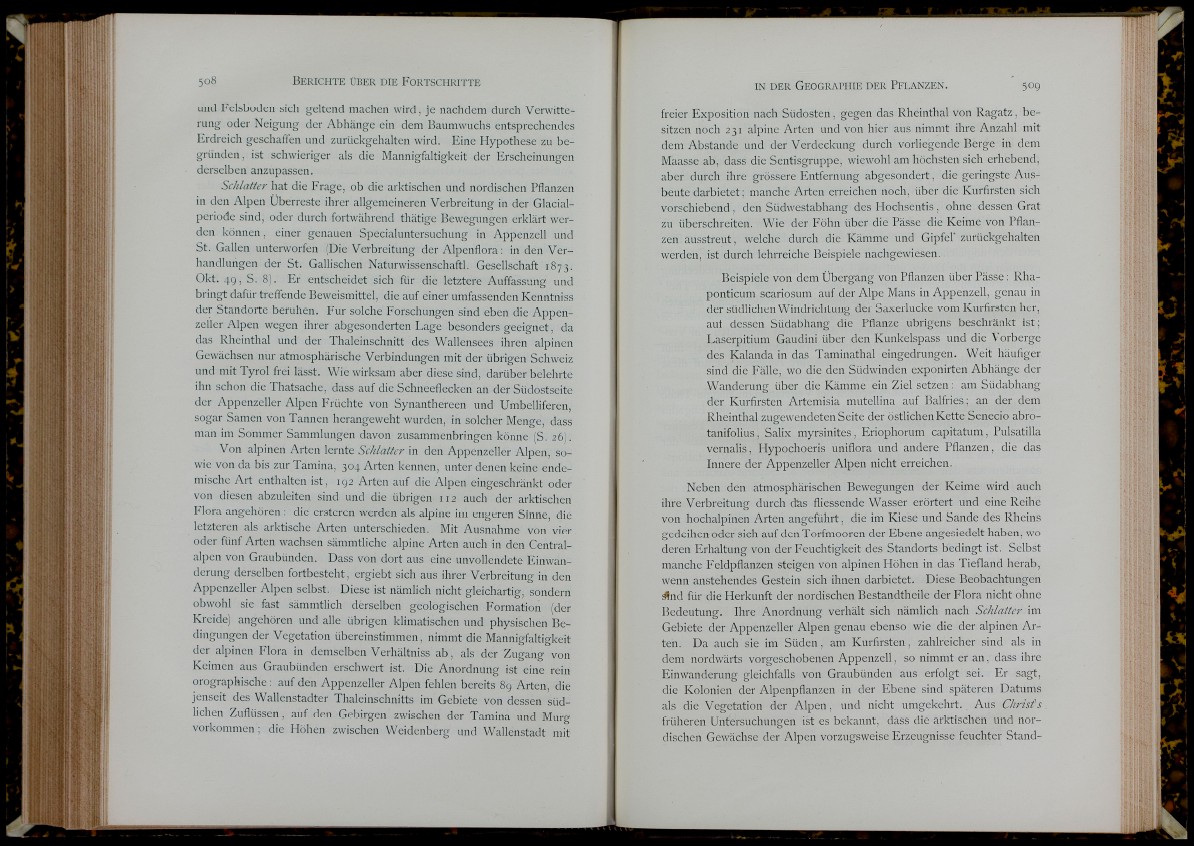
ì m
so8 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
und Fcisboden sich geltend machen wird^ je nachdem durch Verwitterung
oder Neigung der Abhänge ein dem Baumwuchs entsprechendes
Erdreich geschaffen und zurückgehalten wird. Eine Hypothese zu begründen,
ist schwieriger als die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen
derselben anzupassen.
Schlatter hat die Frage, ob die arktischen und nordischen Pflanzen
in den Alpen Überreste ihrer allgemeineren Verbreitung in der Glacialperiode
sind, oder durch fortwährend thätige Bewegungen erklärt worden
können, einer genauen Specialuntersuchung in Appenzell und
St. Gallen unterworfen (Die Verbreitung der Alpenflora: in den Verhandlungen
der St. Gallischen Naturwissenschaftl. Gesellschaft 1873.
Okt. 49, S. 8). Er entscheidet sich für die letztere Auffassung und
bringt dafür treffende Beweismittel, die auf einer umfassenden Kenntniss
der Standorte beruhen. Für solche Forschungen sind eben die Appenzeller
Alpen wegen ihrer abgesonderten Lage besonders geeignet, da
das Rheinthal und der Thaleinschnitt des Wallensees ihren alpinen
Gewächsen nur atmosphärische Verbindungen mit der übrigen Schwciz
und mitTyrol frei lässt. Wie wirksam aber diese sind, darüber belehrte
ihn schon die Thatsache, dass auf die Schneeflecken an der Südostseite
der Appenzeller Alpen Früchte von Synanthereen und Umbelliferen,
sogar Samen von Tannen herangeweht wurden, in solcher Menge, dass
man im Sommer Sammlungen davon zusammenbringen könne (S. 26).
Von alpinen Arten lernte Schlattcr in den Appenzeller Alpen, sowie
von da bis zur Tamina, 304 Arten kennen, unter denen keine endemische
Art enthalten ist, 192 Arten auf die Alpen eingeschränkt oder
von diesen abzuleiten sind und die übrigen 112 auch der arktischen
Flora angehören ; die ersteren werden als alpine im engeren Sinne, die
letzteren als arktische Arten unterschieden. Mit Ausnahme von vier
oder fünf Arten wachsen sämmtliche alpine Arten auch in den Centraialpen
von Graubünden. Dass von dort aus eine unvollendete Einwanderung
derselben fortbesteht, ergiebt sich aus ihrer Verbreitung in den
Appenzeller Alpen selbst. Diese ist nämlich nicht gleichartig, sondern
obwohl sie fast sämmtlich derselben geologischen Formation (der
Kreide) angehören und alle übrigen klimatischen und physischen Bedingungen
der Vegetation übereinstimmen, nimmt die Mannigfaltigkeit
der alpinen Flora in demselben Verhältniss ab, als der Zugang von
Keimen aus Graubünden erschwert ist. Die Anordnung ist eine rein
orographische: auf den Appenzeller Alpen fehlen bereits 89 Arten, die
jenseit des Wallenstadter Thaleinschnitts im Gebiete von dessen südlichen
Zuflüssen, auf den Gebirgen zwischen der Tamina und Murg
vorkommen ; die Höhen zwischen Weidenberg und Wallenstadt mit
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 509
freier Exposition nach Südosten, gegen das Rheinthal von Ragatz, besitzen
noch 231 alpine Arten und von hier aus nimmt ihre Anzahl mit
dem Abstände und der Verdeckung durch vorliegende Berge in dem
Meiasse ab, dass die Sentisgruppe, wiewohl am höchsten sich erhebend,
aber durch ihre grössere Entfernung abgesondert, die geringste Ausbeute
darbietet; manche Arten erreichen noch, über die Kurfirsten sich
vorschiebend, den Südwestabhang des Hochsentis, ohne dessen Grat
zu überschreiten. Wie der Föhn über die Pässe die Keime von Pflanzen
ausstreut, welche durch die Kämme und GipfeF zurückgehalten
werden, ist durch lehrreiche Beispiele nachgewiesen.
Beispiele von dem Übergang von Pflanzen über Pässe: Rhaponticuni
scariosum auf der Alpe Mans in Appenzell, genau in
der südlichen Windrichtung der Saxerlucke vom Kurfirsten her,
auf dessen Südabhang die Pflanze übrigens beschränkt ist;
Laserpitium Gaudini über den Kunkelspass und die Vorberge
des Kalanda in das Taminathal eingedrungen. Weit häufiger
sind die Fälle, wo die den Südwinden exponirten Abhänge der
Wanderung über die Kämme ein Ziel setzen: am Südabhang
der Kurfirsten Artemisia mutellina auf Baifries; an der dem
Rheinthal zugewendeten Seite d^r östlichenKette Senecio abrotanifolius,
Salix myrsinites, Eriophorum capitatum, Pulsatilla
vernalis, Hypochoeris uniflora und andere Pflanzen, die das
Innere der Appenzeller Alpen nicht erreichen.
Neben den atmosphärischen Bewegungen der Keime wird auch
ihre Verbreitung durch däs fliessende Wasser erörtert und eine Reihe
von hochalpinen Arten angeführt, die im Kiese und Sande des Rheins
gedeihen oder sich auf den Torfmooren der Ebene angesiedelt haben, wo
deren Erhaltung von der Feuchtigkeit des Standorts bedingt ist. Selbst
manche Feldpflanzen steigen von alpinen Höhen in das Tiefland herab,
wenn anstehendes Gestein sich ihnen darbietet. Diese Beobachtungen
sind für die Herkunft der nordischen Bestandtheile der Flora nicht ohne
Bedeutung. Ihre Anordnung verhält sich nämlich nach Schlatter im
Gebiete der Appenzeller Alpen genau ebenso wie die der alpinen Arten.
Da auch sie im Süden, am Kurfirsten, zahlreicher sind als in
dem nordwärts vorgeschobenen Appenzell, so nimmt er an, dass ihre
Einwanderung gleichfalls von Graubünden aus erfolgt sei. Er sagt,
die Kolonien der Alpenpflanzen in der Ebene sind späteren Datums
als die Vegetation der Alpen, und nicht umgekehrt. . Aus Christes
früheren Untersuchungen ist es bekannt, dass die arktischen und nordischen
Gewächse der Alpen vorzugsweise Erzeugnisse feuchter Stand-
" ¡r!
fei; ni
Afilli'irti
'••'ili^
?F LU!
k..
iL«:
I
tPi !