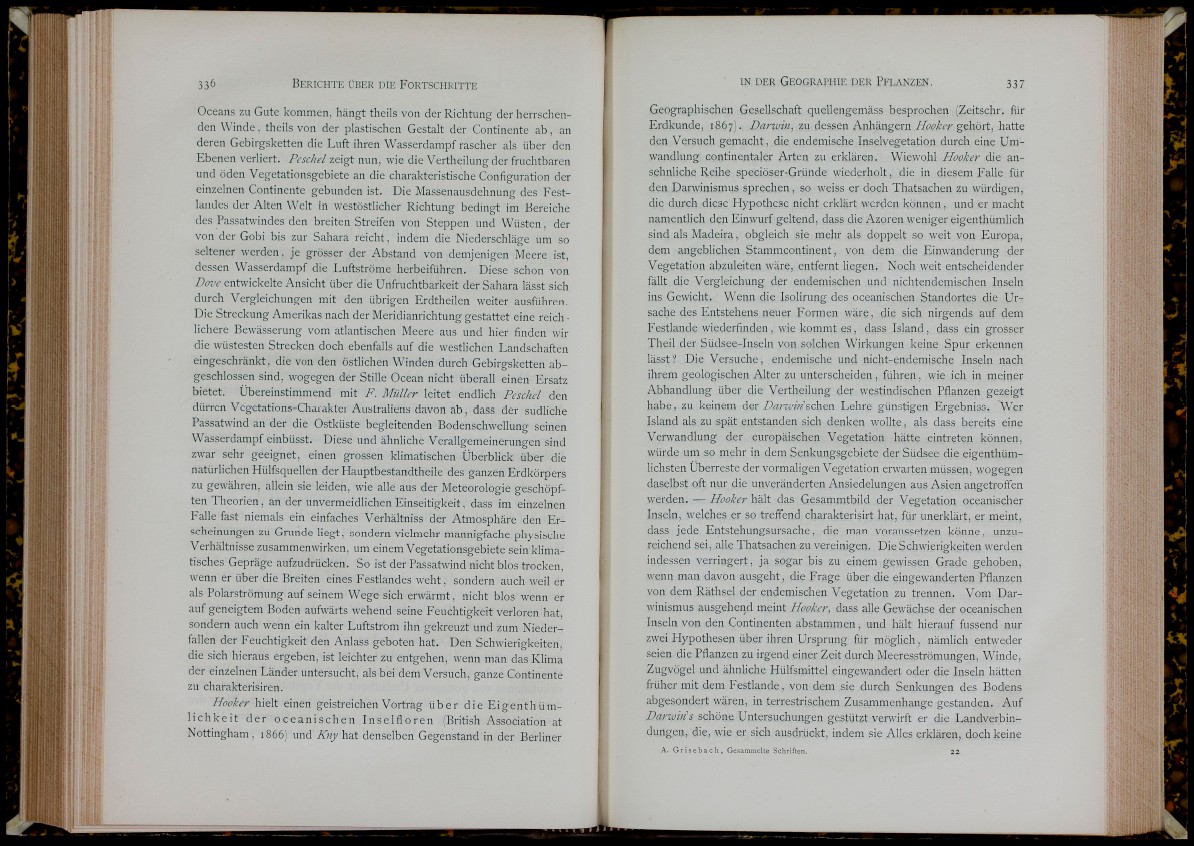
'S
BERICPITE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
Oceans zu Gute kommen, hängt theils von der Richtung der herrschenden
Winde, theils von der plastischen Gestalt der Continente ab, an
deren Gebirgsketten die Luft ihren Wasserdampf rascher als über den
Ebenen verliert. PcscJiel zeigt nun, wie die Vertheilung der fruchtbaren
und öden Vegetationsgebiete an die charakteristische Configuration der
einzelnen Continente gebunden ist. Die Massenausdehnung des Festlandes
der Alten Welt in westöstlicher Richtung bedingt im Bereiche
des Passatwindes den breiten Streifen von Steppen und Wüsten, der
von der Gobi bis zur Sahara reicht, indem die Niederschläge um so
seltener werden, je grösser der Abstand von demjenigen Meere ist,
dessen Wasserdampf die Luftströme herbeiführen. Diese schon von
Dove entwickelte Ansicht über die Unfruchtbarkeit der Sahara lässt sich
durch Vergleichungen mit den übrigen Erdtheilen weiter ausführen.
Die Streckung Amerikas nach der Meridianrichtung gestattet eine reich -
lichere Bewässerung vom atlantischen Meere aus und hier finden wir
die wüstesten Strecken doch ebenfalls auf die westlichen Landschaften
eingeschränkt, die von den östlichen Winden durch Gebirgsketten abgeschlossen
sind, wogegen der Stille Ocean nicht überall einen Ersatz
bietet. Übereinstimmend mit F. Müller leitet endlich Peschel den
dürren Vegetations-Charakter Australiens davon ab, dass der südliche
Passatwind an der die Ostküste begleitenden Bodenschwellung seinen
Wasserdampf einbüsst. Diese und ähnliche Verallgemeinerungen sind
zwar sehr geeignet, einen grossen klimatischen Überblick über die
natürlichen Hülfsquellen der Hauptbestandtheile des ganzen Erdkörpers
zu gewähren, allein sie leiden, wie alle aus der Meteorologie geschöpften
Theorien, an der unvermeidlichen Einseitigkeit, dass im einzelnen
Falle fast niemals ein einfaches Verhältniss der Atmosphäre den Erscheinungen
zu Grunde liegt, sondern vielmehr mannigfache physische
Verhältnisse zusammenwirken, um einem Vegetationsgebiete sein klimatisches
Gepräge aufzudrücken. So ist der Passatwind nicht blos trocken,
wenn er über die Breiten eines Festlandes weht, sondern auch weil er
als Polarströmung auf seinem Wege sich erwärmt, nicht blos wenn er
auf geneigtem Boden aufwärts wehend seine Feuchtigkeit verloren hat,
sondern auch wenn ein kalter Luftstrom ihn gekreuzt und zum Niederfallen
der Feuchtigkeit den Anlass geboten hat. Den Schwierigkeiten,
die sich hieraus ergeben, ist leichter zu entgehen, wenn man das Klima
der einzelnen Länder untersucht, als bei dem Versuch, ganze Continente
zu charakterisiren.
Hooker hielt einen geistreichen Vortrag über die Eigenthüml
i c h k e i t der oceanischen Inselfloren (British Association at
Nottingham, 1866) und Kny hat denselben Gegenstand in der Berliner
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 337
Geographischen Gesellschaft quellengemäss besprochen (Zeitschr. für
Erdkunde, 1867). Darzvin^ zu dessen Anhängern Hooker gehört, hatte
den Versuch gemacht, die endemische Inselvegetation durch eine Umwandlung
continentaler Arten zu erklären. Wiewohl Hooker die ansehnliche
Reihe speciöser-Gründe wiederholt, die in diesem Falle für
den Darwinismus sprechen, so weiss er doch Thatsachen zu würdigen,
die durch diese Hypothese nicht erklärt werden können, und er macht
namenthch den Einwurf geltend, dass die Azoren weniger eigenthümhch
sind als Madeira, obgleich sie mehr als doppelt so weit von Europa,
dem angeblichen Stammcontinent, von dem die Einwanderung der
Vegetation abzuleiten wäre, entfernt liegen. Noch weit entscheidender
fällt die Vergleichung der endemischen und nichtendemischen Inseln
ins Gewicht. Wenn die Isolirung des oceanischen Standortes die Ursache
des Entstehens neuer Formen wäre, die sich nirgends auf dem
Festlande wiederfinden, wie kommt es, dass Island, dass ein grosser
Theil der Südsee-Inseln von solchen Wirkungen keine Spur erkennen
lässt? Die Versuche, endemische und nicht-endemische Inseln nach
ihrem geologischen Alter zu unterscheiden, führen, wie ich in meiner
Abhandlung über die Vertheilung der westindischen Pflanzen gezeigt
habe, zu keinem der Z^^rze^m'schen Lehre günstigen Ergebniss. ~Wer
Island als zu spät entstanden sich denken wollte, als dass bereits eine
Verwandlung der europäischen Vegetation hätte eintreten können,
würde um so mehr in dem Senkungsgebiete der Südsee die eigenthümliebsten
Überreste der vormaligen Vegetation erwarten müssen, wogegen
daselbst oft nur die unveränderten Ansiedelungen aus Asien angetroffen
werden. — Hooker hält das Gesammtbild der Vegetation oceanischer
Inseln, welches er so treff'end charakterisirt hat, für unerklärt, er meint,
dass jede Entstehungsursache, die man voraussetzen könne, unzureichend
sei, alle Thatsachen zu vereinigen. Die Schwierigkeiten werden
indessen verringert, ja sogar bis zu einem gewissen Grade gehoben,
wenn man davon ausgeht, die Frage über die eingewanderten Pflanzen
von dem Räthsel der endemischen Vegetation zu trennen. Vom Darwinismus
ausgehend meint Hooker^ dass alle Gewächse der oceanischen
Inseln von den Continenten abstammen, und hält hierauf fussend nur
zwei Hypothesen über ihren Ursprung für möglich, nämlich entweder
seien die Pflanzen zu irgend einer Zeit durch Meeresströmungen, Winde,
Zugvögel und ähnhche Hülfsmittel eingewandert oder die Inseln hätten
früher mit dem Festlande, von dem sie durch Senkungen des Bodens
abgesondert wären, in terrestrischem Zusammenhange gestanden. Auf
Darzvin's schöne Untersuchungen gestützt verwirft er die Landverbindungen,
die, wie er sich ausdrückt, indem sie Alles erklären, doch keine
A. G r i s e b a c h , Gesammelte Schriften.
, I ( i>"ili
f
W»,
i iV' i
ITR-1 ^
Uli! lifi
" 1 1 1 1
i
y^ifii- '
, Irl'
Mäiii!
I''
lliit'-