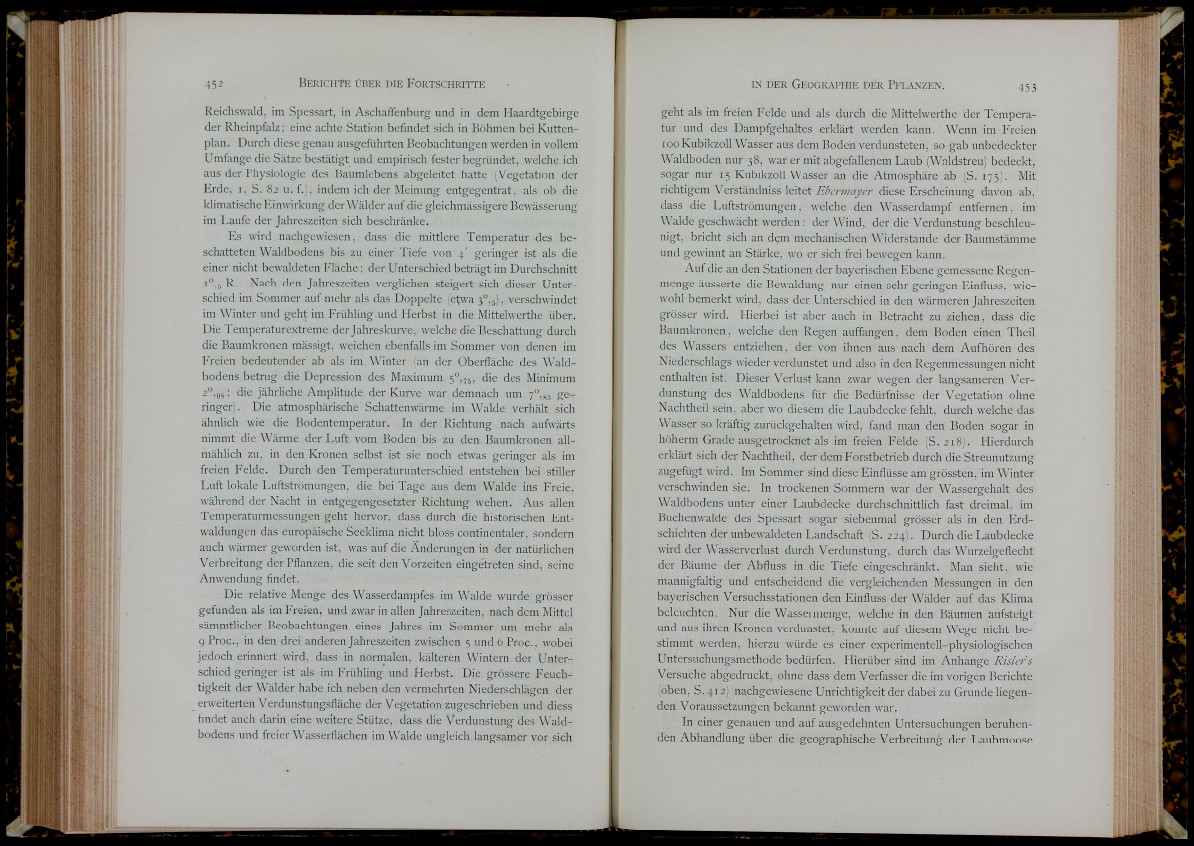
!
f n :
• < f » ^ 11
iit
it
I M-.
452 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
Reicliswald, im Spessart, in Aschaffenburg und in dem Haardtgebirge
der Rheinpfalz; eine achte Station befindet sich in Böhmen bei Kuttenplan.
Durch diese genau ausgeführten Beobachtungen werden in vollem
Umfange die Sätze bestätigt und empirisch fester begründet^ welche ich
aus der Physiologie des Baumlebens abgeleitet hatte (Vegetation der
ERDCJ I, S. 82 u. f.), indem ich der Meinung entgegentrat, als ob die
klimatische Einwirkung der Wälder auf die gieichmässigere Bewässerung
im Laufe der Jahreszeiten sich beschränke.
Es wird nachgewiesen, dass die mittlere Temperatur -des beschatteten
ringei
Waldbodens bis zu einer Tiefe von 4' geringer ist als die
einer nicht bewaldeten Fläche ; der Unterschied beträgt im Durchschnitt
R. Nach den Jahreszeiten verglichen steigert sich dieser Unterschied
im Sommer auf mehr als das Doppelte (e^wa verschwindet
im Winter und geht im Frühlingamd Herbst in die Mittelwerthe über.
Die Temperaturextreme der Jahreskurve, welche die Beschattung durch
die Baumkronen mässigt, weichen ebenfalls im Sommer von denen im
Freien bedeutender ab als im Winter (an der Oberfläche des Waldbodens
betrug die Depression des Maximum die des Minimum
die jährliche Amplitude der Kurve war demnach um 7^,33 ge-
. Die atmosphärische Schattenwärme im Walde verhält sich
ähnlich wie die Bodentemperatur. In der Richtung nach aufwärts
nimmt die Wärme der Luft vom Boden bis zu den Baumkronen allmählich
zu, in den Kronen selbst ist sie noch etwas geringer als im
freien Felde. Durch den Temperaturunterschied entstehen bei stiller
Luft lokale Luftströmungen, die bei Tage aus dem Walde ins Freie,
während der Nacht in entgegengesetzter Richtung wehen. Aus allen
Temperaturmessungen geht hervor, dass durch die historischen Entwaldungen
das europäische Seeklima nicht bloss continentaler, sondern
auch wärmer geworden ist, was auf die Änderungen in der natürhchen
Verbreitung der Pflanzen, die seit den Vorzeiten eingetreten sind, seine
Anwendung findet.
Die relative Menge des Wasserdampfes im W^alde wurde grösser
gefunden als im Freien, und zwar in allen Jahreszeiten, nach dem Mittel
sämmtlicher Beobachtungen eines Jahres im Sommer um mehr als
9 Proc., in den drei anderen Jahreszeiten zwischen 5 und 6 Proc., wobei
jedoch erinnert wird, dass in normalen, kälteren Wintern der Unterschied
geringer ist als im Frühling und Herbst. Die grössere Feuchtigkeit
der Wälder habe ich neben den vermehrten Niederschlägen der
erweiterten Verdunstungsfläche der Vegetation zugeschrieben und diess
findet auch darin eine weitere Stütze, dass die Verdunstung des Waldbodens
und freier Wasserflächen im Walde ungleich langsamer vor sich
i
I
h
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 453
geht als im freien Felde und als durch die Mittelwerthe der Temperatur
und des Dampfgehaltes erklärt werden kann. Wenn im Freien
lOoKubikzoll Wasser aus dem Boden verdunsteten, so gab unbedeckter
Waldboden nur 38, war er mit abgefallenem Laub (Waldstreu) bedeckt,
sogar nur 15 Kubikzoll Wasser an die Atmosphäre ab (S. 175). Mit
richtigem Verständniss leitet Ebermayer diese Erscheinung davon ab,
dass die Luftströmungen, welche den Wasserdampf entfernen, im
Walde geschwächt werden: der Wind, der die Verdunstung beschleunigt,
bricht sich an dem mechanischen Widerstande der Baumstämme
und gewinnt an Stärke, wo er sich frei bewegen kann.
Auf die an den Stationen der bayerischen Ebene gemessene Regenmenge
äusserte die Bewaldung nur einen sehr geringen Einfluss, wiewohl
bemerkt wird, dass der Unterschied in den wärmeren Jahreszeiten
grösser wird. Hierbei ist aber auch in Betracht zu ziehen, dass die
Baumkronen, welche den Regen auffangen, dem Boden einen Theil
des Wassers entziehen, der von ihnen aus nach dem Aufhören des
Niederschlags wieder verdunstet und also in den Regenmessungen nicht
enthalten ist. Dieser Verlust kann zwar wegen der langsameren Verdunstung
des Waldbodens für die Bedürfnisse der Vegetation ohne
Nachtheil sein, aber wo diesem die Laubdecke fehlt, durch welche das
Wasser so Icräftig zurückgehalten wird, fand man den Boden sogar in
höherm Grade ausgetrocknet als im freien Felde (S. 218). Hierdurch
erklärt sich der Nachtheil, der dem Forstbetrieb durch die Streunutzung
zugefügt wird. Im Sommer sind diese Einflüsse am grössten, im Winter
verschwinden sie. In trockenen Sommern war der Wassergehalt des
Waldbodens unter einer Laubdecke durchschnittHch fast dreimal, im
Buchenwalde des Spessart sogar siebenmal grösser als in den Erdschichten
der unbewaldeten Landschaft (S. 224). Durch die Laubdecke
wird der Was^erverlust durch Verdunstung, durch das Wurzelgeflecht
der Bäume der Abfluss in die Tiefe eingeschränkt. Man sieht, wie
mannigfaltig und entscheidend die vergleichenden Messungen in den
bayerischen Versuchsstationen den Einfluss der Wälder auf das Klima
beleuchten. Nur die Wassermenge, welche in den Bäumen aufsteigt
und aus ihren Kronen verdunstet, konnte auf diesem Wege nicht bestimmt
werden, hierzu würde es einer experimentell-physiologischen
Untersuchungsmethode bedürfen. Hierüber sind im Anhange Risler's
Versuche abgedruckt, ohne dass dem Verfasser die im vorigen Berichte
(oben, S. 412) nachgewiesene Unrichtigkeit der dabei zu Grunde hegenden
Voraussetzungen bekannt geworden war.
In einer genauen und auf ausgedehnten Untersuchungen beruhenden
Abhandlung über die geographische Verbreitung der Laubmoose
1 1
i i l l i l l i
' I
Ii
1
I ^ II
iI'Il
f f
I i