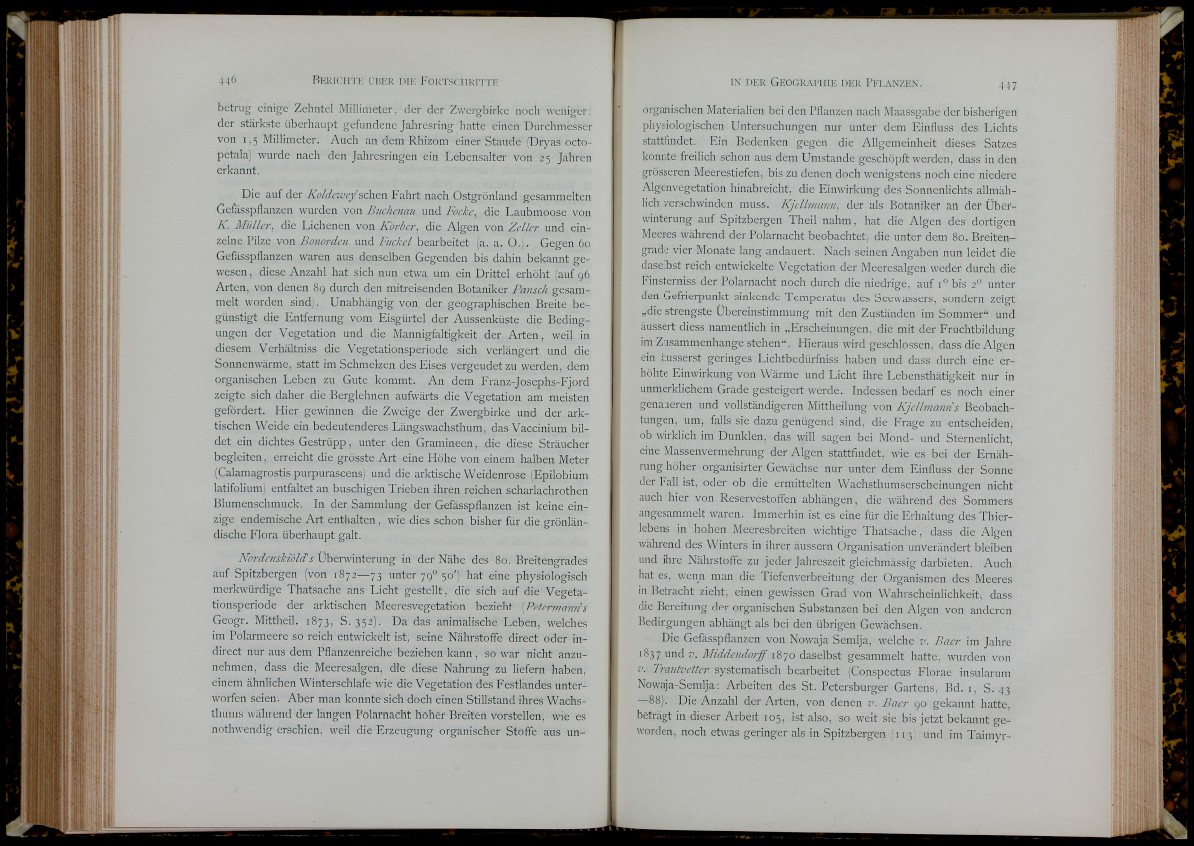
ntisn-i!
•ßhli:
ii
i i l i t i
Plliinii
. 14! twfi
•m
r!
1 {;.:n i- t i a
fli
' h m m
t- iite.cHIIPI :
fc »in
.[•ILRF,;'!
; ¿/. i f i f i i i
: ili:
I i i
L^KKICLLTK ÜBER 1)11-: I^^OKTSCIIRITTK
betrug einige Zehntel Millimeter, der der Zwergbirke noch weniger:
der stärkste überhaupt gefundene Jahresring hatte einen Durchmesser
von 1,5 Millimeter. Auch an dem Rhizom einer Staude (Dryas octopetala)
wurde nach den Jahresringen ein Lebensalter von 25 Jahren
erkannt.
Die auf der KoMezvcy sehen Fahrt nach Ostgrönland gesammelten
Gefässpflanzen wurden von BiLchcnatt und Fockc^ die Laubmoose von
K. Müller, die Lichenen von Körber, die Algen von Zcller und einzelne
Pilze von Bonorden und Fuckel bearbeitet (a. a. O.). Gegen 60
Gefässpflanzen waren aus denselben Gegenden bis dahin bekannt gewesen,
diese Anzahl hat sich nun etwa um ein Drittel erhöht (auf 96
Arten, von denen 89 durch den mitreisenden Botaniker Pansch gesammelt
worden sind). Unabhängig von der geographischen Breite begünstigt
die Entfernung vom Eisgürtel der Aussenküste die Bedingungen
der Vegetation und die Mannigfaltigkeit der Arten, weil in
diesem Verhältniss die Vegetationsperiode sich verlängert und die
Sonnenwärme, statt im Schmelzen des Eises vergeudet zu werden, dem
organischen Leben zu Gute kommt. An dem Franz-Josephs-Fjord
zeigte sich daher die Berglehnen aufwärts die Vegetation am meisten
gefördert. Hier gewinnen die Zweige der Zwergbirke und der arktischen
Weide ein bedeutenderes Längswachsthum, das Vaccinium bildet
ein dichtes Gestrüpp, unter den Gramineen, die diese Sträucher
begleiten, erreicht die grösste Art eine Höhe von einem halben Meter
(Calamagrostis purpurascens) und die arktische Weidenrose (Epilobium
latifolium) entfaltet an buschigen Trieben ihren reichen schariachrothen
Blumenschmuck. Li der Sammlung der Gefässpflanzen ist keine einzige
endemische Art enthalten, wie dies schon bisher für die grönländische
Flora überhaupt galt.
NorclcnskidlcCs Viher-^mtexvmg in der Nähe des 80. Breitengrades
auf Spitzbergen (von 1872—73 unter 79° 50') hat eine physiologisch
merkwürdige Thatsache ans Licht gestellt, die sich auf die Vegetationsperiode
der arktischen Meeresvegetation bezieht [Petermamis
Geogr. Mittheil. 1873, S. 352), Da das animalische Leben^ welches
im Polarmeere so reich entwickelt ist, seine Nährstoffe direct oder indirect
nur aus dem. Pflanzenreiche beziehen kann, so war nicht anzunehmen,
dass die Meeresalgen, die diese Nahrung zu liefern haben^
einem ähnlichen Winterschlafe wie die Vegetation des Festlandes unterworfen
seien. Aber man konnte sich doch einen Stillstand ihres Wachsthums
während der langen Polarnacht hoher Breiten vorstellen, wie es
nothwendig erschien, weil die Erzeugung organischer Stoffe aus un-
1
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN.
organischen Materialien bei den Pflanzen nach Maassgabe der bisherigen
physiologischen Untersuchungen nur unter dem Einfluss des Lichts
stattfindet. Ein Bedenken gegen die Allgemeinheit dieses Satzes
konnte freilich schon aus dem Umstände geschöpft werden, dass in den
grösseren Meerestiefen, bis zu denen doch wenigstens noch eine niedere
Algenvegetation hinabreicht^ die Einwirkung des SonnenHchts allmählich
verschwinden muss. Kjellmann, der als Botaniker an der Überwinterung
auf Spitzbergen Theil nahm, hat die Algen des dortigen
Meeres während der Polarnacht beobachtet, die unter dem 80. Breitengrade
vier Monate lang andauert. Nach seinen Angaben nun leidet die
daselbst reich entwickelte Vegetation der Meeresalgen weder durch die
Finsterniss der Polarnacht noch durch die niedrige, auf i" bis 2^' unter
den Gefrierpunkt sinkende Temperatur des Seewassers, sondern zeigt
„die strengste Übereinstimmung mit den Zuständen im Sommer" und
äussert diess namenthch in „Erscheinungen^ die mit der Fruchtbildung
im Zusammenhange stehen". Hieraus wird geschlossen, dass die Algen
ein äusserst geringes Lichtbedürfniss haben und dass durch eine erhöhte
Einwirkung von Wärme und Licht ihre Lebensthätigkeit nur in
unmerklichem Grade gesteigert werde. Indessen bedarf es noch einer
genaueren und vollständigeren Mittheilung von Kjellmamis Beobachtungen,
um^ falls sie dazu genügend sind, die Frage zu entscheiden,
ob wirklich im Dunklen, das will sagen bei Mond- und Sternenlicht,
eine Massenvermehrung der Algen stattfindet, wie es bei der Ernährung
höher organisirter Gewächse nur unter dem Einfluss der Sonne
der Fall ist, oder ob die ermittelten Wachsthumserscheinungen nicht
auch hier von Reservestoffen abhängen, die während des Sommers
angesammelt waren. Immerhin ist es eine für die Erhaltung des Thierlebens
in hohen Meeresbreiten wichtige Thatsache,' dass die Algen
während des Winters in ihrer äussern Organisation unverändert bleiben
und ihre Nährstoff'e zu jeder Jahreszeit gleichmässig darbieten. Auch
hat es, wenn man die Tiefenverbreitung der Organismen des Meeres
in Iktracht zieht, einen gewissen Grad von Wahrscheinhchkeit, dass
die Bereitung der organischen Substanzen bei den Algen von anderen
Bedingungen abhängt als bei den übrigen Gewächsen.
Die Gefässpflanzen von Nowaja Semlja, welche v, Baer im Jahre
1837 und v^ Mtddendorff 1870 daselbst gesammelt hatte, wurden von
Trantvetter systematisch bearbeitet (Conspectus Florae insularum
Nowaja-Semlja: Arbeiten des St. Petersburger Gartens, Bd. i, S. 43
—88). Die Anzahl der Arten, von denen v. Baer 90 gekannt hatte,
beträgt in dieser Arbeit 105, ist also, so weit sie bis jetzt bekannt geworden,
noch etwas geringer als in Spitzbergen (113; und im Taimyr-»
l U
"^iB i
«i'fi j
Hvjl I H
I, ,
i i
Uii
' tV"
In«!