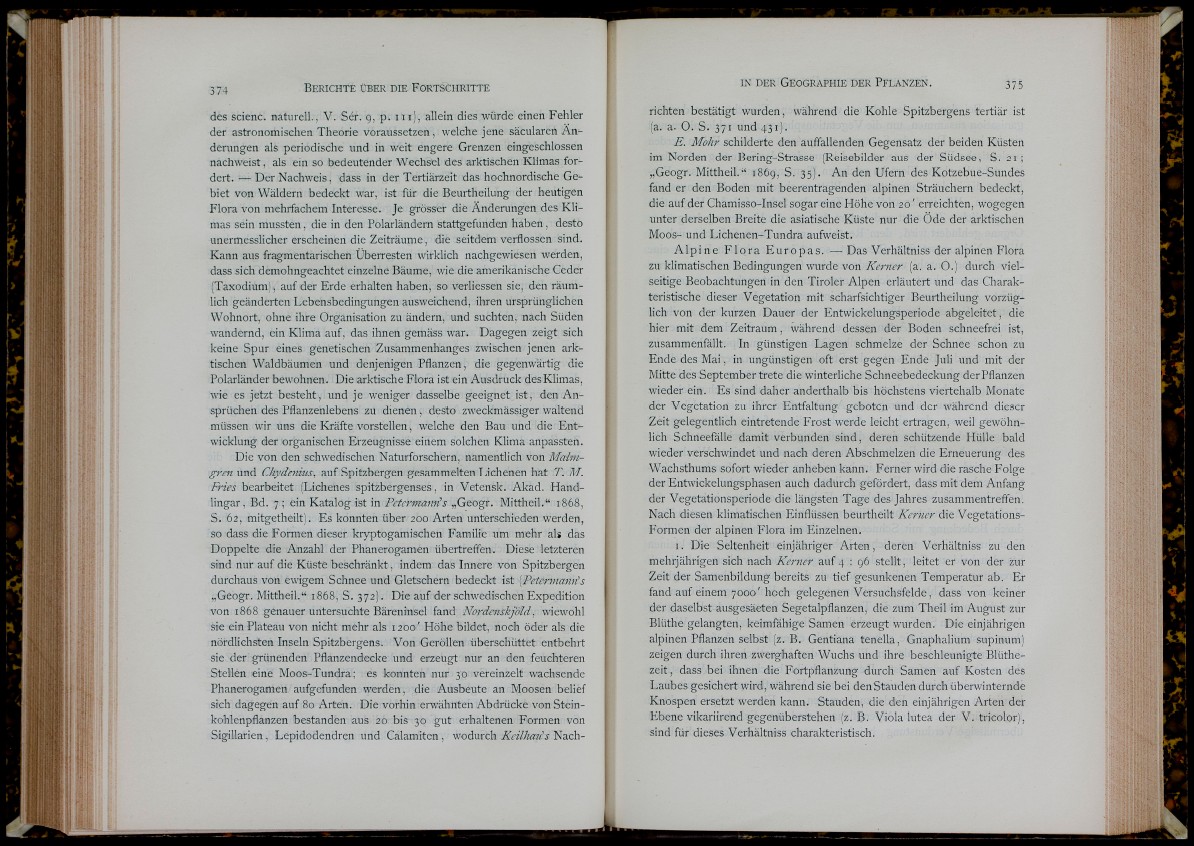
I R: ^
nMiimif! ' T K U l i i K a
m
Ijii
t-'
374 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
des scienc. naturell, V. Ser. g, p. iii)^ allein dies würde einen Fehler
der astronomischen Theorie voraussetzen, welche jene säcularen Änderungen
als periodische und in weit engere Grenzen eingeschlossen
nachweist, als ein so bedeutender Wechsel des arktischen Klimas fordert.
— Der Nachweis j dass in der Tertiärzeit das hochnordische Gebiet
von Wäldern bedeckt war, ist für die Beurtheilung der heutigen
Flora von mehrfachem Interesse. Je grösser die Änderungen des Klimas
sein mussten, die in den Polarländern stattgefunden haben, desto
unermesslicher erscheinen die Zeiträume, die seitdem verflossen sind.
Kann aus fragmentarischen Überresten wirklich nachgewiesen werden,
dass sich demohngeachtet einzelne Bäume, wie die amerikanische Ceder
(Taxodium), auf der Erde erhalten haben, so verliessen sie, den räumlich
geänderten Lebensbedingungen ausweichend, ihren ursprünglichen
Wohnort, ohne ihre Organisation zu ändern, und suchten, nach Süden
wandernd, ein Klima auf, das ihnen gemäss war. Dagegen zeigt sich
keine Spur eines genetischen Zusammenhanges zwischen jenen arktischen
Waldbäumen und denjenigen Pflanzen, die gegenwärtig die
Polarländer bewohnen. Die arktische Flora ist ein Ausdruck des Klimas,
wie es jetzt besteht, und je weniger dasselbe geeignet ist, den Ansprüchen
des Pflanzenlebens zu dienen, desto zweckmässiger waltend
müssen wir uns die Kräfte vorstellen, welche den Bau und die Entwicklung
der organischen Erzeugnisse einem solchen Klima anpassten.
Die von den schwedischen Naturforschern, namentlich von Malmgren
und Chydenius^ auf Spitzbergen gesammelten Lichenen hat T, M.
Fries bearbeitet (Eichenes spitzbergenses, in Vetensk. Akad. Handlingar,
Bd. 7; ein Katalog ist in Petcrmamis „Geogr. Mittheil." 1868,
S. 62, mitgetheilt). Es konnten über 200 Arten unterschieden werden,
so dass die Formen dieser kryptogamischen Familie um mehr als das
Doppelte die Anzahl der Phanerogamen übertreffen. Diese letzteren
sind nur auf die Küste beschränkt, indem das Innere von Spitzbergen
durchaus von ewigem Schnee und Gletschern bedeckt ist [Petermamis
„Geogr. Mittheil." 1868, S. 372). Die auf der schwedischen Expedition
von 1868 genauer untersuchte Bäreninsel fand Nordenskjold^ wiewohl
sie ein Plateau von nicht mehr als 1200' Höhe bildet, noch öder als die
nördlichsten Inseln Spitzbergens. Von Gerollen überschüttet entbehrt
sie der "grünenden Pflanzendecke und erzeugt nur an den feuchteren
Stellen eine Moos-Tundra; es konnten nur 30 vereinzelt wachsende
Phanerogamen aufgefunden werden, die Ausbeute an Moosen belief
sich dagegen auf 80 Arten. Die vorhin erwähnten Abdrücke von Steinkohlenpflanzen
bestanden aus 20 bis 30 gut erhaltenen Formen von
Sigillarien, Lepidodendren und Calamiten, wodurch Keilhmüs Nach-
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN.
richten bestätigt wurden, während die Kohle Spitzbergens tertiär ist
(a. a. O. S. 371 und 431).
E. Mohr schilderte den auffallenden Gegensatz der beiden Küsten
im Norden der Bering-Strasse (Reisebilder aus der Südsee, S. 21;
„Geogr. Mittheil." 1869, S. 35). An den Ufern des Kotzebue-Sundes
fand er den Boden mit beerentragenden alpinen Sträuchern bedeckt,
die auf der Chamisso-Insel sogar eine Höhe von 20' erreichten, wogegen
unter derselben Breite die asiatische Küste nur die Öde der arktischen
Moos- und Lichenen-Tundra aufweist.
A l p i n e Flora Europas. •— Das Verhältniss der alpinen Flora
zu klimatischen Bedingungen wurde von Kerner (a. a. O.) durch vielseitige
Beobachtungen in den Tiroler Alpen erläutert und das Charakteristische
dieser Vegetation mit scharfsichtiger Beurtheilung vorzüglich
von der kurzen Dauer der Entwickelungsperiode abgeleitet, die
hier mit dem Zeitraum, während dessen der Boden schneefrei ist,
zusammenfällt. In günstigen Lagen schmelze der Schnee schon zu
Ende des Mai, in ungünstigen oft erst gegen Ende Juli und mit der
Mitte des September trete die winterliche Schneebedeckung der Pflanzen
wieder ein. Es sind daher anderthalb bis höchstens viertehalb Monate
der Vegetation zu ihrer Entfaltung geboten und der während dieser
Zeit gelegentlich eintretende Frost werde leicht ertragen, weil gewöhnlich
Schneefälle damit verbunden sind, deren schützende Hülle bald
wieder verschwindet und nach deren Abschmelzen die Erneuerung des
Wachsthums sofort wieder anheben kann. Ferner wird die rasche Folge
der Entwickelungsphasen auch dadurch gefördert, dass mit dem Anfang
der Vegetationsperiode die längsten Tage des Jahres zusammentreffen.
Nach diesen klimatischen Einflüssen beurtheilt Kerner die Vegetations-
Formen der alpinen Flora im Einzelnen.
I. Die Seltenheit einjähriger Arten, deren Verhältniss zu den
mehrjährigen sich nach Kerner auf 4 : 96 stellt, leitet er von der zur
Zeit der Samenbildung bereits zu tief gesunkenen Temperatur ab. Er
fand auf einem 7000'hoch gelegenen Versuchsfelde, dass von keiner
der daselbst ausgesäeten Segetalpflanzen, die zum Theil im August zur
Blüthe gelangten, keimfähige Samen erzeugt wurden. Die einjährigen
alpinen Pflanzen selbst (z. B. Gentiana tenella, Gnaphalium supinum)
zeigen durch ihren zwerghaften Wuchs und ihre beschleunigte Blüthezeit,
dass bei ihnen die Fortpflanzung durch Samen auf Kosten des
Laubes gesichert wird, während sie bei den Stauden durch überwinternde
Knospen ersetzt werden kann. Stauden, die den einjährigen Arten der
Ebene vikariirend gegenüberstehen (z. B. Viola lutea der V. tricolor),
sind für dieses Verhältniss charakteristisch.
Iii;
Hf
i
^^^ Ii