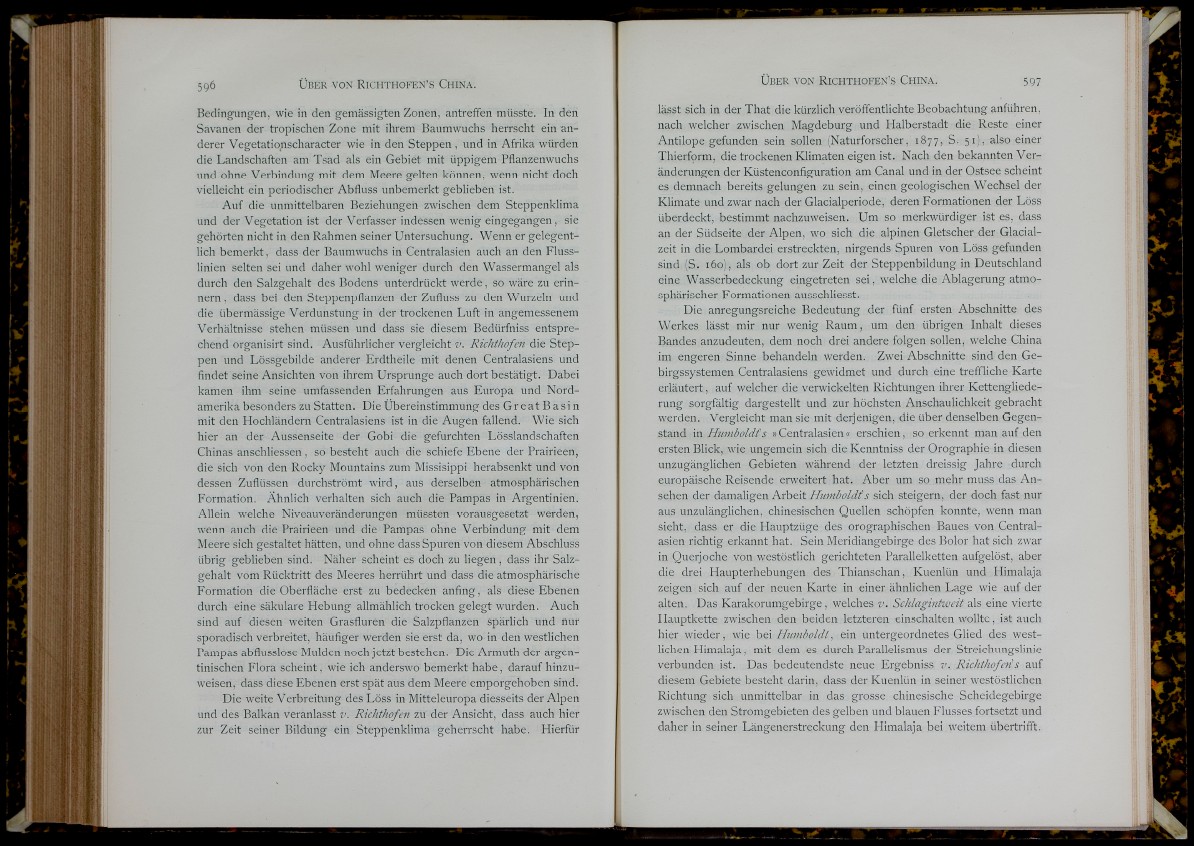
' >i ii ;
j
4
Ii
596 ÜBER VON RICHTI-IOFEN'S CHINA.
Bedingungen, wie in den gemässigten Zonen, antreffen n:iüsste. In den
Savanen der tropischen Zone mit ihrem Baumwuchs herrscht ein anderer
Vegetationscharacter wie in den Steppen , und in Afrika würden
die Landschaften am Tsad als ein Gebiet mit üppigem Pflanzenwuchs
und ohne Verbindung mit dem Meere gelten können, wenn nicht doch
vielleicht ein periodischer Abfluss unbemerkt geblieben ist.
Auf die unmittelbaren Beziehungen zwischen dem Steppenklima
und der Vegetation ist der Verfasser indessen wenig eingegangen, sie
gehörten nicht in den Rahmen seiner Untersuchung. Wenn er gelegentlich
bemerkt, dass der Baumwuchs in Centraiasien auch an den Flusslinien
selten sei und daher wohl weniger durch den Wassermangel als
durch den Salzgehalt des Bodens unterdrückt werde, so wäre zu erinnern
, dass bei den Steppenpflanzen der Zufluss zu den Wurzeln und
die übermässige Verdunstung in der trockenen Luft in angemessenem
Verhältnisse stehen müssen und dass sie diesem Bedürfniss entsprechend
organisirt sind. Ausführlicher vergleicht v. Richthofen die Steppen
und Lössgebilde anderer Erdtheile mit denen Centraiasiens und
findet seine Ansichten von ihrem Ursprünge auch dort bestätigt. Dabei
kamen ihm seine umfassenden Erfahrungen aus Europa und Nordamerika
besonders zu Statten. Die Übereinstimmung des G r e a t Basin
mit den Hochländern Centraiasiens ist in die Augen fallend. Wie sich
hier an der Aussenseite der Gobi die gefurchten Lösslandschaften
Chinas anschliessen, so besteht auch die schiefe Ebene der Prairieen,
die sich von den Rocky Mountains zum Missisippi herabsenkt und von
dessen Zuflüssen durchströmt wird, aus derselben atmosphärischen
Formation. Ähnlich verhalten sich auch die Pampas in Argentinien.
Allein welche Niveauveränderungen müssten vorausgesetzt werden,
wenn auch die Prairieen und die Pampas ohne Verbindung mit dem
Meere sich gestaltet hätten, und ohne dass Spuren von diesem Abschluss
übrig geblieben sind. Näher scheint es doch zu hegen, dass ihr Salzgehalt
vom Rücktritt des Meeres herrührt und dass die atmosphärische
Foi'mation die Oberfläche erst zu bedecken anfing, als diese Ebenen
durch eine säkulare Hebung allmählich trocken gelegt wurden. Auch
sind auf diesen weiten Grasfluren die Salzpflanzen spärhch und nur
sporadisch verbreitet, häufiger werden sie erst da, wo in den westHchen
Pampas abflusslose Mulden noch jetzt bestehen. Die Armuth der argentinischen
Flora scheint, wie ich anderswo bemerkt habe, darauf hinzuweisen,
dass diese Ebenen erst spät aus dem Meere emporgehoben sind.
Die weite Verbreitung des Löss in Mitteleuropa diesseits der Alpen
und des Balkan veranlasst v. Richthofen zu der Ansicht, dass auch hier
zur Zeit seiner Bildung ein Steppenklima geherrscht habe. Hierfür
/
ÜBER VON RICHTHOFEN' S CHINA. 597
lässt sich in der That die kürzlich veröffentlichte Beobachtung anführen,
nach welcher zwischen Magdeburg und Halberstadt die Reste einer
Antilope gefunden sein sollen (Naturforscher, 1877, S. 51), also einer
Thierf9rm, die trockenen Klimaten eigen ist. Nach den bekannten Veränderungen
der Küstenconfiguration am Canal und in der Ostsee scheint
es demnach bereits gelungen zu sein, einen geologischen Wechsel der
Klimate und zwar nach der Glacialperiode, deren Formationen der Löss
überdeckt, bestimmt nachzuweisen. Um so merkwürdiger ist es, dass
an der Südseite der Alpen, wo sich die alpinen Gletscher der Glacialzeit
in die Lombardei erstreckten, nirgends Spuren von Löss gefunden
sind (S. 160), als ob dort zur Zeit der Steppenbildung in Deutschland
eine Wasserbedeckung eingetreten sei, welche die Ablagerung atmosphärischer
Formationen ausschliesst.
Die anregungsreiche Bedeutung der fünf ersten Abschnitte des
Werkes lässt mir nur wenig Raum, um den übrigen Inhalt dieses
Bandes anzudeuten, dem noch drei andere folgen sollen, welche China
im engeren Sinne behandeln werden. Zwei Abschnitte sind den Gebirgssystemen
Centraiasiens gewidmet und durch eine treff'liche Karte
erläutert, auf welcher die verwickelten Richtungen ihrer Kettengliederung
sorgfältig dargestellt und zur höchsten Anschaulichkeit gebracht
werden. Vergleicht man sie mit derjenigen, die über denselben Gegenstand
m Humboldts »Centraiasien« erschien, so erkennt man auf den
ersten Blick, wie ungemein sich die Kenntniss der Orographie in diesen
unzugänglichen Gebieten während der letzten dreissig Jahre durch
europäische Reisende erweitert hat. Aber um so mehr muss das Ansehen
der damaligen A r b e i t s i c h steigern, der doch fast nur
aus unzulänglichen, chinesischen Quellen schöpfen konnte, w^enn man
sieht, dass er die Hauptzüge des orographischen Baues von Centraiasien
richtig erkannt hat. Sein Meridiangebirge des Bolor hat sich zwar
in Querjoche von westöstlich gerichteten Parallelketten aufgelöst, aber
die drei Haupterhebungen des Thianschan, Kuenlün und Himalaja
zeigen sich auf der neuen Karte in einer ähnlichen Lage wie auf der
alten. Das Karakorumgebirge , welches v. Schlagintweit als eine vierte
Hauptkette zwischen den beiden letzteren einschalten wollte, ist auch
hier wieder, wie Humboldt^ ein untergeordnetes Glied des westhchen
Flimalaja, mit dem es durch Parallelismus der Streichungslinie
verbunden ist. Das bedeutendste neue Ergebniss v. Richthofeiis auf
diesem Gebiete besteht darin, dass der Kuenlün in seiner westöstlichen
Richtung sich unmittelbar in das grosse chinesische Scheidegebirge
zwischen den Stromgebieten des gelben und blauen Plusses fortsetzt und
daher in seiner Längenerstreckung den Himalaja bei weitem übertrifft.
'r ;[lu
J4