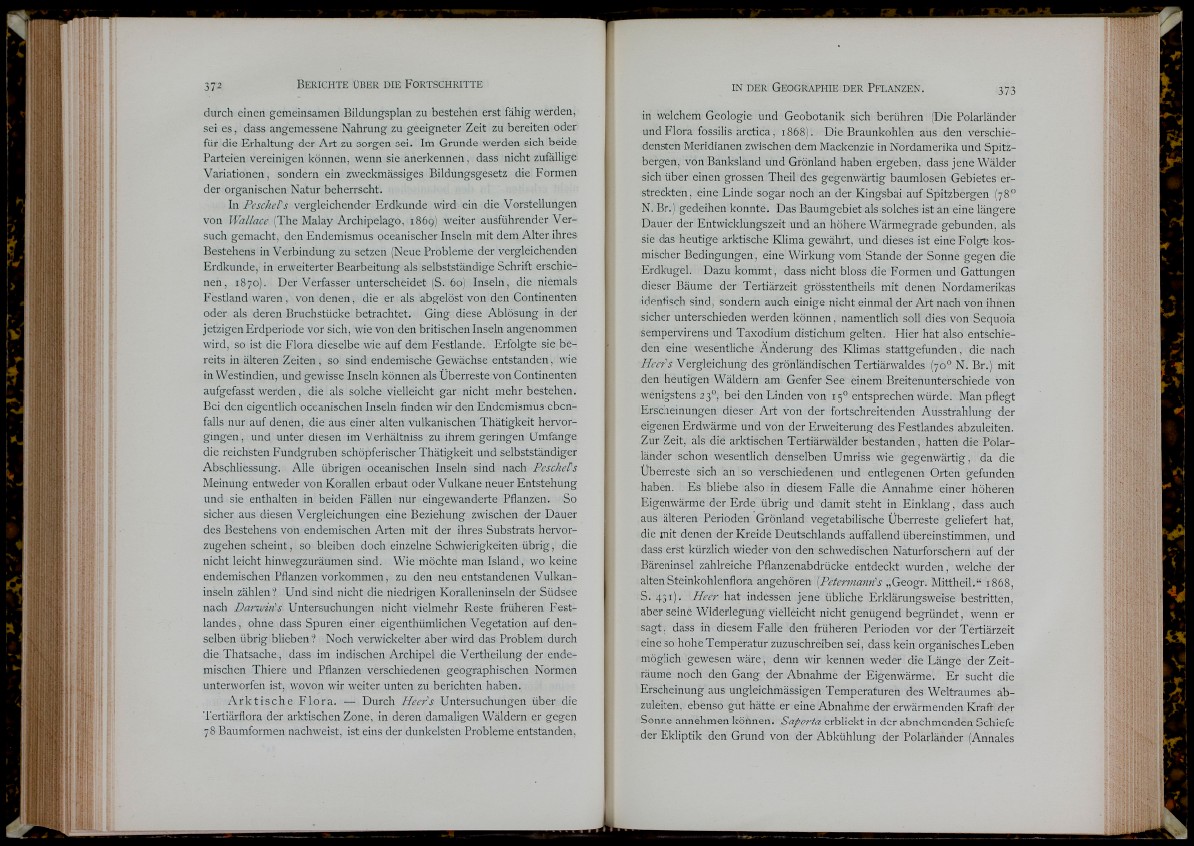
iifilllHiu
Mi-'
' I '. 3 i : "
liillüi
iOIll •äi
f
372 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
durch einen gemeinsamen Bildungsplan zu bestehen erst fähig werden,
sei es, dass angemessene Nahrung zu geeigneter Zeit zu bereiten oder
für die Erhaltung der Art zu sorgen sei. Im Grunde werden sich beide
Parteien vereinigen können, wenn sie anerkennen, dass nicht zufällige
Variationen, sondern ein zweckmässiges Bildungsgesetz die Formen
der organischen Natur beherrscht.
In PescheVs vergleichender Erdkunde wird ein die Vorstellungen
von Wallace (The Malay Archipelago, 1869) weiter ausführender Versuch
gemacht, den Endemismus oceanischer Inseln mit dem Alter ihres
Bestehens in Verbindung zu setzen (Neue Probleme der vergleichenden
Erdkunde, in erweiterter Bearbeitung als selbstständige Schrift erschienen,
1870). Der Verfasser unterscheidet (S. 60) Inseln, die niemals
Festland waren, von denen, die er als abgelöst von den Continenten
oder als deren Bruchstücke betrachtet. Ging diese Ablösung in der
jetzigen Erdperiode vor sich, wie von den britischen Inseln angenommen
wird, so ist die Flora dieselbe wie auf dem Festlande. Erfolgte sie bereits
in älteren Zeiten , so sind endemische Gewächse entstanden, wie
in Westindien, und gewisse Inseln können als Überreste von Continenten
aufgefasst werden, die als solche vielleicht gar nicht mehr bestehen.
Bei den eigentlich oceanischen Inseln finden wir den Endemismus ebenfalls
nur auf denen, die aus einer alten vulkanischen Thätigkeit hervorgingen
, und unter diesen im Verhältniss zu ihrem geringen Umfange
die reichsten Fundgruben schöpferischer Thätigkeit und selbstständiger
Abschliessung. Alle übrigen oceanischen Inseln sind nach Peschers
Meinung entweder von Korallen erbaut oder Vulkane neuer Entstehung
und sie enthalten in beiden Fällen nur eingewanderte Pflanzen. So
sicher aus diesen Vergleichungen eine Beziehung zwischen der Dauer
des Bestehens von endemischen Arten mit der ihres Substrats hervorzugehen
scheint, so bleiben doch einzelne Schwierigkeiten übrig, die
nicht leicht hinwegzuräumen sind. Wie möchte man Island, wo keine
endemischen Pflanzen vorkommen, zu den neu entstandenen Vulkaninseln
zählen? Und sind nicht die niedrigen Koralleninseln der Südsee
nach Darzviiis Untersuchungen nicht vielmehr Reste früheren Festlandes
, ohne dass Spuren einer eigenthümlichen Vegetation auf denselben
übrig blieben? Noch verwickelter aber wird das Problem durch
die Thatsache, dass im indischen Archipel die Vertheilung der endemischen
Thiere und Pflanzen verschiedenen geographischen Normen
unterworfen ist, w,ovon wir weiter unten zu berichten haben.
A r k t i s c h e Flora. •— Durch Heeres Untersuchungen über die
Tertiärflora der arktischen Zone, in deren damaligen Wäldern er gegen
78 Baumformen nachweist, ist eins der dunkelsten Probleme entstanden,
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 373
in welchem Geologie und Geobotanik sich berühren (Die Polarländer
und Flora fossilis arctica, 1868). Die Braunkohlen aus den verschiedensten
Meridianen zwischen dem Mackenzie in Nordamerika und Spitzbergen,
von Banksland und Grönland haben ergeben, dass jene Wälder
sich über einen grossen Theil des gegenwärtig baumlosen Gebietes erstreckten,
eine Linde sogar noch an der Kingsbai auf Spitzbergen (78°
N. Br.) gedeihen konnte. Das Baumgebiet als solches ist an eine längere
Dauer der Entwicklungszeit und an höhere Wärmegrade gebunden, als
sie das heutige arktische Klima gewährt, und dieses ist eine Folg^ kosmischer
Bedingungen, eine Wirkung vom Stande der Sonne gegen die
Erdkugel. Dazu kommt, dass nicht bloss die Formen und Gattungen
dieser Bäume der Tertiärzeit grösstentheils mit denen Nordamerikas
identisch sind, sondern auch einige nicht einmal der Art nach von ihnen
sicher unterschieden werden können, namentlich soll dies von Sequoia
sempervirens und Taxodium distichum gelten. Hier hat also entschieden
eine wesentliche Änderung des Klimas stattgefunden, die nach
Hecr's Vergleichung des grönländischen Tertiärwaldes (70° N. Br.) mit
den heutigen Wäldern am Genfer See einem Breitenunterschiede von
wenigstens 23°, bei den Linden von 15^ entsprechen würde. Man pflegt
Erscheinungen dieser Art von der fortschreitenden Ausstrahlung der
eigenen Erdwärme und von der Erweiterung des Festlandes abzuleiten.
Zur Zeit, als die arktischen Tertiärwälder bestanden, hatten die Polarländer
schon wesentlich denselben Umriss wie gegenwärtig, da die
Überreste sich an so verschiedenen und entlegenen Orten gefunden
haben. Es bliebe also in diesem Falle die Annahme einer höheren
Eigenwärme der Erde übrig und damit steht in Einklang, dass auch
aus älteren Perioden Grönland vegetabilische Überreste geliefert hat,
die mit denen der Kreide Deutschlands auffallend übereinstimmen, und
dass erst kürzlich wieder von den schwedischen Naturforschern auf der
Bäreninsel zahlreiche Pflanzenabdrücke entdeckt wurden, welche der
alten Steinkohlenflora angehören [Petennamis „Geogr. Mittheil." 1868,
S. 431)' Heer hat indessen jene übhche Erklärungsweise bestritten,
aber seine Widerlegung vielleicht nicht genügend begründet, wenn er
sagt, dass in diesem Falle den früheren Perioden vor der Tertiärzeit
eine so hohe Temperatur zuzuschreiben sei, dass kein organisches Leben
möglich gewesen wäre, denn wir kennen weder die Länge der Zeiträume
noch den Gang der Abnahme der Eigenwärme. Er sucht die
Erscheinung aus ungleichmässigen Temperaturen des Weltraumes abzuleiten,
ebenso gut hätte er eine Abnahme der erwärmenden Kraft der
Sonne annehmen können. Saporta erblickt in der abnehmenden Schiefe
der Ekliptik den Grund von der Abkühlung der Polarländer (Annales
I
m
I I
t'Al'S
iEl'l
Hl!'
Ii:
H\ ij;-
ii'infii'j
H'.
i
rill