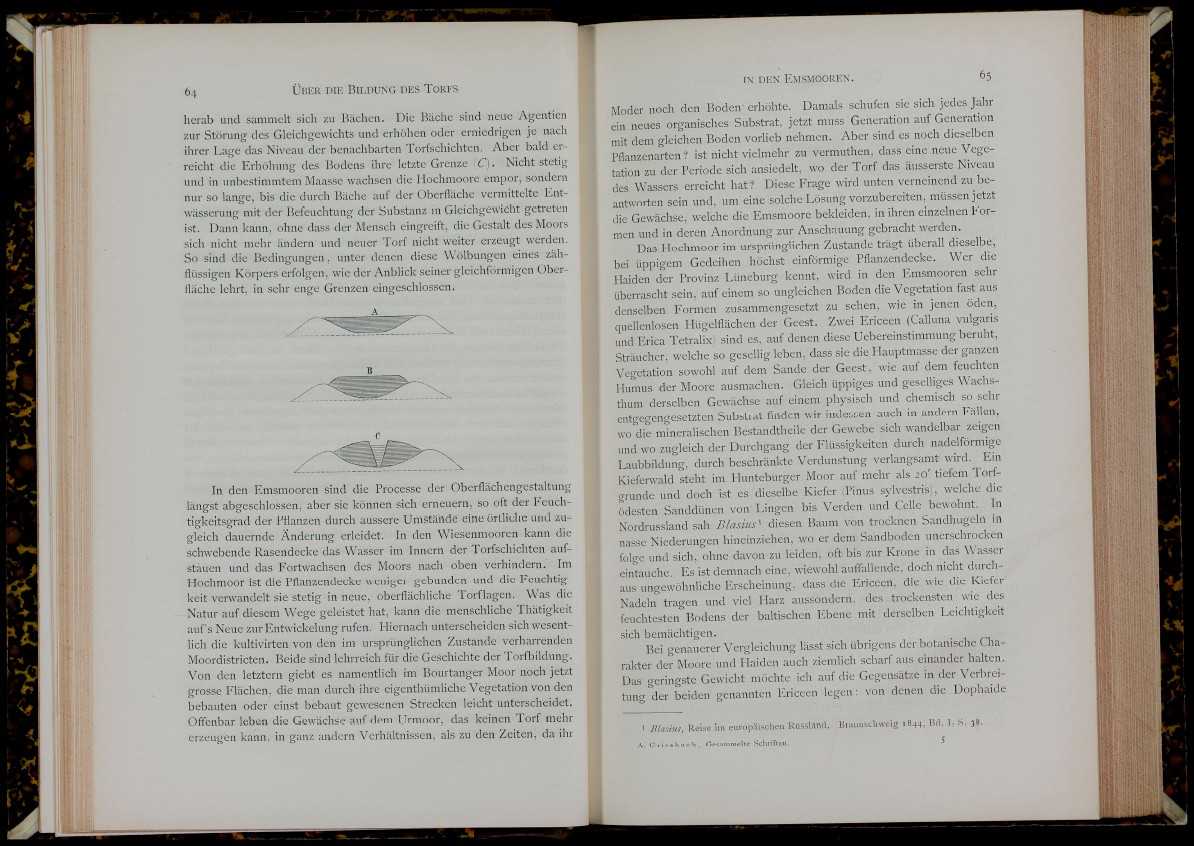
•figjP'i'V"" 'I'jW^-'
• iihi; ,1
64 ÜBER DIE BILDUNG DES TORFS
herab und sammelt sich zu Bächen. Die Bäche sind neue Agentien
zur Störung- des Gleichgewichts und erhöhen oder erniedrigen je nach
ihrer Lage das Niveau der benachbarten Torfschichten. Aber bald erreicht
die Erhöhung des Bodens ihre letzte Grenze iC]. Nicht stetig
und in unbestimmtem Maasse wachsen die Hochmoore empor, sondern
nur so lange, bis die durch Bäche auf der Oberfläche vermittelte Entwässerung
mit der Befeuchtung der Substanz in Gleichgewicht getreten
ist. Dann kann, ohne dass der Mensch eingreift, die Gestalt des Moors
sich nicht mehr ändern und neuer Torf nicht weiter erzeugt werden.
So sind die Bedingungen, unter denen diese Wölbungen eines zähflüssigen
Körpers erfolgen, wie der Anblick seiner gleichförmigen Oberfläche
lehrt, in sehr enge Grenzen eingeschlossen.
In den Emsmooren sind die Processe der Oberflächengestaltung
längst abgeschlossen, aber sie können sich erneuern, so oft der Feuchtigkeitsgrad
der Pflanzen durch äussere Umstände eine örtliche und zugleich
dauernde Änderung erleidet. In den Wiesenmooren kann die
schwebende Rasendecke das Wasser im Innern der Torfschichten aufstauen
und das Fortwachsen des Moors nach oben verhindern.' Im
Hochmoor ist die Pflanzendecke weniger gebunden und die Feuchtigkeit
verwandelt sie stetig in neue, oberflächliche Torflagen. Was die
Natur auf diesem Wege geleistet hat, kann die menschliche Thätigkeit
auf's Neue zur Entwickelung rufen. Hiernach unterscheiden sich wesentlich
die kultivirten von den im ursprünglichen Zustande verharrenden
Moordistricten. Beide sind lehrreich für die Geschichte der Torfbildung.
Von den letztern giebt es namentlich im Bourtanger Moor noch jetzt
grosse Flächen, die man durch ihre eigenthümhche Vegetation von den
bebauten oder einst bebaut gewesenen Strecken leicht unterscheidet.
Offenbar leben die Gewächse auf dem Urmoor, das keinen Torf mehr
erzeugen kann, in ganz andern Verhältnissen, als zu den Zeiten, da ihr
IN DEN EMSMOOREN.
Moder noch den Boden" erhöhte. Damals schufen sie sich jedes Jahr
ein neues organisches Substrat, jetzt muss Generation auf Generation
f '1 mit dem gleichen Boden vorlieb nehmen. Aber sind es noch dieselben
Pflanzenarten? ist nicht vielmehr zu vermuthen, dass eine neue Vegetation
zu der Periode sich ansiedelt, wo der Torf das äusserste Niveau
des Wassers erreicht hat? Diese Frage wird unten verneinend zu beantworten
sein und, um eine s o l c h e Lösung vorzubereiten, müssen jetzt
die Gewächse, welche die Emsmoore bekleiden, in ihren einzelnen Formen
und in deren Anordnung zur Anschauung gebracht werden.
Das Hochmoor im ursprünglichen Zustande trägt überall dieselbe,
bei üppigem Gedeihen höchst einförmige Pflanzendecke. Wer die
Haiden der Provinz Lüneburg kennt, wird in den Emsmooren sehr
überrascht sein, auf einem so ungleichen Boden die Vegetation fast aus
denselben Formen zusammengesetzt zu sehen, wie in jenen oden,
quellenlosen Hügelflächen der Geest. Zwei Ericeen (CaUuna vulgaris
und Erica Tetralix) sind es, auf denen diese Uebereinstimmung beruht.
Sträucher, welche so gesellig leben, dass sie die Hauptmasse der ganzen
Vegetation sowohl auf dem Sande der Geest, wie auf dem feuchten
Humus der Moore ausmachen. Gleich üppiges und geseUiges Wachsthum
derselben Gewächse auf einem physisch und chemisch so sehr
entgegengesetzten Substrat finden wir indessen auch in andern Fallen,
wo die mineralischen Bestandtheile der Gewebe sich wandelbar zeigen
und wo zugleich der Durchgang der Flüssigkeiten durch nadelformige
Laubbildung, durch beschränkte Verdunstung verlangsamt wird. Em
Kieferwald steht im Hunteburger Moor auf mehr als 20' tiefem Torfarunde
und doch ist es dieselbe Kiefer (Pinus sylvestris), welche die
ödesten Sanddünen von Lingen bis Verden und Celle bewohnt. In
Nordrussland sah Blasius' diesen Baum von trocknen Sandhugeln in
nasse Niederungen hineinziehen, wo er dem Sandboden unerschrocken
fol-e und sich, ohne davon zu leiden, oft bis zur Krone in das Wasser
eintauche. Es ist demnach eine, wiewohl aufl-allende, doch nicht durchaus
ungewöhnliche Erscheinung, dass die Ericeen, die wie die Kiefer
Nadeln tragen und viel Harz aussondern, des trockensten wie des
feuchtesten Bodens der baltischen Ebene mit derselben Leichtigkeit
sich bemächtigen. .
Bei genauerer Vergleichung lässt sich übrigens der botanische Charakter
der Moore und Haiden auch ziemlich scharf aus einander halten.
Das geringste Gewicht möchte ich auf die Gegensätze in der Verbreitung
der beiden genannten Ericeen legen: von denen die Dophaide
lopäischen Russlancl. Braunschweig 1844, Bd. I, S. 38-
1 Blasius, Reise im euro
A. G r i s e b a c h , Gesammelte Schriften.
r
rch 4 ni
•
'{•II
Ir
.V /I!
• I
r
t