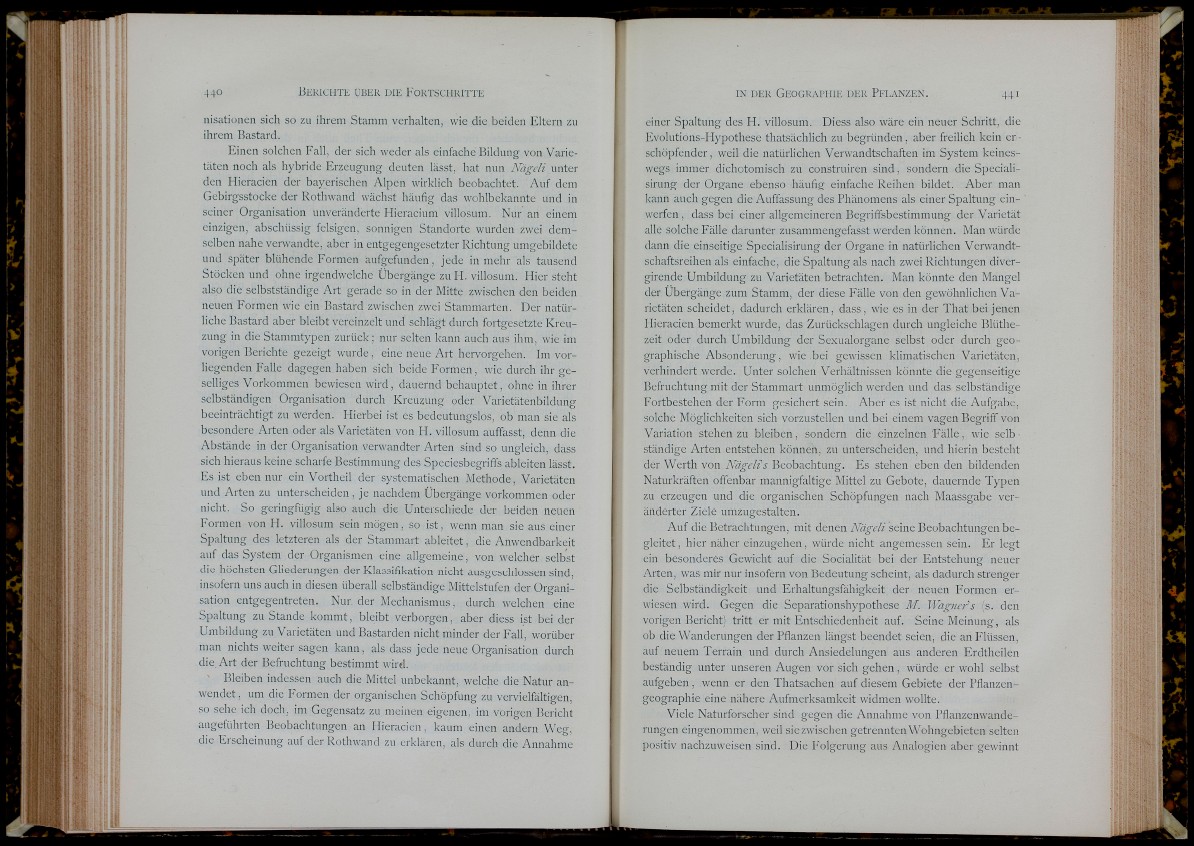
y * í
mm
; i í V . :
iñt
' !
' ir-i' - ' ' t .
< . 1: ip, MÉI
'XM..
. . t j r .
íl!
liifíiiái
f^ifii^li L'^il f i
' " l i l i
4 4 0 iiKRiCHTK ÜBER DIE FORTSCHRITTE
nisationen sich so zu ihrem Stamm verhaltenj wie die beiden Eltern zu
ihrem Bastard.
Einen solchen Fall, der sich weder als einfache Bildung von Varietäten
noch als hybride Erzeugamg deuten lässt^ hat nun Nägcli unter
den Hieracien der bayerischen Alpen wirldich beobachtet. Auf dem
Gebirgsstocke der Rothwand wächst häufig das wohlbekannte und in
seiner Organisation unveränderte Hieracium villosum. Nur an einem
einzigen, abschüssig felsigen, sonnigen Standorte wurden zwei demselben
nahe verwandte, aber in entgegengesetzter Richtung umgebildete
und später blühende Formen aufgefunden, jede in mehr als tausend
Stöcken und ohne irgendwelche Übergänge zu H. villosum. Hier steht
also die selbstständige Art gerade so in der Mitte zwischen den beiden
neuen Formen wie ein Bastard zwischen zwei Stammarten. Der natürliche
Bastard aber bleibt vereinzelt und schlägt durch fortgesetzte Kreuzung
in die Stammtypen zurück; nur selten kann auch aus ihm, wie im
vorigen Berichte gezeigt wurde , eine neue Art hervorgehen. Im vorliegenden
Falle dagegen haben sich beide Formen, wie durch ihr geselliges
Vorkommen bewiesen wird, dauernd behauptet, ohne in ihrer
selbständigen Organisation durch Kreuzung oder Varietätenbildung
beeinträchtigt zu werden. Hierbei ist es bedeutungslos, ob man sie als
besondere Arten oder als Varietäten von H. villosum auffasst, denn die
Abstände in der Organisation verwandter Arten sind so ungleich, dass
sich hieraus keine scharfe Bestimmung des Speciesbegriffs ableiten lässt.
Es ist eben nur ein Vortheil der systematischen Methode, Varietäten
und Arten zu unterscheiden, je nachdem Übergänge vorkommen oder
nicht. So geringfügig also auch die Unterschiede der beiden neuen
Formen von H. villosum sein mögen, so ist, wenn man sie aus einer
Spaltung des letzteren als der Stammart ableitet, die Anwendbarkeit
auf das Sys tem der Organismen eine allgemeine, von welcher selbst
die höchsten Gliederungen der Klassifikation nicht ausgeschlossen sind,
insofern uns auch in diesen überall selbständige Mittelstufen der Organisation
entgegentreten. Nur der Mechanismus, durch welchen eine
Spaltung zu Stande kommt , bleibt verborgen, aber diess ist bei der
Umbildung zu Varietäten und Bastarden nicht minder der Fall, worüber
man nichts weiter sagen kann, als dass jede neue Organisation durch
die. Art der Befruchtung bestimmt wird.
Bleiben indessen auch die Mittel unbekannt, welche die Natur anwendet
, um die P ormen der organischen Schöpfung zu vervielfältio'en
so sehe ich doch, im Gegensatz zu meinen eigenen, im vorigen Bericht
angeführten Beobachtungen an Hieracien, kaum einen andern Weg,
die Erscheinung auf der Rothwand zu erklären, als durch die Annahme
IN DER GEOGRAPI-IIE DER PFLANZEN. 441
einer Spaltung des H. villosum. Diess also wäre ein neuer Schritt, die
Evolutions-Hypothese thatsächhch zu begründen, aber freihch kein erschöpfender
, weil die natürlichen Verwandtschaften im Sys tem keineswegs
immer dichotomisch zu construiren sind, sondern die Specialisirung
der Organe ebenso häufig einfache Reihen bildet. Aber man
kann auch gegen die Auffassung des Phänomens als einer Spaltung einwerfen
, dass bei einer allgemeineren Begriffsbestimmung der Varietät
alle solche Fälle darunter zusammengefasst werden können. Man würde
dann die einseitige Speciahsirung der Organe in natürlichen Verwandtschaftsreihen
als einfache, die Spaltung als nach zwei Richtungen divergirende
Umbildung zu Varietäten betrachten. Man könnte den Mangel
der Übergänge zum Stamm, der diese Fälle von den gewöhnlichen Va -
rietäten scheidet, dadurch erklären, da s s , wie es in der That bei jenen
Hieracien bemerkt wurde, das Zurückschlagen durch ungleiche Blüthezeit
oder durch Umbildung der Sexualorgane selbst oder durch geographische
Absonderung, wie .bei gewissen klimatischen Varietäten,
verhindert werde. Unter solchen Verhältnissen könnte die gegenseitige
Befruchtung mit der Stammart unmögUch werden und das selbständige
P^ortbestehen der Form gesichert sein. Aber es ist nicht die Aufgabe,
solche Möghchkeiten sich vorzustellen und bei einem vagen Begriff von
Variation stehen zu bleiben, sondern die einzelnen 'Fälle, wie selbständige
Arten entstehen können, zu unterscheiden, und hierin besteht
der Werth von Nägelis Beobachtung. Es stehen eben den bildenden
Naturkräften offenbar mannigfaltige Mittel zu Gebote, dauernde Typen
zu erzeugen und die organischen Schöpfungen nach Maas sgabe veränderter
Ziele umzugestalten.
Auf die Betrachtungen, mit denen Nägeli seine Beobachtungen begleitet,
hier näher einzugehen, würde nicht angemessen sein. Er legt
ein besonderes Gewicht auf die Socialität bei der Entstehung neuer
Arten, was mir nur insofern von Bedeutung scheint, als dadurch strenger
die Selbständigkeit und Erhaltungsfähigkeit der neuen Formen erwiesen
wird. Gegen die Separationshypothese M. Wagncr^s (s. den
vorigen Bericht) tritt er mit Entschiedenheit auf. Seine Meinung, als
ob die Wanderungen der Pflanzen längst beendet seien, die an Flüssen,
auf neuem Terrain und durch Ansiedelungen aus anderen Erdtheilen
beständig unter unseren Augen vor sich gehen, würde er wohl selbst
aufgeben, wenn er den Thatsachen auf diesem Gebiete der Pflanzengeographie
eine nähere Aufmerksamkeit widmen wollte.
Viele Naturforscher sind gegen die Annahme von Pflanzenwanderungen
eingenommen, weil siezwischen getrennten Wohngebieten selten
positiv nachzuweisen sind. Die Folgerung aus Analogien aber gewinnt
ifi
i l l
1' in
«III
ÉIÍ
srütit
iii
I i
i f
Ii liV.
fl«S»J'iEiüIÜiiíIfPlíl!i f
í t i í 'n, <1
i
•Hn a i f
J l
^ i
u (I f : . S ! f
H/t
II
tlSli