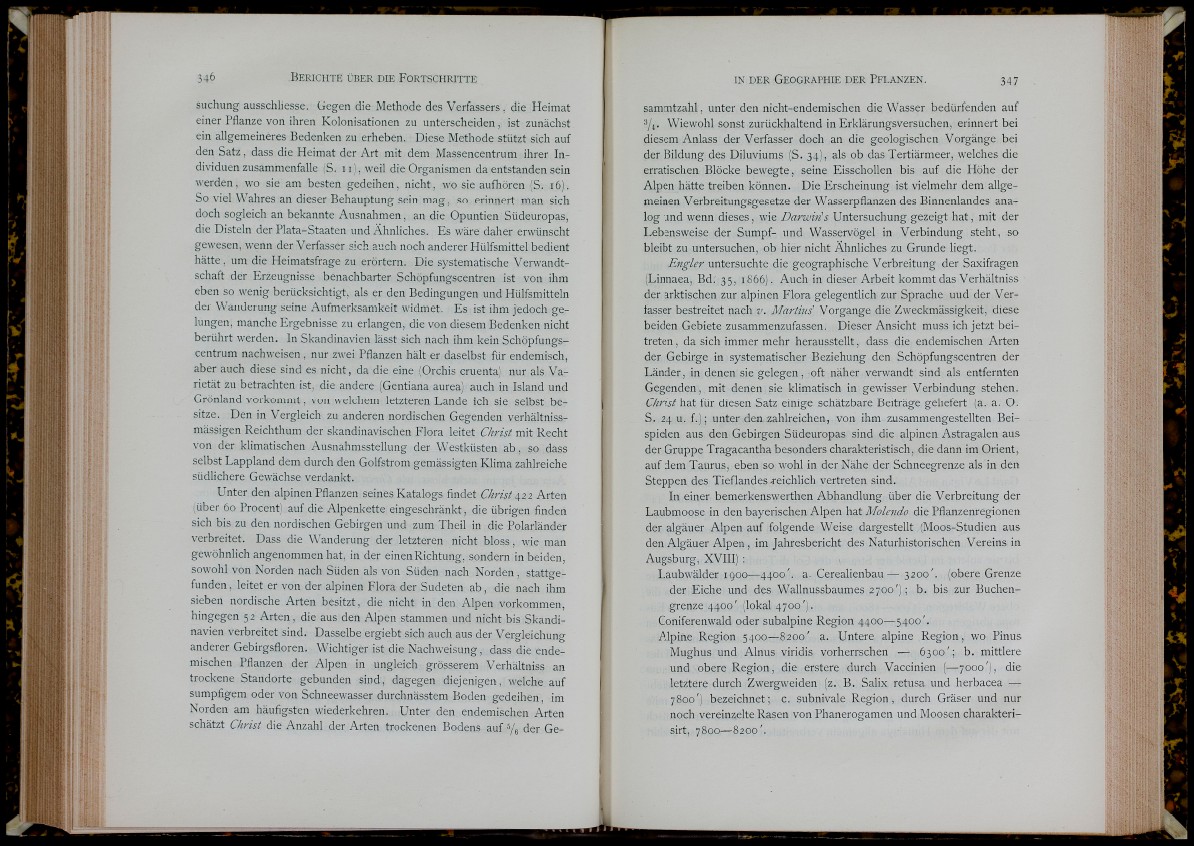
rm *
i n 3
L. Im
iH-'r
i'.
akmi i
H:
BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
suchung ausschliesse. Gegen die Methode des Verfassers, die Heimat
einer Pflanze von ihren Kolonisationen zu unterscheiden, ist zunächst
ein allgemeineres Bedenken zu erheben. Diese Methode stützt sich auf
den Satz, dass die Heimat der Art mit dem Massencentrum ihrer Individuen
zusammenfalle (S. II), weil die Organismen da entstanden sein
werden, wo sie am besten gedeihen, nicht, wo sie aufhören (S. i6).
So viel Wahres an dieser Behauptung sein mag, so erinnert man sich
doch sogleich an bekannte Ausnahmen, an die Opuntien Südeuropas,
die Disteln der Plata-Staaten und Ähnliches. Es wäre daher erwünscht
gewesen, wenn der Verfasser sich auch noch anderer Hülfsmittel bedient
hätte, um die Heimatsfrage zu erörtern. Die systematische Verwandtschaft
der Erzeugnisse benachbarter Schöpfungscentren ist von ihm
eben so wenig berücksichtigt, als er den Bedingungen und Hülfsmitteln
der Wanderung seine Aufmerksamkeit widmet. Es . ist ihm jedoch gelungen,
manche Ergebnisse zu erlangen, die von diesem Bedenken nicht
berührt werden. In Skandinavien lässt sich nach ihm kein Schöpfungscentrum
nachweisen , nur zwei Pflanzen hält er daselbst für endemisch,
aber auch diese sind es nicht, da die eine (Orchis cruenta) nur als Varietät
zu betrachten ist, die andere (Gentiana aurea) auch in Island und
Grönland vorkommt, von welchem letzteren Lande ich sie selbst besitze.
Den in Vergleich zu anderen nordischen Gegenden verhältnissmässigen
Reichthum der skandinavischen Flora leitet Ch'-zst mit Recht
von der klimatischen Ausnahmsstellung der Westküsten ab, so dass
selbst Lappland dem durch den Golfstrom gemässigten Klima zahlreiche
südlichere Gewächse verdankt.
Unter den alpinen Pflanzen seines Katalogs findet Christ 2 Arten
;über 60 Procent) auf die Alpenkette eingeschränkt, die übrigen finden
sich bis zu den nordischen Gebirgen und zum Theil in die Polarländer
verbreitet. Dass die Wanderung der letzteren nicht bloss, wie man
gewöhnlich angenommen hat, in der einen Richtung, sondern in beiden,
sowohl von Norden nach Süden als von Süden nach Norden, stattgefunden,
leitet er von der alpinen Flora der Sudeten ab, die nach ihm
sieben nordische Arten besitzt, die nicht in den Alpen vorkommen,
hingegen 52 Arten, die aus den Alpen stammen und nicht bis Skandinavien
verbreitet sind. Dasselbe ergiebt sich auch aus der Vergleichung
anderer Gebirgsfloren. Wichtiger ist die Nachweisung, dass die endemischen
Pflanzen der Alpen in ungleich grösserem Verhältniss an
trockene Standorte gebunden sind, dagegen diejenigen, welche auf
sumpfigem oder von Schneewasser durchnässtem Boden gedeihen, im
Norden am häufigsten wiederkehren. Unter den endemischen Arten
schätzt Christ die Anzahl der Arten trockenen Bodens auf Yg der Gef
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN.
sammtzahl, unter den nicht-endemischen die Wasser bedürfenden auf
3/4. Wiewohl sonst zurückhaltend in Erklärungsversuchen, erinnert bei
diesem Anlass der Verfasser doch an die geologischen Vorgänge bei
der Bildung des Diluviums (S. 34), als ob das Tertiärmeer, welches die
erratischen Blöcke bewegte, seine Eisschollen bis auf die Höhe der
Alpen hätte treiben können. Die Erscheinung ist vielmehr dem allgemeinen
Verbreitungsgesetze der Wasserpflanzen des Binnenlandes analog
und wenn dieses, wie Darwiris Untersuchung gezeigt hat, mit der
Lebensweise der Sumpf- und Wasservögel in Verbindung steht, so
bleibt zu untersuchen, ob hier nicht Ähnliches zu Grunde liegt.
Engler untersuchte die geographische Verbreitung der Saxifragen
(Linnaea, Bd. 35, 1866). Auch in dieser Arbeit kommt das Verhältniss
der arktischen zur alpinen Flora gelegentlich zur Sprache uud der Verfasser
bestreitet nach v. Martius' Vorgange die Zweckmässigkeit, diese
beiden Gebiete zusammenzufassen. Dieser Ansicht muss ich jetzt beitreten,
da sich immer mehr herausstellt, dass die endemischen Arten
der Gebirge in systematischer Beziehung den Schöpfungscentren der
Länder, in denen sie gelegen, oft näher verwandt sind als entfernten
Gegenden, mit denen sie klimatisch in gewisser Verbindung stehen.
(T/^m/hat für diesen Satz einige schätzbare Beiträge geliefert (a. a. O.
S. 24 u. f.); unter den zahlreichen, von ihm zusammengestellten Beispielen
aus den Gebirgen Südeuropas sind die alpinen Astragalen aus
der Gruppe Tragacantha besonders charakteristisch, die dann im Orient^
auf dem Taurus, eben so wohl in der Nähe der Schneegrenze als in den
Steppen des Tieflandes reichlich vertreten sind.
In einer, bemerkenswerthen Abhandlung über die Verbreitung der
Laubmoose in den bayerischen Alpen ^i-dX. Molendo die Pflanzenregionen
der algäuer Alpen auf folgende Weise dargestellt (Moos-Studien aus
den Algäuer Alpen, im Jahresbericht des Naturhistorischen Vereins in
Augsburg, XVIII) :
Laubwälder. 1900—4400'. a. Cerealienbau— 3200'. (obere Grenze
der Eiche und des Wallnussbaumes 2700'); b. bis zur Buchengrenze
4400' (lokal 4700').
Coniferenwald oder subalpine Region 4400—5400'.
Alpine Region ^5400—8200' a. Untere alpine Region, wo Pinus
Mughus und Alnus viridis vorherrschen — 6300'; b. mittlere
und obere Region, die erstere durch Vaccinien (—7000'), die
letztere durch Zwergweiden (z. B. Salix retusa und herbacea —
7800') bezeichnet; c. subnivale Region, durch Gräser und nur
noch vereinzelte Rasen von Phanerogamen und Moosen charakterisirt,
7800—8200'.
? II '}IT
IS.
l i i i
( i
• isißlt LISI
tSiii i^lilf
lit;;:
. i I"'
i i i
(l!
11•1"3
r ii
phk
^ I' Ii