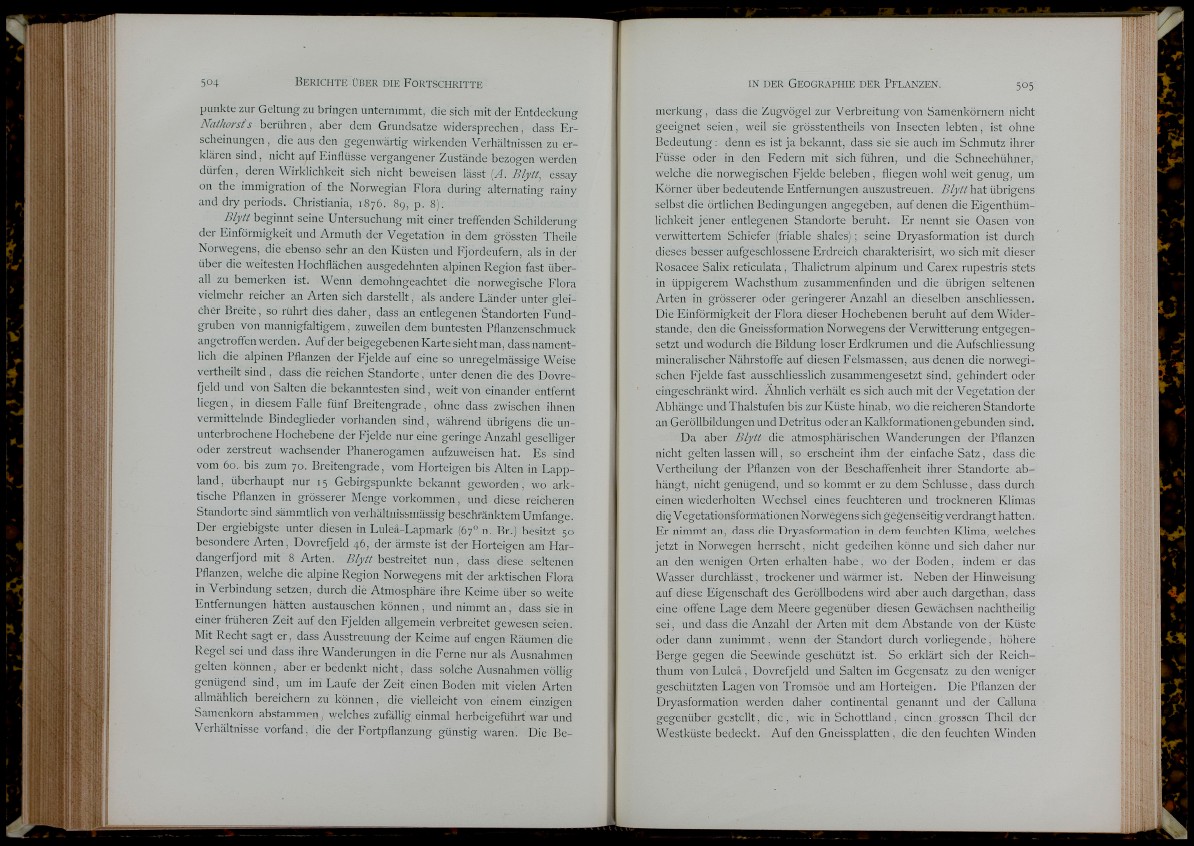
504 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
punkte zur Geltung zu bringen unternimmt, die sich mit der Entdeckung
Nathorsis berühren, aber dem Grundsatze widersprechen, dass Erscheinungen
, die aus den gegenwärtig wirkenden Verhcältnissen zu erklären
sind , nicht auf Einflüsse vergangener Zustände bezogen werden
dürfen, deren Wirklichkeit sich nicht beweisen lässt (A, Blytt^ essay
on the immigration of the Norwegian Flora during alternating rainy
emd dry periods. Christiania, 1876. 89, p. 8).
Blytt beginnt seine Untersuchung mit einer treffenden Schilderung
der Einförmigkeit und Armuth der Vegetation in dem grössten Theile
Norwegens, die ebenso sehr an den Küsten und Fjordeufern, als in der
über die weitesten Hochflächen ausgedehnten alpinen Region fast überall
zu bemerken ist. Wenn demohngeachtet die norwegische Flora
vielmehr reicher an Arten sich darstellt, als andere Länder unter gleicher
Breite, so rührt dies daher, dass an entlegenen Standorten Fundgruben
von mannigfaltigem, zuweilen dem buntesten Pflanzenschmuck
angetrofl'en werden. Auf der beigegebenen Karte sieht man, dass namentlich
die alpinen Pflanzen der Fjelde auf eine so unregelmässige Weise
vertheilt sind , dass die reichen Standorte, unter denen die des Dovrefjeld
und von Saiten die bekanntesten sind, weit von einander entfernt
liegen, in diesem Falle ftinf Breitengrade, ohne dass zwischen ihnen
vermittelnde Bindeglieder vorhanden sind, während übrigens die ununterbrochene
Hochebene der Fjelde nur eine geringe Anzahl geselliger
oder zerstreut wachsender Phanerogamen aufzuweisen hat. Es sind
vom 60. bis zum 70. Breitengrade, vom Horteigen bis Alten in Lappland,
überhaupt nur 15 Gebirgspunkte bekannt geworden, wo arktische
Pflanzen in grösserer Menge vorkommen, und diese reicheren
Standorte sind sämmtlich von verhältnissmässig beschränktem Umfange.
Der ergiebigste unter diesen in Luleä-Lapmark (67" n. Br.) besitzt'so
besondere Arten, Dovrefjeld 46, der ärmste ist der Horteigen am Hardangerfjord
mit 8 Arten. bestreitet nun, dass diese seltenen
Pflanzen, welche die alpine Region Norwegens mit der arktischen Flora
in Verbindung setzen, durch die Atmosphäre ihre Keime über so weite
Entfernungen hätten austauschen können, und nimmt an, dass sie in
einer früheren Zeit auf den Fjelden allgemein verbreitet gewesen seien.
Mit Recht sagt er, dass Ausstreuung der Keime auf engen Räumen die
Regel sei und dass ihre Wanderungen in die Ferne nur als Ausnahmen
gelten können, aber er bedenkt nicht, dass solche Ausnahmen völlig
genügend sind, um im Laufe der Zeit einen Boden mit vielen Arten
allmähhch bereichern zu können, die vielleicht von einem einzigen
Samenkorn abstammen, welches zufäUig einmal herbeigeführt war und
Verhältnisse vorfand, die der Fortpflanzung günstig waren. Die Be-
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 505
merkung, dass die Zugvögel zur Verbreitung von Samenkörnern nicht
geeignet seien, weil sie grösstentheils von Insecten lebten, ist ohne
Bedeutung: denn es ist ja bekannt, dass sie sie auch im Schmutz ihrer
Füsse oder in den Federn mit sich führen, und die Schneehühner,
welche die norwegischen Fjelde beleben, fliegen wohl weit genug, um
Körner über bedeutende Entfernungen auszustreuen. Blytth.'d.t übrigens
selbst die örtlichen Bedingungen angegeben, auf denen die Eigenthüm-
Uchkeit jener entlegenen Standorte beruht. Er nennt sie Oasen von
verwittertem Schiefer (friable shales) ; seine Dryasformation ist durch
dieses besser aufgeschlossene Erdreich charakterisirt, wo sich mit dieser
Rosacee Salix reticulata, Thalictrum alpinum und Carex rupestris stets
in üppigerem Wachsthum zusammenfinden und die übrigen seltenen
Arten in grösserer oder geringerer Anzahl an dieselben anschUessen.
Die Einförmigkeit der Flora dieser Hochebenen beruht auf dem Widerstande,
den die Gneissformation Norwegens der Verwitterung entgegensetzt
und wodurch die Bildung loser Erdkrumen und die Aufschliessung
mineralischer Nährstoffe auf diesen Felsmassen, aus denen die norwegischen
Fjelde fast ausschliesslich zusammengesetzt sind, gehindert oder
eingeschränkt wird. Ahnlich verhält es sich auch mit der Vegetation der
Abhänge und Thalstufen bis zur Küste hinab, wo die reicheren Standorte
an Geröllbildungen und Detritus oder an Kalkformationen gebunden sind.
Da aber Blytt die atmosphärischen Wanderungen der Pflanzen
nicht gelten lassen will, so erscheint ihm der einfache Satz, dass die
Vertheilung der Pflanzen von der Beschaffenheit ihrer Standorte abhängt,
nicht genügend, und so kommt er zu dem Schlüsse, dass durch
einen wiederholten Wechsel eines feuchteren und trockneren Klimas
die Vegetationsformationen Norwegens sich gegenseitig verdrängt hätten.
Er nimmt an, dass die Dryasformation in dem feuchten Klima, welches
jetzt in Norwegen herrscht, nicht gedeihen könne und sich daher nur
an den wenigen Orten erhalten habe, wo der Boden, indem er das
Wasser durchlässt, trockener und wärmer ist. Neben der Hinweisung
auf diese Eigenschaft des Geröllbodens wird aber auch dargethan, dass
eine offene Lage dem Meere gegenüber diesen Gewächsen nachtheilig
sei, und dass die Anzahl der Arten mit dem Abstände von der Küste
oder dann zunimmt ^ wenn der Standort durch vorliegende, höhere
Berge gegen die Seewinde geschützt ist. So erklärt sich der Reichthum
vonLuleä, Dovrefjeld und Saiten im Gegensatz zu den weniger
geschützten Lagen von Tromsöe und am Horteigen. Die Pflanzen der
Dryasformation werden daher continental genannt und der Calluna
gegenüber gestellt, die, wie in Schottland, einen grossen Theil der
Westküste bedeckt. Auf den Gneissplatten , die den feuchten Winden
4
ifM
Iii'
jifliIü'M :
Wv,
Ifti