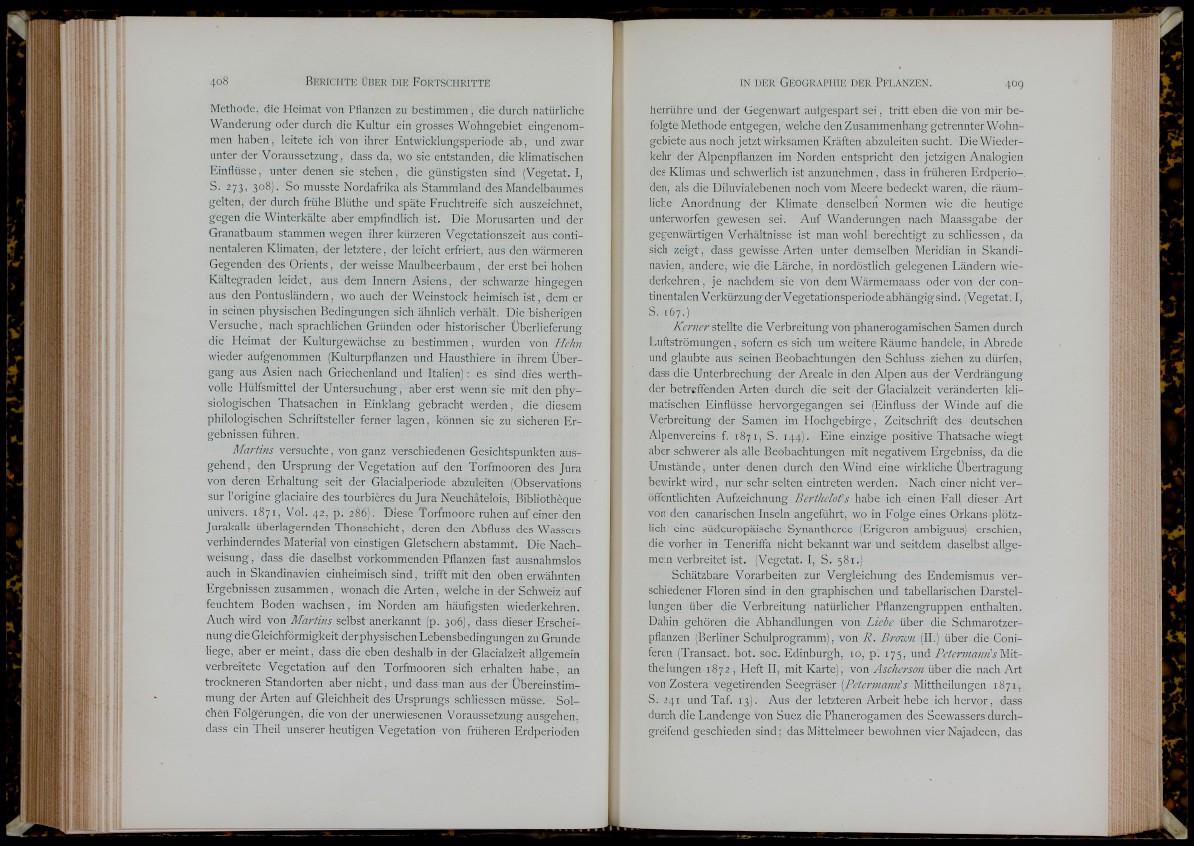
1-i.l-ü =
TîiTi-^irrn-
'IL I
Hî
i i i r ?
I
jtk ^ i
I
vr-v.
i i ^ -
•it :
r
1
h
408 BERICHTE ÜBER DIE FORTSCHRITTE
Methode, die Heimat von Pflanzen zu bestimmen^ die durch natürliche
Wanderung oder durch die Kultur ein grosses Wohngebiet eingenommen
haben, leitete ich von ihrer Entwicklungsperiode ab, und zwar
unter der Voraussetzung, dass da, wo sie entstanden, die klimatischen
Einflüsse, unter denen sie stehen, die günstigsten sind (Vegetat. I,
S. 273, 308). So musste Nordafrika als Stammland des Mandelbaumes
gelten, der durch frühe Blüthe und späte Fruchtrerfe sich auszeichnet,
gegen die Winterkälte aber empfindlich ist. Die Morusarten und der
Granatbaum stammen wegen ihrer kürzeren Vegetationszeit aus continentaleren
Klimaten, der letztere, der leicht erfriert, aus den wärmeren
Gegenden des Orients, der weisse Maulbeerbaum , der erst bei hohen
Kältegraden leidet, aus dem Innern Asiens, der schwarze hingegen
aus den Pontusländern, wo auch der Weinstock heimisch ist, dem er
in seinen physischen Bedingungen sich ähnlich verhält. Die bisherigen
Versuche, nach sprachlichen Gründen oder historischer Überiieferung
die Heimat der Kulturgewächse zu bestimmen, wurden von Hehn
wieder aufgenommen (Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Übergang
aus Asien nach Griechenland und Itahen) : es sind dies werthvolle
Hülfsmittel der Untersuchung, aber erst wenn sie mit den physiologischen
Thatsachen in Einklang gebracht werden, die diesem
philologischen Schriftsteller ferner lagen, können sie zu sicheren Ergebnissen
führen.
Martins versuchte, von ganz verschiedenen Gesichtspunkten ausgehend
, den Ursprung der Vegetation auf den Torfmooren des Jura
von deren Erhaltung seit der Glacialperiode abzuleiten (Observations
sur l'origine glaciaire des tourbières du Jura Neuchâtelois, Bibliothèque
univers. 1871, Vol. 42, p. 286). Diese Torfmoore ruhen auf einer den
/urakalk überlagernden Thonschicht, deren den Abfluss des Wassers
verhinderndes Material von einstigen Gletschern abstammt. Die Nachweisung,
dass die daselbst vorkommenden Pflanzen fast ausnahmslos
auch in Skandinavien einheimisch sind, trifft mit den obenerwähnten
Ergebnissen zusammen, wonach die Arten, welche in der Schweiz auf
feuchtem Boden wachsen, im Norden am häufigsten wiederkehren.
Auch wird von Martins selbst anerkannt (p. 306), dass dieser Erscheinung
die Gleichförmigkeit derphysischen Lebensbedingungen zu Grunde
liege, aber er meint, dass die eben deshalb in der Glacialzeit allgemein
verbreitete Vegetation auf den Torfmooren sich erhalten habe, an
trockneren Standorten aber nicht, und dass man aus der Übereinstimmung
der Arten auf Gleichheit des Ursprungs schliessen müsse. Solchen
Folgerungen, die von der unerwiesenen Voraussetzung ausgehen,
dass ein Theil unserer heutigen Vegetation von früheren Erdperioden
IN DER GEOGRAPHIE DER PFLANZEN. 409
herrühre und der Gegenwart aufgespart sei, tritt eben die von mir befolgte
Methode entgegen, welche den Zusammenhang getrennter Wohngebiete
aus noch jetzt wirksamen Kräften abzuleiten sucht. Die Wiederkehr
der Alpenpflanzen im Norden entspricht den, jetzigen Analogien
des Klimas und schwerlich ist anzunehmen, dass in früheren Erdperioden,
als die Diluvialebenen noch vom Meere bedeckt waren, die räumliche
Anordnung der Khmate denselben Normen wie die heutige
untei-worfen gewesen sei. Auf Wanderungen nach Maassgabe der
gegenwärtigen Verhältnisse ist man wohl berechtigt zu schliessen, da
sich zeigt, dass gewisse Arten unter demselben Meridian in Skandinavien,
andere, wie die Lärche, in nordöstlich gelegenen Ländern wiederkehren
, je nachdem sie von dem Wärmemaass oder von der continentalen
Verkürzung der Vegetationsperiode abhängig sind. (Vegetat. I,
S. 167.)
/i'm^é'r stellte die Verbreitung von phanerogamischen Samen durch
Luftströmungen, sofern es sich um weitere Räume handele, in Abrede
und glaubte aus seinen Beobachtungen den Schluss ziehen zu dürfen,
dass die Unterbrechung der Areale in den Alpen aus der Verdrängung
der betreffenden Arten durch die seit der Glacialzeit veränderten klimatischen
Einflüsse hervorgegangen sei (Einfluss der Winde auf die
Verbreitung der Samen im Hochgebirge, Zeitschrift des deutschen
Alpenvereins f. 1871, S. 144). Eine einzige positive Thatsache wiegt
aber schwerer als alle Beobachtungen mit negativem Ergebniss, da die
Umstände, unter denen durch den Wind eine wirkliche Übertragung
bewirkt wird, nur sehr selten eintreten werden. Nach einer nicht veröffentlichten
Aufzeichnung Berthelofs habe ich einen Fall dieser Art
von den canarischen Liseln angeführt, wo in Folge eines Orkans plötzlich
eine südeuropäische Synantheree (Erigeron ambiguus) erschien^
die vorher in Teneriffa nicht bekannt war und seitdem daselbst alloé emein
verbreitet ist. (Vegetat. I, S. 581.)
Schätzbare Vorarbeiten zur Vergleichung des Endemismus verschiedener
Floren sind in den graphischen und tabellarischen Darstellungen
über die Verbreitung natürlicher Pflanzengruppen enthalten.
Dahin gehören die Abhandlungen von Liebe über die Schmarotzerpflanzen
(Berliner Schulprogramm), von R. Brown (IL) über die Coniferen
(Transact. bot. soc. Edinburgh, 10, p. 175, und PeterniamisWxttheilungen
1872 , Heft II, mit Karte), von Ascherson über die nach Art
von Zostera vegetirenden Seegräser [Peternianris Mittheilungen 1871,
S. 241 und Taf. 13). Aus der letzteren Arbeit hebe ich hervor, dass
durch die Landenge von Suez die Phanerogamen des Seewassers durchgreifend
geschieden sind; das Mittelmeer bewohnen vier Najadeen, das
1.1
II
i
rtii ,1' Jm
Iii
I i 1 Ï
> I i i
i
iio
MS
it'rii
»i«
III
IT